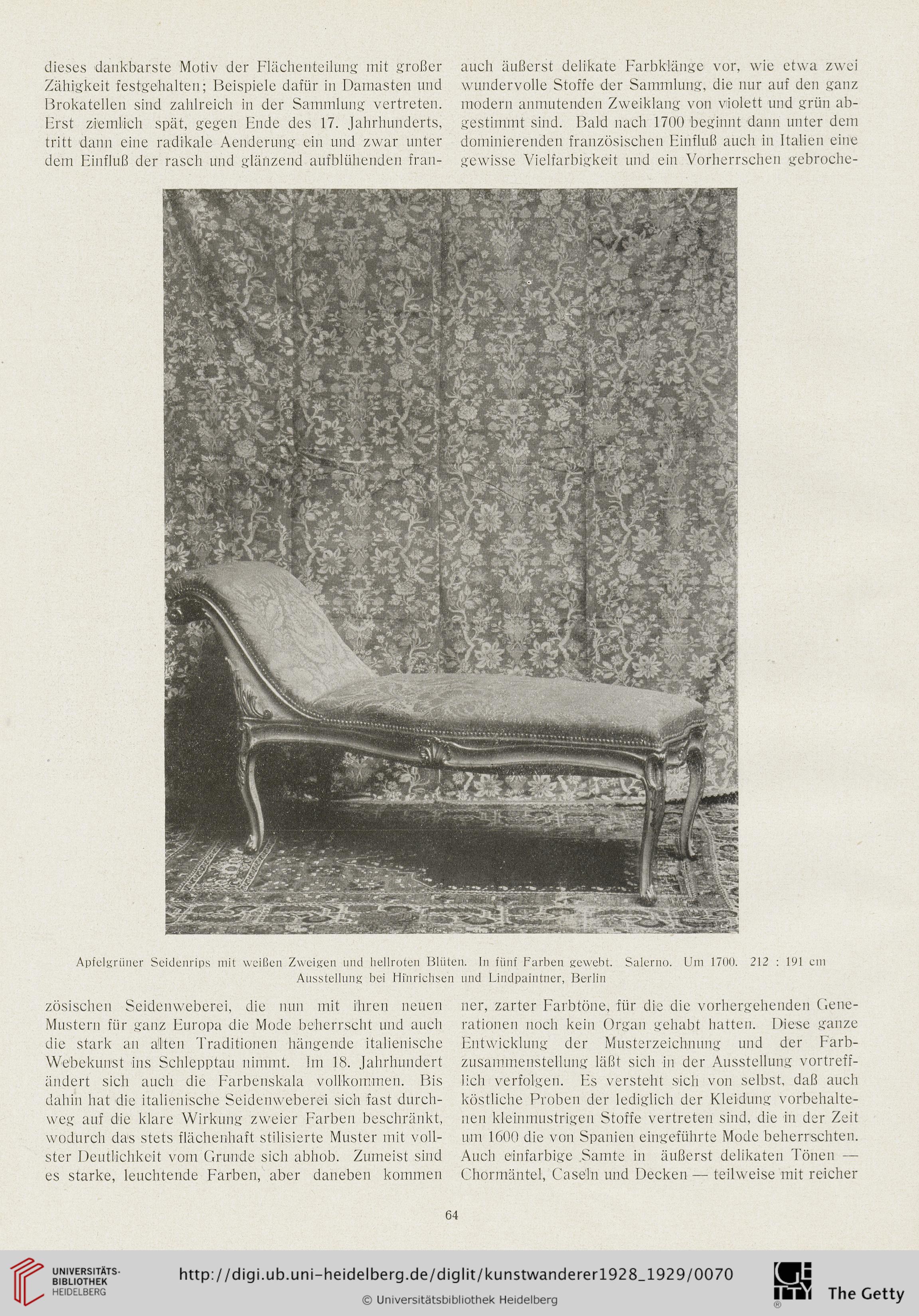Donath, Adolph [Hrsg.]
Der Kunstwanderer: Zeitschrift für alte und neue Kunst, für Kunstmarkt und Sammelwesen
— 10./11.1928/29
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0070
DOI Heft:
1./2. Oktoberheft
DOI Artikel:Schmidt, Robert: Italienische Seidenstoffe des 16. bis 18. Jahrhunderts: zur Ausstellung bei J. Hinrichsen und P. Lindpainter
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25877#0070
dieses dankbarste Motiv der Flächenteilung mit großer
Zähigkeit festgehalten; Beispiele dafür in Darnasten und
Brokatellen sind zahlreich in der Sammlung vertreten.
Erst zieml'ich spät, gegen Ende des 17. Jahrhunderts,
tritt dann eine radikale Aenderung ein und zwar unter
dem Einfluß der rasch und glänzend aufblühenden fran-
auch äußerst delikate Farbklänge vor, wie etwa zwei
wundervolle Stoffe der Sammlung, die nur auf den ganz
modern anmutenden Zweiklang von violett und grün ab-
gestimmt sind. Bald nach 1700 beginnt dann unter dem
dominierenden französischen Einfluß auch iu Italien eine
gewisse Vielfarbigkeit und ein Vorherrschen gebroche-
Apfelgrüner Seidenrips mit weißen Zweigen und heliroten Blüten. In fünf Farben gewebt. Salerno. Um 1700. 212 : 191 em
Ausstellung bei Hinrichsen und Lindpaintner, Berlin
zösischen Seidenweberei, die nun mit iliren neuen
Mustern für ganz Europa die Mode beherrscht uud aucli
die stark an atten Traditionen hängende italienische
Webekunst ins Schlepptau nimmt. Im 18. Jahrhundert
ändert sicli aucli die Farbenskala vollkommen. I3is
dahin hat die italienische Seidenweberei sich fast durch-
weg auf die klare Wirkung zweier Farben beschränkt,
wodurch das stets flächenhaft stilisierte Muster mit voll-
ster Deutlichkcit vom Grunde sich abhob. Zumeist sind
es starke, leuchtende Farben, aber daneben kommen
ner, zarter Farbtöne, für die die vorhergehenden Gene-
rationen noch kein Organ gehabt hatten. Diese ganze
Entwicklung der Musterzeichnung und der Farb-
zusammenstellung läßt sicli in der Ausstellung vortreff-
lich verfolgen. Es versteht sich von selbst, daß auch
köstliche Proben der lediglich der Kleidung vorbehalte-
nen kleinmustrigen Stoffe vertreten sind, die in der Zeit
um 1600 die von Spanien eingeführte Mode beherrschten.
Auch einfarbige Samte in äußerst delikaten Tönen —
Chormäntel, Caseln und Decken — teilweise mit reicher
64
Zähigkeit festgehalten; Beispiele dafür in Darnasten und
Brokatellen sind zahlreich in der Sammlung vertreten.
Erst zieml'ich spät, gegen Ende des 17. Jahrhunderts,
tritt dann eine radikale Aenderung ein und zwar unter
dem Einfluß der rasch und glänzend aufblühenden fran-
auch äußerst delikate Farbklänge vor, wie etwa zwei
wundervolle Stoffe der Sammlung, die nur auf den ganz
modern anmutenden Zweiklang von violett und grün ab-
gestimmt sind. Bald nach 1700 beginnt dann unter dem
dominierenden französischen Einfluß auch iu Italien eine
gewisse Vielfarbigkeit und ein Vorherrschen gebroche-
Apfelgrüner Seidenrips mit weißen Zweigen und heliroten Blüten. In fünf Farben gewebt. Salerno. Um 1700. 212 : 191 em
Ausstellung bei Hinrichsen und Lindpaintner, Berlin
zösischen Seidenweberei, die nun mit iliren neuen
Mustern für ganz Europa die Mode beherrscht uud aucli
die stark an atten Traditionen hängende italienische
Webekunst ins Schlepptau nimmt. Im 18. Jahrhundert
ändert sicli aucli die Farbenskala vollkommen. I3is
dahin hat die italienische Seidenweberei sich fast durch-
weg auf die klare Wirkung zweier Farben beschränkt,
wodurch das stets flächenhaft stilisierte Muster mit voll-
ster Deutlichkcit vom Grunde sich abhob. Zumeist sind
es starke, leuchtende Farben, aber daneben kommen
ner, zarter Farbtöne, für die die vorhergehenden Gene-
rationen noch kein Organ gehabt hatten. Diese ganze
Entwicklung der Musterzeichnung und der Farb-
zusammenstellung läßt sicli in der Ausstellung vortreff-
lich verfolgen. Es versteht sich von selbst, daß auch
köstliche Proben der lediglich der Kleidung vorbehalte-
nen kleinmustrigen Stoffe vertreten sind, die in der Zeit
um 1600 die von Spanien eingeführte Mode beherrschten.
Auch einfarbige Samte in äußerst delikaten Tönen —
Chormäntel, Caseln und Decken — teilweise mit reicher
64