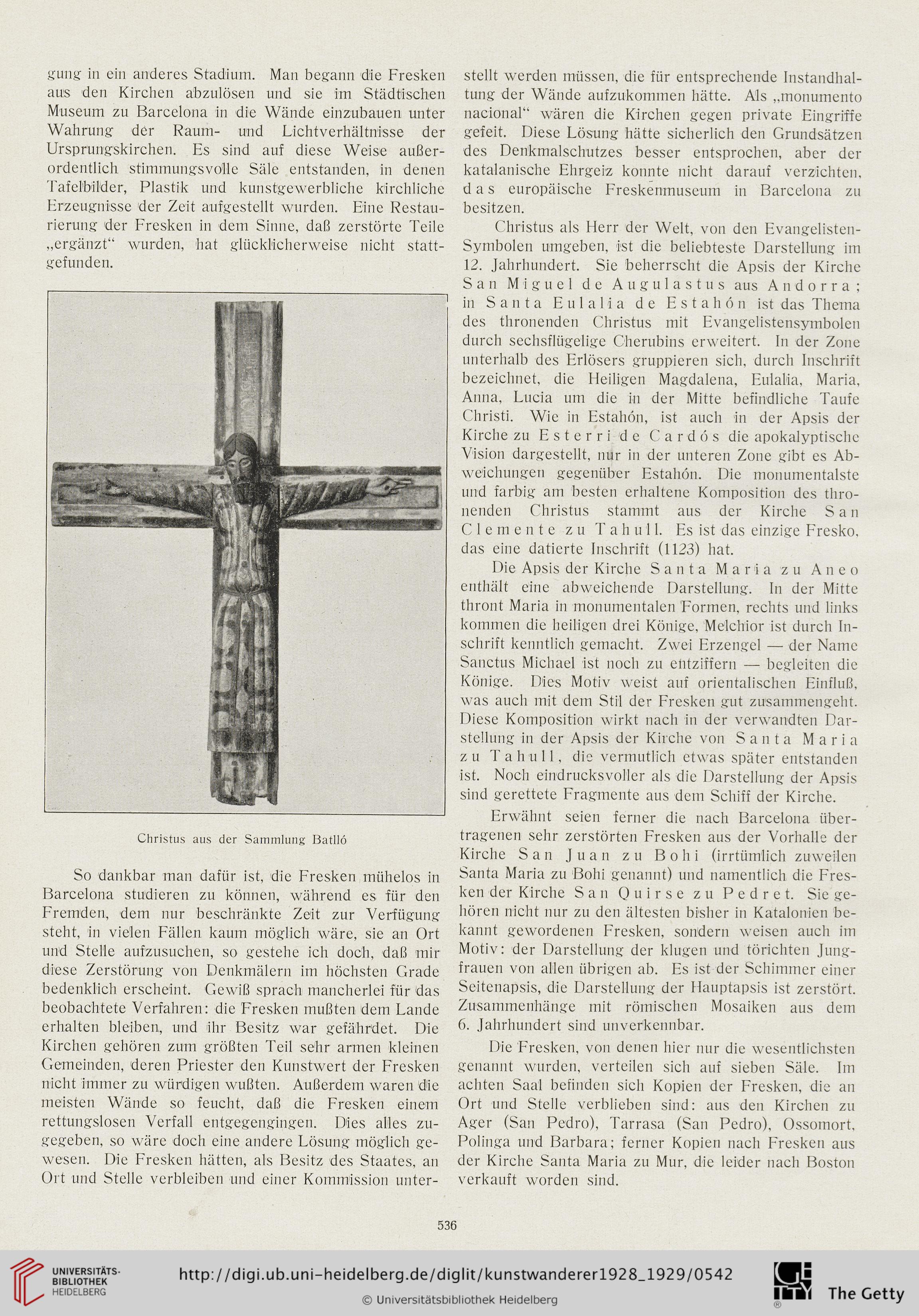gung iu ein anderes Stadium. Man begann die Fresken
aus den Kirchen abzulösen und sie im Städtischen
Museum zu Barcelona in die Wände einzubauen unter
Wahrung der Raum- und Lichtverhältnisse der
Ursprungskirchen. Es sind auf diese Weise außer-
ordentlich stimmungsvoUe Säle entstanden, in denen
TafeMWer, Plastik und kunstgewerbliche k'irchliche
Erzeugnisse der Zeit aufgestellt wurden. Eine Restau-
rierung der Fresken in dem Sinne, daß zerstörte Teile
„ergänzt“ wurden, hat glücklichcrweise nicht statt-
gefunden.
So dankbar man dafür ist, die Fresken mühelos in
Barcelona studieren zu können, während es für den
Fremden, dem nur beschränkte Zeit zur Verfügung
steht, in vielen Fällen kaum möglich wäre, sie an Ort
und Steile aufzusuchen, so gestehe ich doch, daß mir
diese Zerstörung von Denkmälern im höchsten Grade
bedenklich erscheint. Gewiß sprach mancherlei für das
beobachtete Verfahren: die Fresken mußten dem Lande
erhalten bleiben, und ihr Besitz war gefährdet. Die
Kirchen gehören zum größten Teil sehr armen kleinen
Gemeinden, deren Priestcr den Kunstwert der Fresken
nicht immer zu würdigen wußten. Außerdem waren die
meisten Wände so feucht, daß die Fresken einem
rettungslosen Verfall entgegengingen. Dies alles zu-
gegeben, so wäre doch eine andere Lösung mög'lich ge-
wesen. Die Fresken hätten, als Besitz des Staates, an
Ort und Stelle verbleiben und einer Kommission unter-
stellt werden müssen, die für entsprechende Instandhal-
tung der Wände aufzukommen liätte. Als „monumento
nacional“ wären die Kirchen gegen private Eingriffe
gefeit. Diese Lösung hätte sicherlich den Grundsätzen
des Denkmalschutzes besser entsprochen, aber der
katalanische Ehrgeiz konnte nicht darauf verzichtcn,
d a s europäische Freskenmuseum in Barcelona zu
besitzen.
Christus als Herr der Welt, von den Evangelisten-
Symbolen umgeben, ist die beliebteste Darsteliung im
12. Jahrhundert. Sie beherrsclit die Apsis der Kirche
San Miguel de Augulastus aus Andorra ;
in S a n t a E u 1 a 1 i a d e E s t a h 6 n ist das Thema
des thronenden Christus mit Evangelistensymboleu
durch sechsflügelige Cherubins erweitert. In der Zone
unterhalb des Erlösers gruppieren sich, durch Insehrift
bezeichnet, die Heiligen Magdalena, Eulalia, Maria,
Anna, Lucia um die in der Mitte befindliche Taufe
Christi. Wie in Estahön, ist auch in der Apsis der
Kirche zu Esterri.de Cardös die apokalyptische
Vision dargestellt, nur in der unteren Zone gibt es Ab-
we'ichungen gegenüber Estahön. Die monumentalste
und farbig am besten erhaltene Komposition dcs thro-
nenden Christus stammt aus der Kirche S a n
C 1 e m e n t e z u T a h u 11. Es ist das einzige Fresko,
das eine datierte Inschrift (1123) hat.
Die Apsis der Kirche S a n t a M a r i a z u A n e o
enthält eine abweichende Darstellung. In der Mitte
thront Maria in monumentalen Formen, rechts und links
kommen die heiligen drei Könige, Me'lchior ist durch In-
schrift kenntlich gemacht. Zwei Erzengel — der Name
Sauctus Michacl ist nocli zu ehtziffern — begleiten die
Könige. D'ies Motiv weist auf orientalischen Einfluß,
was auch mit dem Stil der Fresken gut zusammengeht.
Diese Komposition wirkt nach in der verwandten Dar-
stellung in dcr Apsis der Kirche von S a n t a M a r i a
zu Tahull, die vermutlich ctwas später entstanden
ist. Noch eindrucksvoller als dic Darstellung der Apsis
sind gerettete Fragmcnte aus dem Schiff der Kirche.
Erwähnt seien ferner die nach Barcelona über-
tragenen sehr zerstörten Fresken aus der Vorhalle der
Kirche S a n J u a n z u B o h i (irrtümlich zuweilen
Santa Maria zu Bohi genannt) und namentlich die Fres-
ken der Kirche S a n 0 u i r s e z u P e d r e t. Sie ge-
hörcn nicht nur zu den ältesten bisher in Katalonien be-
kannt gewordenen Fresken, sondern weisen auch im
Motiv: der Darstellung der klugen und törichten Jung-
frauen von allen übrigen ab. Es ist der Schimmer einer
Seitenapsis, die Darstellung der Hauptapsis ist zerstört.
Zusammenhänge mit römischen Mosaiken aus dem
6. Jahrhundert sind unverkennbar.
Die Fresken, von denen hier nur die wesentlichsten
genannt wurden, verteilen sich auf sieben Säle. Im
achten Saal befinden sicli Kopien der Fresken, die an
Ort und Stelle verblieben sind: aus den Kirchen zu
Ager (San Pedro), Tarrasa (San Pedro), Ossomort,
Polinga und Barbara; ferner Kopien nach Fresken aus
der Kirche Santa Maria zu Mur, die leider nach Boston
verkauft worden sind.
536
aus den Kirchen abzulösen und sie im Städtischen
Museum zu Barcelona in die Wände einzubauen unter
Wahrung der Raum- und Lichtverhältnisse der
Ursprungskirchen. Es sind auf diese Weise außer-
ordentlich stimmungsvoUe Säle entstanden, in denen
TafeMWer, Plastik und kunstgewerbliche k'irchliche
Erzeugnisse der Zeit aufgestellt wurden. Eine Restau-
rierung der Fresken in dem Sinne, daß zerstörte Teile
„ergänzt“ wurden, hat glücklichcrweise nicht statt-
gefunden.
So dankbar man dafür ist, die Fresken mühelos in
Barcelona studieren zu können, während es für den
Fremden, dem nur beschränkte Zeit zur Verfügung
steht, in vielen Fällen kaum möglich wäre, sie an Ort
und Steile aufzusuchen, so gestehe ich doch, daß mir
diese Zerstörung von Denkmälern im höchsten Grade
bedenklich erscheint. Gewiß sprach mancherlei für das
beobachtete Verfahren: die Fresken mußten dem Lande
erhalten bleiben, und ihr Besitz war gefährdet. Die
Kirchen gehören zum größten Teil sehr armen kleinen
Gemeinden, deren Priestcr den Kunstwert der Fresken
nicht immer zu würdigen wußten. Außerdem waren die
meisten Wände so feucht, daß die Fresken einem
rettungslosen Verfall entgegengingen. Dies alles zu-
gegeben, so wäre doch eine andere Lösung mög'lich ge-
wesen. Die Fresken hätten, als Besitz des Staates, an
Ort und Stelle verbleiben und einer Kommission unter-
stellt werden müssen, die für entsprechende Instandhal-
tung der Wände aufzukommen liätte. Als „monumento
nacional“ wären die Kirchen gegen private Eingriffe
gefeit. Diese Lösung hätte sicherlich den Grundsätzen
des Denkmalschutzes besser entsprochen, aber der
katalanische Ehrgeiz konnte nicht darauf verzichtcn,
d a s europäische Freskenmuseum in Barcelona zu
besitzen.
Christus als Herr der Welt, von den Evangelisten-
Symbolen umgeben, ist die beliebteste Darsteliung im
12. Jahrhundert. Sie beherrsclit die Apsis der Kirche
San Miguel de Augulastus aus Andorra ;
in S a n t a E u 1 a 1 i a d e E s t a h 6 n ist das Thema
des thronenden Christus mit Evangelistensymboleu
durch sechsflügelige Cherubins erweitert. In der Zone
unterhalb des Erlösers gruppieren sich, durch Insehrift
bezeichnet, die Heiligen Magdalena, Eulalia, Maria,
Anna, Lucia um die in der Mitte befindliche Taufe
Christi. Wie in Estahön, ist auch in der Apsis der
Kirche zu Esterri.de Cardös die apokalyptische
Vision dargestellt, nur in der unteren Zone gibt es Ab-
we'ichungen gegenüber Estahön. Die monumentalste
und farbig am besten erhaltene Komposition dcs thro-
nenden Christus stammt aus der Kirche S a n
C 1 e m e n t e z u T a h u 11. Es ist das einzige Fresko,
das eine datierte Inschrift (1123) hat.
Die Apsis der Kirche S a n t a M a r i a z u A n e o
enthält eine abweichende Darstellung. In der Mitte
thront Maria in monumentalen Formen, rechts und links
kommen die heiligen drei Könige, Me'lchior ist durch In-
schrift kenntlich gemacht. Zwei Erzengel — der Name
Sauctus Michacl ist nocli zu ehtziffern — begleiten die
Könige. D'ies Motiv weist auf orientalischen Einfluß,
was auch mit dem Stil der Fresken gut zusammengeht.
Diese Komposition wirkt nach in der verwandten Dar-
stellung in dcr Apsis der Kirche von S a n t a M a r i a
zu Tahull, die vermutlich ctwas später entstanden
ist. Noch eindrucksvoller als dic Darstellung der Apsis
sind gerettete Fragmcnte aus dem Schiff der Kirche.
Erwähnt seien ferner die nach Barcelona über-
tragenen sehr zerstörten Fresken aus der Vorhalle der
Kirche S a n J u a n z u B o h i (irrtümlich zuweilen
Santa Maria zu Bohi genannt) und namentlich die Fres-
ken der Kirche S a n 0 u i r s e z u P e d r e t. Sie ge-
hörcn nicht nur zu den ältesten bisher in Katalonien be-
kannt gewordenen Fresken, sondern weisen auch im
Motiv: der Darstellung der klugen und törichten Jung-
frauen von allen übrigen ab. Es ist der Schimmer einer
Seitenapsis, die Darstellung der Hauptapsis ist zerstört.
Zusammenhänge mit römischen Mosaiken aus dem
6. Jahrhundert sind unverkennbar.
Die Fresken, von denen hier nur die wesentlichsten
genannt wurden, verteilen sich auf sieben Säle. Im
achten Saal befinden sicli Kopien der Fresken, die an
Ort und Stelle verblieben sind: aus den Kirchen zu
Ager (San Pedro), Tarrasa (San Pedro), Ossomort,
Polinga und Barbara; ferner Kopien nach Fresken aus
der Kirche Santa Maria zu Mur, die leider nach Boston
verkauft worden sind.
536