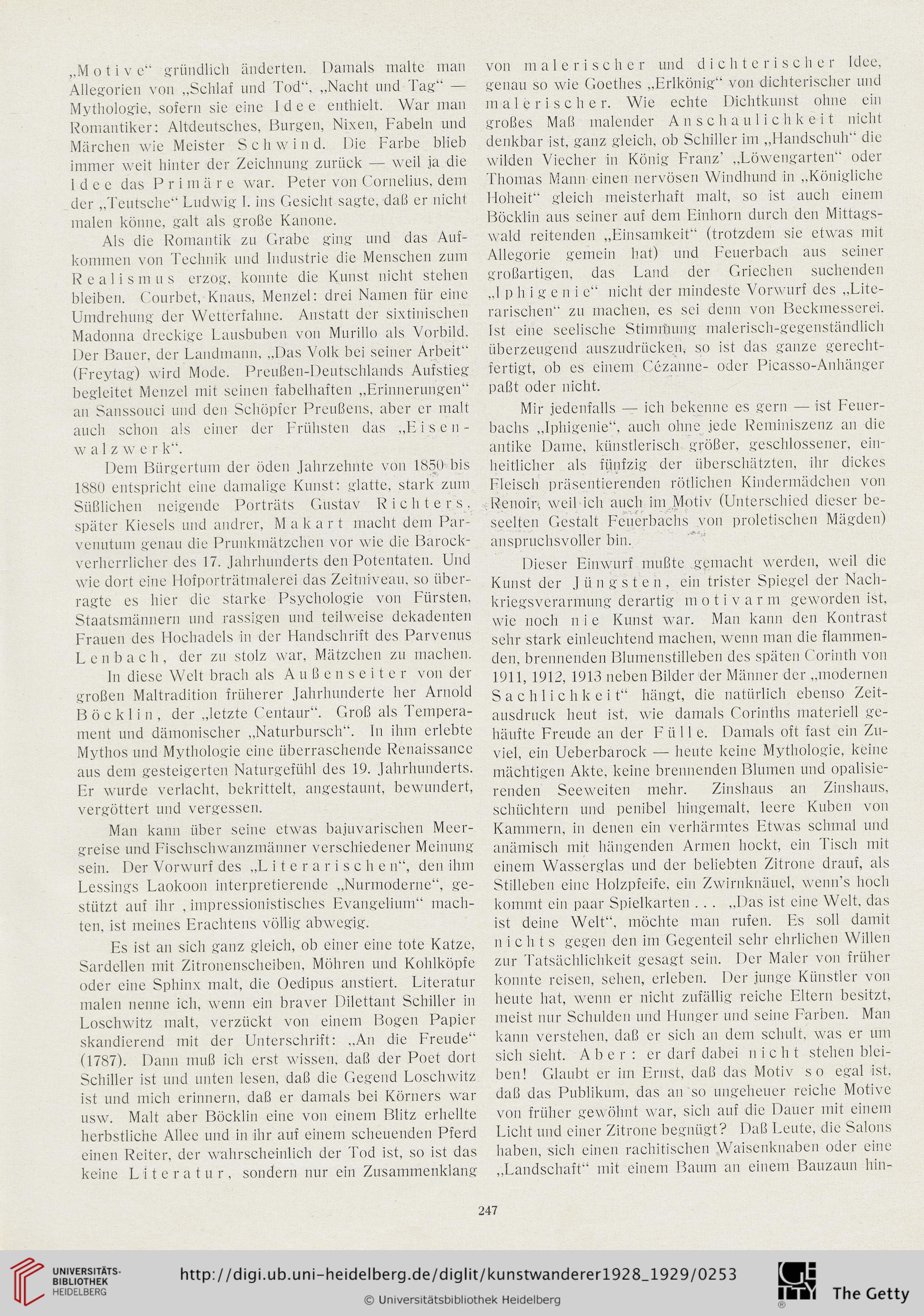„M o t i v e“ gründlich änderten. Damals malte man
Allegorien von „Schlaf und Tod“, „Nacht und Tag“ —
Mythologie, soferu sie eine I d e e enthielt. War man
Romantiker: Altdeutsches, Burgen, Nixen, Fabeln und
Märchen wie Meister S c h w i n d. Die Farbe blieb
immer weit hinter der Zeichnung zurück — weil ja die
l d e e das P r i m ä r e war. Peter von Cornelius, dem
der „Teutsche“ Ludwig I. ins Gesicht sagte, daß er nicht
malen könne, galt als große Kanone.
Als die Romantik zu Grabe ging und das Auf-
kommen von Technik und Industrie dic Menschen zum
R e a 1 i s m u s erzog, konnte die Kunst nicht stehen
bleiben. Courbet, Knaus, Menzel: drei Namen für eine
Umdrehung der Wetterfahne. Anstatt der sixtinischen
Madonna dreckige Lausbuben von Murillo als Vorbild.
Der Bauer, der Landmaun, „Das Volk bei seiner Arbeit“
(Freytag) wird Mode. Preußen-Deutschlands Aufstieg
begleitet Menzel mit seinen fabelhaften „Erinnerungen“
an Sanssouci und den Schöpfer Preußens, aber er malt
auch schon als einer der Frühsten das „E i s e n -
walzwe r k“.
Dem Bürgertum der öden Jahrzehnte von 1850 bis
1880 entspricht eine damalige Kunst: glatte, stark zum
Siißlichen neigende Porträts Gustav Richters,
später Kiesels und andrer, M a k a r t rnacht dem Par-
venutum genau die Prunkmätzchen vor wie die Barock-
verherrlicher des 17. Jahrhunderts den Potentaten. Und
wie dort eine Hofporträtmalerei das Zeitniveäu, so über-
ragte es hier die starke Psychologie von Fürsten,
Staatsmännern und rassigen und teilweise dekadenten
Frauen des Hochadels in der Handschrift des Parvenus
L e n b a c h , der zu stolz war, Mätzchen zu macheu.
In diese Welt brach als A u ß e n s e i t e r von der
großen Maltradition früherer Jahrhunderte her Arnold
B ö c k 1 i n , der „letzte Centaur“. Groß als Tempera-
ment und dämonischer „Naturbursch“. In ihm erlebte
Mythos und Mythologie eine überraschende Renaissance
aus dem gesteigerten Naturgefühl des 19. Jahrhunderts.
Er wurde verlacht, bekrittelt, angestaunt, bewundert,
vergöttert und vergessen.
Man kann über seine etwas bajuvarischen Meer-
greise und Fischschwanzmänner verschiedener Meinung
sein. Der Vorwurf des „L i t e r a r i s c h e n“, den ilun
Lessings Laokoon interpretierende „Nurmoderne“, ge-
stützt auf ihr , impressionistisches Evangelium“ macli-
ten, ist meines Erachtens völlig abwegig.
Es ist an sich ganz gleich, ob einer einc tote Katze,
Sardellen mit Zitronenscheiben, Möhren und Kohlköpfe
oder eine Sphinx malt, die Oedipus anstiert. Literatur
malen nenne ich, wenn ein braver Dilettant Schiller in
Loschwitz malt, verzückt von einem Bogen Papier
skandierend mit der Unterschrift: „An die Freude“
(1787). Dann muß icli er'st wissen, daß der Poet dort
Schiller ist und unten lesen, daß die Gcgend Loschwitz
ist und mich erinnern, daß er darnals bei Körners war
usw. Malt aber Böcklin eine von einem Idlitz erhellte
herbstliche Allee und in ihr auf einem scheuenden Pferd
einen Reiter, der wahrscheinlich der Tod ist, so ist das
keine Literatur, sondcrn nur ein Zusammenklang
von malerischer und dichterischer Idee,
genau so wie Goethes „Erlkönig“ von dichterischer und
malerischer. Wie echte Dichtkunst ohne cin
großes Maß malender A n s c h a u 1 i c h k e i t nicht
denkbar ist, ganz gleich, ob Schiller im „Handschuh“ die
wilden Viecher in König Franz’ „Löwengarten“ oder
Thomas Mann einen nervösen Windhund in „Königliche
Hoheit“ gleich meisterliaft malt, so ist auch einem
Böcklin aus seiner auf dem Einhorn durch den Mittags-
wald reitenden „Einsamkeit“ (trotzdem sie etwas mit
Allegorie gemein liat) und Feuerbach aus seiner
großartigen, das Land der Griechen suchenden
„I p h i g e n i e“ uicht der mindeste Vorwurf dcs „Lite-
rarischen“ zu rnachen, es sei denn von Beckmesserei.
Ist einc seelische Stimn'iung malerisch-gegenständlich
überzeugend auszudrücken, so ist das ganze gerecht-
fertigt, ob es einem Gezanne- oder Picasso-Anhänger
paßt oder nicht.
Mir jedenfalls — ich bekenne es gern — ist Feuer-
bachs „Iphigenie“, auch olnie jede Reminiszenz an die
antike Dame, künstlerisch größer, geschlossener, ein-
heitlicher als fünfzig der überschätzten, ihr dickes
Fleisch präsentierenden rötlichen Kindermädchen von
Renoir-, weil ieh auch im Motiv (Unterschied dieser be-
seelten Gcstalt Feuerbachs von proletischen Mägden)
anspruchsvoller bin.
Dieser Einwurf mußte gemacht werden, weil die
Kunst der J üngsten, ein trister Spiegel der Nach-
kriegsverarmung derartig m o t i v a r m geworden ist,
wie noch nie Kunst war. Man kann den Kontrast
sehr stark einleuchtend machen, wenn man die flammen-
den, brennenden Blumenstilleben des späten Corinth von
1911, 1912, 1913 neben Bildcr der Männer der „modernen
S a c h 1 i c h k e i t“ hängt, die natürlich cbenso Zeit-
ausdruck lieut ist, wie damals Corinths materiell gc-
häufte Freude an der F ii 11 e. Damals oft fast ein Zu-
viel, ein Ueberbarock — heute keine Mythologie, keine
mächtigen Akte, keine brennenden Blumen und opalisie-
renden Seeweiten mehr. Zinshaus an Zinshaus,
schüchtern und penibel hingemalt, lcere Kuben von
Kammern, in denen ein verhärmtes Etwas schmal und
anämisch mit hängenden Armen hockt, cin 'I'isch mit
cinem Wasserglas und dcr beliebten Zitrone drauf, als
Stilleben eine Holzpfeife, ein Zwirnknäuel, wenn’s hoch
kommt ein paar Spielkarten . . . „Das ist eine Welt, das
ist deine Welt“, möchte man rufen. Es soll damit
n i c h t s gegen den im Gegenteil sehr ehrlichen Willen
zur Tatsächlichkeit gesagt sein. Der Maler von früher
konnte reisen, sehen, erleben. Der junge Künstler von
heute hat, wenn er nicht zufällig reiche Eltern besitzt,
meist nur Schulden und Hunger und seine Farben. Man
kann verstehen, daß er sich an dem scliult, was er um
sich sieht. A b e r : er darf dabei n i c h t stehen blei-
ben! Glaubt er im Erust, daß das Motiv so egal ist,
daß das Publikum, das an so ungeheuer reiche Motive
von früher gewöhnt war, sicli auf dic Dauer mit einem
Licht und ciner Zitrone begnügt? Daß Leute, die Salons
haben, sich einen rachitischen Waisenknaben oder eine
„Landschaft“ mit einem Baum an einem Bauzäun hin-
247
Allegorien von „Schlaf und Tod“, „Nacht und Tag“ —
Mythologie, soferu sie eine I d e e enthielt. War man
Romantiker: Altdeutsches, Burgen, Nixen, Fabeln und
Märchen wie Meister S c h w i n d. Die Farbe blieb
immer weit hinter der Zeichnung zurück — weil ja die
l d e e das P r i m ä r e war. Peter von Cornelius, dem
der „Teutsche“ Ludwig I. ins Gesicht sagte, daß er nicht
malen könne, galt als große Kanone.
Als die Romantik zu Grabe ging und das Auf-
kommen von Technik und Industrie dic Menschen zum
R e a 1 i s m u s erzog, konnte die Kunst nicht stehen
bleiben. Courbet, Knaus, Menzel: drei Namen für eine
Umdrehung der Wetterfahne. Anstatt der sixtinischen
Madonna dreckige Lausbuben von Murillo als Vorbild.
Der Bauer, der Landmaun, „Das Volk bei seiner Arbeit“
(Freytag) wird Mode. Preußen-Deutschlands Aufstieg
begleitet Menzel mit seinen fabelhaften „Erinnerungen“
an Sanssouci und den Schöpfer Preußens, aber er malt
auch schon als einer der Frühsten das „E i s e n -
walzwe r k“.
Dem Bürgertum der öden Jahrzehnte von 1850 bis
1880 entspricht eine damalige Kunst: glatte, stark zum
Siißlichen neigende Porträts Gustav Richters,
später Kiesels und andrer, M a k a r t rnacht dem Par-
venutum genau die Prunkmätzchen vor wie die Barock-
verherrlicher des 17. Jahrhunderts den Potentaten. Und
wie dort eine Hofporträtmalerei das Zeitniveäu, so über-
ragte es hier die starke Psychologie von Fürsten,
Staatsmännern und rassigen und teilweise dekadenten
Frauen des Hochadels in der Handschrift des Parvenus
L e n b a c h , der zu stolz war, Mätzchen zu macheu.
In diese Welt brach als A u ß e n s e i t e r von der
großen Maltradition früherer Jahrhunderte her Arnold
B ö c k 1 i n , der „letzte Centaur“. Groß als Tempera-
ment und dämonischer „Naturbursch“. In ihm erlebte
Mythos und Mythologie eine überraschende Renaissance
aus dem gesteigerten Naturgefühl des 19. Jahrhunderts.
Er wurde verlacht, bekrittelt, angestaunt, bewundert,
vergöttert und vergessen.
Man kann über seine etwas bajuvarischen Meer-
greise und Fischschwanzmänner verschiedener Meinung
sein. Der Vorwurf des „L i t e r a r i s c h e n“, den ilun
Lessings Laokoon interpretierende „Nurmoderne“, ge-
stützt auf ihr , impressionistisches Evangelium“ macli-
ten, ist meines Erachtens völlig abwegig.
Es ist an sich ganz gleich, ob einer einc tote Katze,
Sardellen mit Zitronenscheiben, Möhren und Kohlköpfe
oder eine Sphinx malt, die Oedipus anstiert. Literatur
malen nenne ich, wenn ein braver Dilettant Schiller in
Loschwitz malt, verzückt von einem Bogen Papier
skandierend mit der Unterschrift: „An die Freude“
(1787). Dann muß icli er'st wissen, daß der Poet dort
Schiller ist und unten lesen, daß die Gcgend Loschwitz
ist und mich erinnern, daß er darnals bei Körners war
usw. Malt aber Böcklin eine von einem Idlitz erhellte
herbstliche Allee und in ihr auf einem scheuenden Pferd
einen Reiter, der wahrscheinlich der Tod ist, so ist das
keine Literatur, sondcrn nur ein Zusammenklang
von malerischer und dichterischer Idee,
genau so wie Goethes „Erlkönig“ von dichterischer und
malerischer. Wie echte Dichtkunst ohne cin
großes Maß malender A n s c h a u 1 i c h k e i t nicht
denkbar ist, ganz gleich, ob Schiller im „Handschuh“ die
wilden Viecher in König Franz’ „Löwengarten“ oder
Thomas Mann einen nervösen Windhund in „Königliche
Hoheit“ gleich meisterliaft malt, so ist auch einem
Böcklin aus seiner auf dem Einhorn durch den Mittags-
wald reitenden „Einsamkeit“ (trotzdem sie etwas mit
Allegorie gemein liat) und Feuerbach aus seiner
großartigen, das Land der Griechen suchenden
„I p h i g e n i e“ uicht der mindeste Vorwurf dcs „Lite-
rarischen“ zu rnachen, es sei denn von Beckmesserei.
Ist einc seelische Stimn'iung malerisch-gegenständlich
überzeugend auszudrücken, so ist das ganze gerecht-
fertigt, ob es einem Gezanne- oder Picasso-Anhänger
paßt oder nicht.
Mir jedenfalls — ich bekenne es gern — ist Feuer-
bachs „Iphigenie“, auch olnie jede Reminiszenz an die
antike Dame, künstlerisch größer, geschlossener, ein-
heitlicher als fünfzig der überschätzten, ihr dickes
Fleisch präsentierenden rötlichen Kindermädchen von
Renoir-, weil ieh auch im Motiv (Unterschied dieser be-
seelten Gcstalt Feuerbachs von proletischen Mägden)
anspruchsvoller bin.
Dieser Einwurf mußte gemacht werden, weil die
Kunst der J üngsten, ein trister Spiegel der Nach-
kriegsverarmung derartig m o t i v a r m geworden ist,
wie noch nie Kunst war. Man kann den Kontrast
sehr stark einleuchtend machen, wenn man die flammen-
den, brennenden Blumenstilleben des späten Corinth von
1911, 1912, 1913 neben Bildcr der Männer der „modernen
S a c h 1 i c h k e i t“ hängt, die natürlich cbenso Zeit-
ausdruck lieut ist, wie damals Corinths materiell gc-
häufte Freude an der F ii 11 e. Damals oft fast ein Zu-
viel, ein Ueberbarock — heute keine Mythologie, keine
mächtigen Akte, keine brennenden Blumen und opalisie-
renden Seeweiten mehr. Zinshaus an Zinshaus,
schüchtern und penibel hingemalt, lcere Kuben von
Kammern, in denen ein verhärmtes Etwas schmal und
anämisch mit hängenden Armen hockt, cin 'I'isch mit
cinem Wasserglas und dcr beliebten Zitrone drauf, als
Stilleben eine Holzpfeife, ein Zwirnknäuel, wenn’s hoch
kommt ein paar Spielkarten . . . „Das ist eine Welt, das
ist deine Welt“, möchte man rufen. Es soll damit
n i c h t s gegen den im Gegenteil sehr ehrlichen Willen
zur Tatsächlichkeit gesagt sein. Der Maler von früher
konnte reisen, sehen, erleben. Der junge Künstler von
heute hat, wenn er nicht zufällig reiche Eltern besitzt,
meist nur Schulden und Hunger und seine Farben. Man
kann verstehen, daß er sich an dem scliult, was er um
sich sieht. A b e r : er darf dabei n i c h t stehen blei-
ben! Glaubt er im Erust, daß das Motiv so egal ist,
daß das Publikum, das an so ungeheuer reiche Motive
von früher gewöhnt war, sicli auf dic Dauer mit einem
Licht und ciner Zitrone begnügt? Daß Leute, die Salons
haben, sich einen rachitischen Waisenknaben oder eine
„Landschaft“ mit einem Baum an einem Bauzäun hin-
247