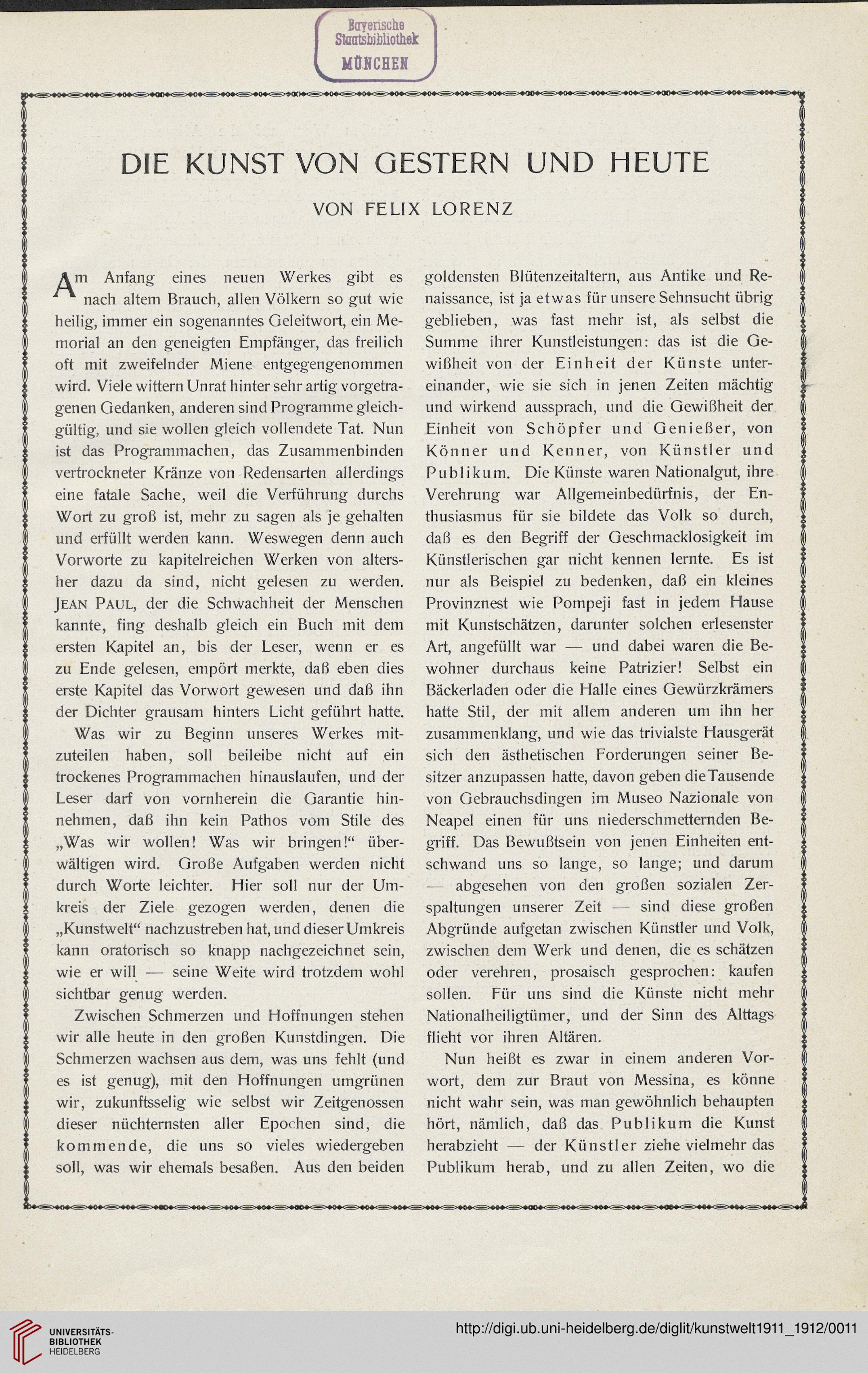* BoYensche N
Staatsbibliothek
^ MÖNCHEN J
DIE KUNST VON GESTERN UND HEUTE
VON FELIX LORENZ
| Am Anfang eines neuen Werkes gibt es
| nach altem Brauch, allen Völkern so gut wie
I heilig, immer ein sogenanntes Geleitwort, ein Me-
| morial an den geneigten Empfänger, das freilich
| oft mit zweifelnder Miene entgegengenommen
I wird. Viele wittern Unrat hinter sehr artig vorgetra-
genen Gedanken, anderen sind Programme gleich-
• gültig, und sie wollen gleich vollendete Tat. Nun
ist das Programmachen, das Zusammenbinden
I vertrockneter Kränze von Redensarten allerdings
: eine fatale Sache, weil die Verführung durchs
Wort zu groß ist, mehr zu sagen als je gehalten
| und erfüllt werden kann. Weswegen denn auch
I Vorworte zu kapitelreichen Werken von alters-
I her dazu da sind, nicht gelesen zu werden.
| Jean Paul, der die Schwachheit der Menschen
| kannte, fing deshalb gleich ein Buch mit dem
I ersten Kapitel an, bis der Leser, wenn er es
i zu Ende gelesen, empört merkte, daß eben dies
erste Kapitel das Vorwort gewesen und daß ihn
der Dichter grausam hinters Licht geführt hatte.
Was wir zu Beginn unseres Werkes mit-
zuteilen haben, soll beileibe nicht auf ein
trockenes Programmachen hinauslaufen, und der
Leser darf von vornherein die Garantie hin-
nehmen, daß ihn kein Pathos vom Stile des
„Was wir wollen! Was wir bringen!“ über-
wältigen wird. Große Aufgaben werden nicht
durch Worte leichter. Hier soll nur der Um-
kreis der Ziele gezogen werden, denen die
„Kunstwelt“ nachzustreben hat, und dieser Umkreis
kann oratorisch so knapp nachgezeichnet sein,
wie er will -— seine Weite wird trotzdem wohl
sichtbar genug werden.
Zwischen Schmerzen und Hoffnungen stehen
wir alle heute in den großen Kunstdingen. Die
Schmerzen wachsen aus dem, was uns fehlt (und
es ist genug), mit den Hoffnungen umgrünen
wir, zukunftsselig wie selbst wir Zeitgenossen
dieser nüchternsten aller Epochen sind, die
kommende, die uns so vieles wiedergeben
soll, was wir ehemals besaßen. Aus den beiden
goldensten Blütenzeitaltern, aus Antike und Re-
naissance, ist ja etwas für unsere Sehnsucht übrig
geblieben, was fast mehr ist, als selbst die
Summe ihrer Kunstleistungen: das ist die Ge-
wißheit von der Einheit der Künste unter-
einander, wie sie sich in jenen Zeiten mächtig
und wirkend aussprach, und die Gewißheit der
Einheit von Schöpfer und Genießer, von
Könner und Kenner, von Künstler und
Publikum. Die Künste waren Nationalgut, ihre
Verehrung war Allgemeinbedürfnis, der En-
thusiasmus für sie bildete das Volk so durch,
daß es den Begriff der Geschmacklosigkeit im
Künstlerischen gar nicht kennen lernte. Es ist
nur als Beispiel zu bedenken, daß ein kleines
Provinznest wie Pompeji fast in jedem Hause
mit Kunstschätzen, darunter solchen erlesenster
Art, angefüllt war — und dabei waren die Be-
wohner durchaus keine Patrizier! Selbst ein
Bäckerladen oder die Halle eines Gewürzkrämers
hatte Stil, der mit allem anderen um ihn her
zusammenklang, und wie das trivialste Hausgerät
sich den ästhetischen Forderungen seiner Be-
sitzer anzupassen hatte, davon geben dieTausende
von Gebrauchsdingen im Museo Nazionale von
Neapel einen für uns niederschmetternden Be-
griff. Das Bewußtsein von jenen Einheiten ent-
schwand uns so lange, so lange; und darum
— abgesehen von den großen sozialen Zer-
spaltungen unserer Zeit — sind diese großen
Abgründe aufgetan zwischen Künstler und Volk,
zwischen dem Werk und denen, die es schätzen
oder verehren, prosaisch gesprochen: kaufen
sollen. Für uns sind die Künste nicht mehr
Nationalheiligtümer, und der Sinn des Alttags
flieht vor ihren Altären.
Nun heißt es zwar in einem anderen Vor-
wort, dem zur Braut von Messina, es könne
nicht wahr sein, was man gewöhnlich behaupten
hört, nämlich, daß das Publikum die Kunst
herabzieht — der Künstler ziehe vielmehr das
Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die
Staatsbibliothek
^ MÖNCHEN J
DIE KUNST VON GESTERN UND HEUTE
VON FELIX LORENZ
| Am Anfang eines neuen Werkes gibt es
| nach altem Brauch, allen Völkern so gut wie
I heilig, immer ein sogenanntes Geleitwort, ein Me-
| morial an den geneigten Empfänger, das freilich
| oft mit zweifelnder Miene entgegengenommen
I wird. Viele wittern Unrat hinter sehr artig vorgetra-
genen Gedanken, anderen sind Programme gleich-
• gültig, und sie wollen gleich vollendete Tat. Nun
ist das Programmachen, das Zusammenbinden
I vertrockneter Kränze von Redensarten allerdings
: eine fatale Sache, weil die Verführung durchs
Wort zu groß ist, mehr zu sagen als je gehalten
| und erfüllt werden kann. Weswegen denn auch
I Vorworte zu kapitelreichen Werken von alters-
I her dazu da sind, nicht gelesen zu werden.
| Jean Paul, der die Schwachheit der Menschen
| kannte, fing deshalb gleich ein Buch mit dem
I ersten Kapitel an, bis der Leser, wenn er es
i zu Ende gelesen, empört merkte, daß eben dies
erste Kapitel das Vorwort gewesen und daß ihn
der Dichter grausam hinters Licht geführt hatte.
Was wir zu Beginn unseres Werkes mit-
zuteilen haben, soll beileibe nicht auf ein
trockenes Programmachen hinauslaufen, und der
Leser darf von vornherein die Garantie hin-
nehmen, daß ihn kein Pathos vom Stile des
„Was wir wollen! Was wir bringen!“ über-
wältigen wird. Große Aufgaben werden nicht
durch Worte leichter. Hier soll nur der Um-
kreis der Ziele gezogen werden, denen die
„Kunstwelt“ nachzustreben hat, und dieser Umkreis
kann oratorisch so knapp nachgezeichnet sein,
wie er will -— seine Weite wird trotzdem wohl
sichtbar genug werden.
Zwischen Schmerzen und Hoffnungen stehen
wir alle heute in den großen Kunstdingen. Die
Schmerzen wachsen aus dem, was uns fehlt (und
es ist genug), mit den Hoffnungen umgrünen
wir, zukunftsselig wie selbst wir Zeitgenossen
dieser nüchternsten aller Epochen sind, die
kommende, die uns so vieles wiedergeben
soll, was wir ehemals besaßen. Aus den beiden
goldensten Blütenzeitaltern, aus Antike und Re-
naissance, ist ja etwas für unsere Sehnsucht übrig
geblieben, was fast mehr ist, als selbst die
Summe ihrer Kunstleistungen: das ist die Ge-
wißheit von der Einheit der Künste unter-
einander, wie sie sich in jenen Zeiten mächtig
und wirkend aussprach, und die Gewißheit der
Einheit von Schöpfer und Genießer, von
Könner und Kenner, von Künstler und
Publikum. Die Künste waren Nationalgut, ihre
Verehrung war Allgemeinbedürfnis, der En-
thusiasmus für sie bildete das Volk so durch,
daß es den Begriff der Geschmacklosigkeit im
Künstlerischen gar nicht kennen lernte. Es ist
nur als Beispiel zu bedenken, daß ein kleines
Provinznest wie Pompeji fast in jedem Hause
mit Kunstschätzen, darunter solchen erlesenster
Art, angefüllt war — und dabei waren die Be-
wohner durchaus keine Patrizier! Selbst ein
Bäckerladen oder die Halle eines Gewürzkrämers
hatte Stil, der mit allem anderen um ihn her
zusammenklang, und wie das trivialste Hausgerät
sich den ästhetischen Forderungen seiner Be-
sitzer anzupassen hatte, davon geben dieTausende
von Gebrauchsdingen im Museo Nazionale von
Neapel einen für uns niederschmetternden Be-
griff. Das Bewußtsein von jenen Einheiten ent-
schwand uns so lange, so lange; und darum
— abgesehen von den großen sozialen Zer-
spaltungen unserer Zeit — sind diese großen
Abgründe aufgetan zwischen Künstler und Volk,
zwischen dem Werk und denen, die es schätzen
oder verehren, prosaisch gesprochen: kaufen
sollen. Für uns sind die Künste nicht mehr
Nationalheiligtümer, und der Sinn des Alttags
flieht vor ihren Altären.
Nun heißt es zwar in einem anderen Vor-
wort, dem zur Braut von Messina, es könne
nicht wahr sein, was man gewöhnlich behaupten
hört, nämlich, daß das Publikum die Kunst
herabzieht — der Künstler ziehe vielmehr das
Publikum herab, und zu allen Zeiten, wo die