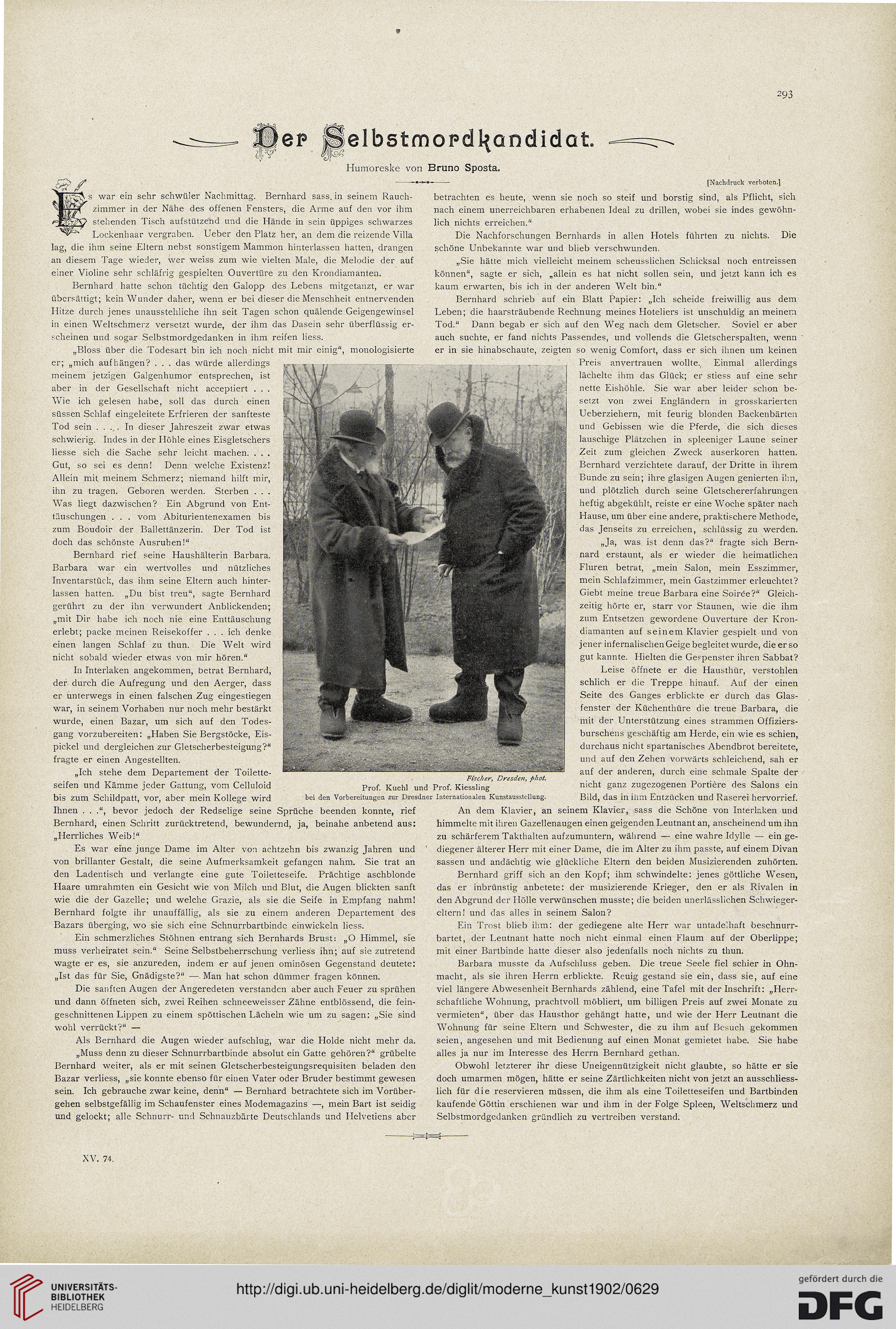9
293
ep ftelbstmopd^ondidot.
war ein sehr schwüler Nachmittag.
Bernhard sass. in seinem Rauch-
zimmer in der Nähe des offenen Fensters, die Arme auf den vor ihm
stehenden Tisch aufstützend und die Hände in sein üppiges schwarzes
Lockenhaar vergraben. Ueber den Platz her, an dem die reizende Villa
lag, die ihm seine Eltern nebst sonstigem Mammon hinterlassen hatten, drangen
an diesem Tage wieder, wer weiss zum wie vielten Male, die Melodie der auf
einer Violine sehr schläfrig gespielten Ouvertüre zu den Krondiarnanten.
Bernhard hatte schon tüchtig den Galopp des Lebens mitgetanzt, er war
übersättigt; kein Wunder daher, wenn er bei dieser die Menschheit entnervenden
Hitze durch jenes unausstehliche ihn seit Tagen schon quälende Geigengewinsel
in einen Weltschmerz versetzt wurde, der ihm das Dasein sehr überflüssig er-
scheinen und sogar Selbstmordgedanken in ihm reifen liess.
„Bloss über die Todesart bin ich noch nicht mit mir einig“, monologisierte
er; „mich aufhängen? . . . das würde allerdings
meinem jetzigen Galgenhumor entsprechen, ist
aber in der Gesellschaft nicht acceptiert . . .
WTie ich gelesen habe, soll das durch einen
süssen Schlaf eingeleitete Erfrieren der sanfteste
Tod sein .... In dieser Jahreszeit zwar etwas
schwierig. Indes in der Höhle eines Eisgletschers
Hesse sich die Sache sehr leicht machen. . . .
Gut, so sei es denn! Denn welche Existenz!
Allein mit meinem Schmerz; niemand hilft mir,
ihn zu tragen. Geboren werden. Sterben . . .
Was liegt dazwischen? Ein Abgrund von Ent-
täuschungen . . . vom Abiturientenexamen bis
zum Boudoir der Ballettänzerin. Der Tod ist
doch das schönste Ausruhen!“
Bernhard rief seine Haushälterin Barbara.
Barbara war ein wertvolles und nützliches
Inventarstück, das ihm seine Eltern auch hinter-
lassen hatten. „Du bist treu“, sagte Bernhard
gerührt zu der ihn verwundert Anblick enden;
„mit Dir habe ich noch nie eine Enttäuschung
erlebt; packe meinen Reisekoffer . . . ich denke
einen langen Schlaf zu thun. Die Welt wird
nicht sobald wieder etwas von mir hören.“
In Interlaken angekommen, betrat Bernhard,
der durch die Aufregung und den Aerger, dass
er unterwegs in einen falschen Zug eingestiegen
war, in seinem Vorhaben nur noch mehr bestärkt
wurde, einen Bazar, um sich auf den Todes-
gang vorzubereiten: „Haben Sie Bergstöcke, Eis-
pickel und dergleichen zur Gletscherbesteigung?“
fragte er einen Angestellten.
„Ich stehe dem Departement der Toilette-
seifen und Kämme jeder Gattung, vom Celluloid
bis zum Schildpatt, vor, aber mein Kollege wird
Ihnen . . .“, bevor jedoch der Redselige seine Sprüche beenden konnte, rief
Bernhard, einen Schritt zurücktretend, bewundernd, ja, beinahe anbetend aus:
„Herrliches Weib!“
Es war eine junge Dame im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren und
von brillanter Gestalt, die seine Aufmerksamkeit gefangen nahm. Sie trat an
den Ladentisch und verlangte eine gute Toiletteseife. Prächtige aschblonde
Plaare umrahmten ein Gesicht wie von Milch und Blut, die Augen blickten sanft
wie die der Gazelle; und welche Grazie, als sie die Seife in Empfang nahm!
Bernhard folgte ihr unauffällig, als sie zu einem anderen Departement des
Bazars überging, wo sie sich eine Schnurrbartbindc einwickeln liess.
Ein schmerzliches Stöhnen entrang sich Bernhards Brust: „O Himmel, sie
muss verheiratet sein.“ Seine Selbstbeherrschung verliess ihn; auf sie zutretend
wagte er es, sie anzureden, indem er auf jenen ominösen Gegenstand deutete:
„Ist das für Sie, Gnädigste?“ — Man hat schon dümmer fragen können.
Die sanften Augen der Angeredeten verstanden aber auch Feuer zu sprühen
und dann öffneten sich, zwei Reihen schneeweisser Zähne entblössend, die fein-
geschnittenen Lippen zu einem spöttischen Lächeln wie um zu sagen: „Sie sind
wohl verrückt?“ —
Als Bernhard die Augen wieder aufschlug, war die Holde nicht mehr da.
„Muss denn zu dieser Schnurrbartbinde absolut ein Gatte gehören?“ grübelte
Bernhard weiter, als er mit seinen Gletscherbesteigungsrequisiten beladen den
Bazar verliess, „sie konnte ebenso für einen Vater oder Bruder bestimmt gewesen
sein. Ich gebrauche zwar keine, denn“ — Bernhard betrachtete sich im Vorüber-
gehen selbstgefällig im Schaufenster eines Modemagazins —, mein Bart ist seidig
und gelockt; alle Schnurr- und Schnauzbärte Deutschlands und Helvetiens aber
Humoreske von Bruno Sposta.
-- [Nachdruck verboten.]
betrachten es heute, wenn sie noch so steif und borstig sind, als Pflicht, sich
nach einem unerreichbaren erhabenen Ideal zu drillen, wobei sie indes gewöhn-
lich nichts erreichen.“
Die Nachforschungen Bernhards in allen Hotels führten zu nichts. Die
schöne Unbekannte war und blieb verschwunden.
„Sie hätte mich vielleicht meinem scheusslichen Schicksal noch entreissen
können“, sagte er sich, „allein es hat nicht sollen sein, und jetzt kann ich es
kaum erwarten, bis ich in der anderen Welt bin.“
Bernhard schrieb auf ein Blatt Papier: „Ich scheide freiwillig aus dem
Leben; die haarsträubende Rechnung meines Hoteliers ist unschuldig an meinem
Tod.“ Dann begab er sich auf den Weg nach dem Gletscher. Soviel er aber
auch suchte, er fand nichts Passendes, und vollends die Gletscherspalten, wenn
er in sie hinabschaute, zeigten so wenig Comfort, dass er sich ihnen um keinen
Preis anvertrauen wollte. Einmal allerdings
lächelte ihm das Glück; er stiess auf eine sehr
nette Eishöhle. Sie war aber leider schon be-
setzt von zwei Engländern in grosskarierten
Ueberziehern, mit feurig blonden Backenbärten
und Gebissen wie die Pferde, die sich dieses
lauschige Plätzchen in spleeniger Laune seiner
Zeit zum gleichen Zweck auserkoren hatten.
Bernhard verzichtete darauf, der Dritte in ihrem
Bunde zu sein; ihre glasigen Augen genierten ihn,
und plötzlich durch seine Gletschererfahrungen
heftig abgekühlt, reiste er eine Woche später nach
Hause, um über eine andere, praktischere Methode,
das Jenseits zu erreichen, schlüssig zu werden.
„Ja, was ist denn das?“ fragte sich Bern-
nard erstaunt, als er wieder die heimatlichen
Fluren betrat, „mein Salon, mein Esszimmer,
mein Schlafzimmer, mein Gastzimmer erleuchtet?
Giebt meine treue Barbara eine Soiree?“ Gleich-
zeitig hörte er, starr vor Staunen, wie die ihm
zum Entsetzen gewordene Ouvertüre der Kron-
diamanten auf seinem Klavier gespielt und von
jener infernalischen Geige begleitet wurde, die er so
gut kannte. Hielten die Gespenster ihren Sabbat?
Leise öffnete er die Hausthür, verstohlen
schlich er die Treppe hinauf. Auf der einen
Seite des Ganges erblickte er durch das Glas-
fenster der Küchenthüre die treue Barbara, die
mit der Unterstützung eines strammen Offiziers-
burschens geschäftig am Herde, ein wie es schien,
durchaus nicht spartanisches Abendbrot bereitete,
und auf den Zehen vorwärts schleichend, sah er
auf der anderen, durch eine schmale Spalte der
nicht ganz zugezogenen Portiere des Salons ein
Bild, das in ihm Entzücken und Raserei hervorrief.
Fischer, Dresden, phot.
Prof. Kuehl und Prof. Kiessling
bei den Vorbereitungen zur Dresdner Internationalen Kunstausstellung.
An dem Klavier, an seinem Klavier, sass die Schöne von Interlaken und
himmelte mit ihren Gazellenaugen einen geigenden Leutnant an, anscheinend um ihn
zu schärferem Takthalten aufzumuntern, während — eine wahre Idylle — ein ge-
diegener älterer Herr mit einer Dame, die im Alter zu ihm passte, auf einem Divan
sassen und andächtig wie glückliche Eltern den beiden Musizierenden zuhörten.
Bernhard griff sich an den Kopf; ihm schwindelte: jenes göttliche Wesen,
das er inbrünstig anbetete: der musizierende Krieger, den er als Rivalen in
den Abgrund der Hölle verwünschen musste; die beiden unerlässlichen Schwieger-
eltern! und das alles in seinem Salon?
Ein Trost blieb ihm: der gediegene alte Herr war untadelhaft beschnurr-
bartet, der Leutnant hatte noch nicht einmal einen Flaum auf der Oberlippe;
mit einer Bartbinde hatte dieser also jedenfalls noch nichts zu thun.
Barbara musste da Aufschluss geben. Die treue Seele fiel schier in Ohn-
macht, als sie ihren Herrn erblickte. Reuig gestand sie ein, dass sie, auf eine
viel längere Abwesenheit Bernhards zählend, eine Tafel mit der Inschrift: „Herr-
schaftliche Wohnung, prachtvoll möbliert, um billigen Preis auf zwei Monate zu
vermieten“, über das Hausthor gehängt hatte, und wie der Pferr Leutnant die
Wohnung für seine Eltern und Schwester, die zu ihm auf Besuch gekommen
seien, angesehen und mit Bedienung auf einen Monat gemietet habe. Sie habe
alles ja nur im Interesse des Herrn Bernhard gethan.
Obwohl letzterer ihr diese Uneigennützigkeit nicht glaubte, so hätte er sie
doch umarmen mögen, hätte er seine Zärtlichkeiten nicht von jetzt an ausschliess-
lich für die reservieren müssen, die ihm als eine Toiletteseifen und Bartbinden
kaufende Göttin erschienen war und ihm in der Folge Spleen, Weltschmerz und
Selbstmordgedanken gründlich zu vertreiben verstand.
XV. 74.
293
ep ftelbstmopd^ondidot.
war ein sehr schwüler Nachmittag.
Bernhard sass. in seinem Rauch-
zimmer in der Nähe des offenen Fensters, die Arme auf den vor ihm
stehenden Tisch aufstützend und die Hände in sein üppiges schwarzes
Lockenhaar vergraben. Ueber den Platz her, an dem die reizende Villa
lag, die ihm seine Eltern nebst sonstigem Mammon hinterlassen hatten, drangen
an diesem Tage wieder, wer weiss zum wie vielten Male, die Melodie der auf
einer Violine sehr schläfrig gespielten Ouvertüre zu den Krondiarnanten.
Bernhard hatte schon tüchtig den Galopp des Lebens mitgetanzt, er war
übersättigt; kein Wunder daher, wenn er bei dieser die Menschheit entnervenden
Hitze durch jenes unausstehliche ihn seit Tagen schon quälende Geigengewinsel
in einen Weltschmerz versetzt wurde, der ihm das Dasein sehr überflüssig er-
scheinen und sogar Selbstmordgedanken in ihm reifen liess.
„Bloss über die Todesart bin ich noch nicht mit mir einig“, monologisierte
er; „mich aufhängen? . . . das würde allerdings
meinem jetzigen Galgenhumor entsprechen, ist
aber in der Gesellschaft nicht acceptiert . . .
WTie ich gelesen habe, soll das durch einen
süssen Schlaf eingeleitete Erfrieren der sanfteste
Tod sein .... In dieser Jahreszeit zwar etwas
schwierig. Indes in der Höhle eines Eisgletschers
Hesse sich die Sache sehr leicht machen. . . .
Gut, so sei es denn! Denn welche Existenz!
Allein mit meinem Schmerz; niemand hilft mir,
ihn zu tragen. Geboren werden. Sterben . . .
Was liegt dazwischen? Ein Abgrund von Ent-
täuschungen . . . vom Abiturientenexamen bis
zum Boudoir der Ballettänzerin. Der Tod ist
doch das schönste Ausruhen!“
Bernhard rief seine Haushälterin Barbara.
Barbara war ein wertvolles und nützliches
Inventarstück, das ihm seine Eltern auch hinter-
lassen hatten. „Du bist treu“, sagte Bernhard
gerührt zu der ihn verwundert Anblick enden;
„mit Dir habe ich noch nie eine Enttäuschung
erlebt; packe meinen Reisekoffer . . . ich denke
einen langen Schlaf zu thun. Die Welt wird
nicht sobald wieder etwas von mir hören.“
In Interlaken angekommen, betrat Bernhard,
der durch die Aufregung und den Aerger, dass
er unterwegs in einen falschen Zug eingestiegen
war, in seinem Vorhaben nur noch mehr bestärkt
wurde, einen Bazar, um sich auf den Todes-
gang vorzubereiten: „Haben Sie Bergstöcke, Eis-
pickel und dergleichen zur Gletscherbesteigung?“
fragte er einen Angestellten.
„Ich stehe dem Departement der Toilette-
seifen und Kämme jeder Gattung, vom Celluloid
bis zum Schildpatt, vor, aber mein Kollege wird
Ihnen . . .“, bevor jedoch der Redselige seine Sprüche beenden konnte, rief
Bernhard, einen Schritt zurücktretend, bewundernd, ja, beinahe anbetend aus:
„Herrliches Weib!“
Es war eine junge Dame im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren und
von brillanter Gestalt, die seine Aufmerksamkeit gefangen nahm. Sie trat an
den Ladentisch und verlangte eine gute Toiletteseife. Prächtige aschblonde
Plaare umrahmten ein Gesicht wie von Milch und Blut, die Augen blickten sanft
wie die der Gazelle; und welche Grazie, als sie die Seife in Empfang nahm!
Bernhard folgte ihr unauffällig, als sie zu einem anderen Departement des
Bazars überging, wo sie sich eine Schnurrbartbindc einwickeln liess.
Ein schmerzliches Stöhnen entrang sich Bernhards Brust: „O Himmel, sie
muss verheiratet sein.“ Seine Selbstbeherrschung verliess ihn; auf sie zutretend
wagte er es, sie anzureden, indem er auf jenen ominösen Gegenstand deutete:
„Ist das für Sie, Gnädigste?“ — Man hat schon dümmer fragen können.
Die sanften Augen der Angeredeten verstanden aber auch Feuer zu sprühen
und dann öffneten sich, zwei Reihen schneeweisser Zähne entblössend, die fein-
geschnittenen Lippen zu einem spöttischen Lächeln wie um zu sagen: „Sie sind
wohl verrückt?“ —
Als Bernhard die Augen wieder aufschlug, war die Holde nicht mehr da.
„Muss denn zu dieser Schnurrbartbinde absolut ein Gatte gehören?“ grübelte
Bernhard weiter, als er mit seinen Gletscherbesteigungsrequisiten beladen den
Bazar verliess, „sie konnte ebenso für einen Vater oder Bruder bestimmt gewesen
sein. Ich gebrauche zwar keine, denn“ — Bernhard betrachtete sich im Vorüber-
gehen selbstgefällig im Schaufenster eines Modemagazins —, mein Bart ist seidig
und gelockt; alle Schnurr- und Schnauzbärte Deutschlands und Helvetiens aber
Humoreske von Bruno Sposta.
-- [Nachdruck verboten.]
betrachten es heute, wenn sie noch so steif und borstig sind, als Pflicht, sich
nach einem unerreichbaren erhabenen Ideal zu drillen, wobei sie indes gewöhn-
lich nichts erreichen.“
Die Nachforschungen Bernhards in allen Hotels führten zu nichts. Die
schöne Unbekannte war und blieb verschwunden.
„Sie hätte mich vielleicht meinem scheusslichen Schicksal noch entreissen
können“, sagte er sich, „allein es hat nicht sollen sein, und jetzt kann ich es
kaum erwarten, bis ich in der anderen Welt bin.“
Bernhard schrieb auf ein Blatt Papier: „Ich scheide freiwillig aus dem
Leben; die haarsträubende Rechnung meines Hoteliers ist unschuldig an meinem
Tod.“ Dann begab er sich auf den Weg nach dem Gletscher. Soviel er aber
auch suchte, er fand nichts Passendes, und vollends die Gletscherspalten, wenn
er in sie hinabschaute, zeigten so wenig Comfort, dass er sich ihnen um keinen
Preis anvertrauen wollte. Einmal allerdings
lächelte ihm das Glück; er stiess auf eine sehr
nette Eishöhle. Sie war aber leider schon be-
setzt von zwei Engländern in grosskarierten
Ueberziehern, mit feurig blonden Backenbärten
und Gebissen wie die Pferde, die sich dieses
lauschige Plätzchen in spleeniger Laune seiner
Zeit zum gleichen Zweck auserkoren hatten.
Bernhard verzichtete darauf, der Dritte in ihrem
Bunde zu sein; ihre glasigen Augen genierten ihn,
und plötzlich durch seine Gletschererfahrungen
heftig abgekühlt, reiste er eine Woche später nach
Hause, um über eine andere, praktischere Methode,
das Jenseits zu erreichen, schlüssig zu werden.
„Ja, was ist denn das?“ fragte sich Bern-
nard erstaunt, als er wieder die heimatlichen
Fluren betrat, „mein Salon, mein Esszimmer,
mein Schlafzimmer, mein Gastzimmer erleuchtet?
Giebt meine treue Barbara eine Soiree?“ Gleich-
zeitig hörte er, starr vor Staunen, wie die ihm
zum Entsetzen gewordene Ouvertüre der Kron-
diamanten auf seinem Klavier gespielt und von
jener infernalischen Geige begleitet wurde, die er so
gut kannte. Hielten die Gespenster ihren Sabbat?
Leise öffnete er die Hausthür, verstohlen
schlich er die Treppe hinauf. Auf der einen
Seite des Ganges erblickte er durch das Glas-
fenster der Küchenthüre die treue Barbara, die
mit der Unterstützung eines strammen Offiziers-
burschens geschäftig am Herde, ein wie es schien,
durchaus nicht spartanisches Abendbrot bereitete,
und auf den Zehen vorwärts schleichend, sah er
auf der anderen, durch eine schmale Spalte der
nicht ganz zugezogenen Portiere des Salons ein
Bild, das in ihm Entzücken und Raserei hervorrief.
Fischer, Dresden, phot.
Prof. Kuehl und Prof. Kiessling
bei den Vorbereitungen zur Dresdner Internationalen Kunstausstellung.
An dem Klavier, an seinem Klavier, sass die Schöne von Interlaken und
himmelte mit ihren Gazellenaugen einen geigenden Leutnant an, anscheinend um ihn
zu schärferem Takthalten aufzumuntern, während — eine wahre Idylle — ein ge-
diegener älterer Herr mit einer Dame, die im Alter zu ihm passte, auf einem Divan
sassen und andächtig wie glückliche Eltern den beiden Musizierenden zuhörten.
Bernhard griff sich an den Kopf; ihm schwindelte: jenes göttliche Wesen,
das er inbrünstig anbetete: der musizierende Krieger, den er als Rivalen in
den Abgrund der Hölle verwünschen musste; die beiden unerlässlichen Schwieger-
eltern! und das alles in seinem Salon?
Ein Trost blieb ihm: der gediegene alte Herr war untadelhaft beschnurr-
bartet, der Leutnant hatte noch nicht einmal einen Flaum auf der Oberlippe;
mit einer Bartbinde hatte dieser also jedenfalls noch nichts zu thun.
Barbara musste da Aufschluss geben. Die treue Seele fiel schier in Ohn-
macht, als sie ihren Herrn erblickte. Reuig gestand sie ein, dass sie, auf eine
viel längere Abwesenheit Bernhards zählend, eine Tafel mit der Inschrift: „Herr-
schaftliche Wohnung, prachtvoll möbliert, um billigen Preis auf zwei Monate zu
vermieten“, über das Hausthor gehängt hatte, und wie der Pferr Leutnant die
Wohnung für seine Eltern und Schwester, die zu ihm auf Besuch gekommen
seien, angesehen und mit Bedienung auf einen Monat gemietet habe. Sie habe
alles ja nur im Interesse des Herrn Bernhard gethan.
Obwohl letzterer ihr diese Uneigennützigkeit nicht glaubte, so hätte er sie
doch umarmen mögen, hätte er seine Zärtlichkeiten nicht von jetzt an ausschliess-
lich für die reservieren müssen, die ihm als eine Toiletteseifen und Bartbinden
kaufende Göttin erschienen war und ihm in der Folge Spleen, Weltschmerz und
Selbstmordgedanken gründlich zu vertreiben verstand.
XV. 74.