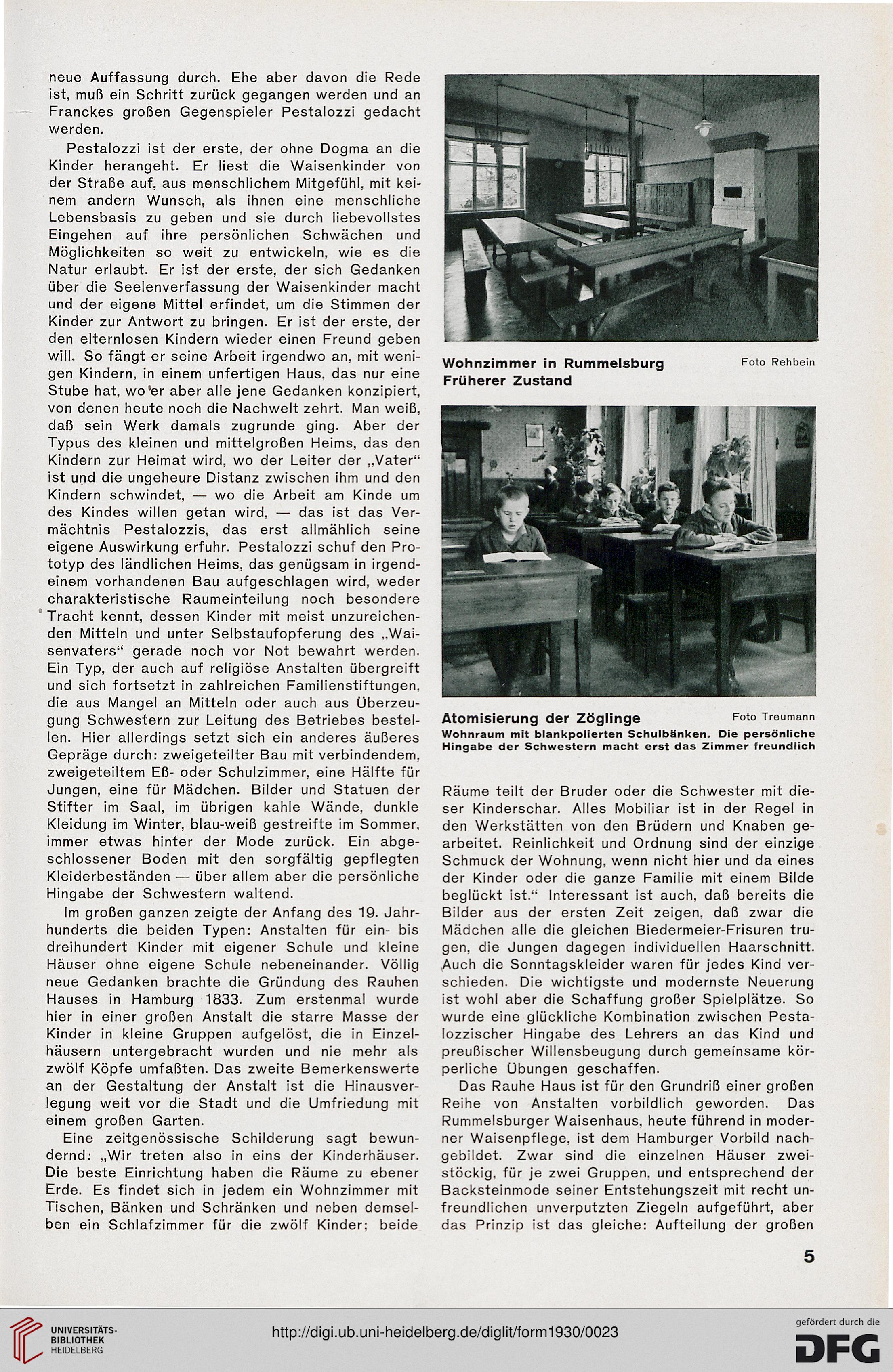neue Auffassung durch. Ehe aber davon die Rede
ist, muß ein Schritt zurück gegangen werden und an
Franckes großen Gegenspieler Pestalozzi gedacht
werden.
Pestalozzi ist der erste, der ohne Dogma an die
Kinder herangeht. Er liest die Waisenkinder von
der Straße auf, aus menschlichem Mitgefühl, mit kei-
nem andern Wunsch, als ihnen eine menschliche
Lebensbasis zu geben und sie durch liebevollstes
Eingehen auf ihre persönlichen Schwächen und
Möglichkeiten so weit zu entwickeln, wie es die
Natur erlaubt. Er ist der erste, der sich Gedanken
über die Seelenverfassung der Waisenkinder macht
und der eigene Mittel erfindet, um die Stimmen der
Kinder zur Antwort zu bringen. Er ist der erste, der
den elternlosen Kindern wieder einen Freund geben
will. So fängt er seine Arbeit irgendwo an, mit weni-
gen Kindern, in einem unfertigen Haus, das nur eine
Stube hat, wo'er aber alle jene Gedanken konzipiert,
von denen heute noch die Nachwelt zehrt. Man weiß,
daß sein Werk damals zugrunde ging. Aber der
Typus des kleinen und mittelgroßen Heims, das den
Kindern zur Heimat wird, wo der Leiter der „Vater"
ist und die ungeheure Distanz zwischen ihm und den
Kindern schwindet, — wo die Arbeit am Kinde um
des Kindes willen getan wird, — das ist das Ver-
mächtnis Pestalozzis, das erst allmählich seine
eigene Auswirkung erfuhr. Pestalozzi schuf den Pro-
totyp des ländlichen Heims, das genügsam in irgend-
einem vorhandenen Bau aufgeschlagen wird, weder
charakteristische Raumeinteilung noch besondere
Tracht kennt, dessen Kinder mit meist unzureichen-
den Mitteln und unter Selbstaufopferung des ..Wai-
senvaters" gerade noch vor Not bewahrt werden.
Ein Typ, der auch auf religiöse Anstalten übergreift
und sich fortsetzt in zahlreichen Familienstiftungen,
die aus Mangel an Mitteln oder auch aus Uberzeu-
gung Schwestern zur Leitung des Betriebes bestel-
len. Hier allerdings setzt sich ein anderes äußeres
Gepräge durch: zweigeteilter Bau mit verbindendem,
zweigeteiltem Eß- oder Schulzimmer, eine Hälfte für
Jungen, eine für Mädchen. Bilder und Statuen der
Stifter im Saal, im übrigen kahle Wände, dunkle
Kleidung im Winter, blau-weiß gestreifte im Sommer,
immer etwas hinter der Mode zurück. Ein abge-
schlossener Boden mit den sorgfältig gepflegten
Kleiderbeständen — über allem aber die persönliche
Hingabe der Schwestern waltend.
Im großen ganzen zeigte der Anfang des 19. Jahr-
hunderts die beiden Typen: Anstalten für ein- bis
dreihundert Kinder mit eigener Schule und kleine
Häuser ohne eigene Schule nebeneinander. Völlig
neue Gedanken brachte die Gründung des Rauhen
Hauses in Hamburg 1833. Zum erstenmal wurde
hier in einer großen Anstalt die starre Masse der
Kinder in kleine Gruppen aufgelöst, die in Einzel-
häusern untergebracht wurden und nie mehr als
zwölf Köpfe umfaßten. Das zweite Bemerkenswerte
an der Gestaltung der Anstalt ist die Hinausver-
legung weit vor die Stadt und die Umfriedung mit
einem großen Garten.
Eine zeitgenössische Schilderung sagt bewun-
dernd: „Wir treten also in eins der Kinderhäuser.
Die beste Einrichtung haben die Räume zu ebener
Erde. Es findet sich in jedem ein Wohnzimmer mit
Tischen, Bänken und Schränken und neben demsel-
ben ein Schlafzimmer für die zwölf Kinder: beide
Wohnzimmer in Rummelsburg F°to Rehbein
Früherer Zustand
Atomisierung der Zöglinge Fot° Treumann
Wohnraum mit blankpolierten Schulbänken. Die persönliche
Hingabe der Schwestern macht erst das Zimmer freundlich
Räume teilt der Bruder oder die Schwester mit die-
ser Kinderschar. Alles Mobiliar ist in der Regel in
den Werkstätten von den Brüdern und Knaben ge-
arbeitet. Reinlichkeit und Ordnung sind der einzige
Schmuck der Wohnung, wenn nicht hier und da eines
der Kinder oder die ganze Familie mit einem Bilde
beglückt ist." Interessant ist auch, daß bereits die
Bilder aus der ersten Zeit zeigen, daß zwar die
Mädchen alle die gleichen Biedermeier-Frisuren tru-
gen, die Jungen dagegen individuellen Haarschnitt.
Auch die Sonntagskleider waren für jedes Kind ver-
schieden. Die wichtigste und modernste Neuerung
ist wohl aber die Schaffung großer Spielplätze. So
wurde eine glückliche Kombination zwischen Pesta-
lozzischer Hingabe des Lehrers an das Kind und
preußischer Willensbeugung durch gemeinsame kör-
perliche Übungen geschaffen.
Das Rauhe Haus ist für den Grundriß einer großen
Reihe von Anstalten vorbildlich geworden. Das
Rummelsburger Waisenhaus, heute führend in moder-
ner Waisenpflege, ist dem Hamburger Vorbild nach-
gebildet. Zwar sind die einzelnen Häuser zwei-
stöckig, für je zwei Gruppen, und entsprechend der
Backsteinmode seiner Entstehungszeit mit recht un-
freundlichen unverputzten Ziegeln aufgeführt, aber
das Prinzip ist das gleiche: Aufteilung der großen
5
ist, muß ein Schritt zurück gegangen werden und an
Franckes großen Gegenspieler Pestalozzi gedacht
werden.
Pestalozzi ist der erste, der ohne Dogma an die
Kinder herangeht. Er liest die Waisenkinder von
der Straße auf, aus menschlichem Mitgefühl, mit kei-
nem andern Wunsch, als ihnen eine menschliche
Lebensbasis zu geben und sie durch liebevollstes
Eingehen auf ihre persönlichen Schwächen und
Möglichkeiten so weit zu entwickeln, wie es die
Natur erlaubt. Er ist der erste, der sich Gedanken
über die Seelenverfassung der Waisenkinder macht
und der eigene Mittel erfindet, um die Stimmen der
Kinder zur Antwort zu bringen. Er ist der erste, der
den elternlosen Kindern wieder einen Freund geben
will. So fängt er seine Arbeit irgendwo an, mit weni-
gen Kindern, in einem unfertigen Haus, das nur eine
Stube hat, wo'er aber alle jene Gedanken konzipiert,
von denen heute noch die Nachwelt zehrt. Man weiß,
daß sein Werk damals zugrunde ging. Aber der
Typus des kleinen und mittelgroßen Heims, das den
Kindern zur Heimat wird, wo der Leiter der „Vater"
ist und die ungeheure Distanz zwischen ihm und den
Kindern schwindet, — wo die Arbeit am Kinde um
des Kindes willen getan wird, — das ist das Ver-
mächtnis Pestalozzis, das erst allmählich seine
eigene Auswirkung erfuhr. Pestalozzi schuf den Pro-
totyp des ländlichen Heims, das genügsam in irgend-
einem vorhandenen Bau aufgeschlagen wird, weder
charakteristische Raumeinteilung noch besondere
Tracht kennt, dessen Kinder mit meist unzureichen-
den Mitteln und unter Selbstaufopferung des ..Wai-
senvaters" gerade noch vor Not bewahrt werden.
Ein Typ, der auch auf religiöse Anstalten übergreift
und sich fortsetzt in zahlreichen Familienstiftungen,
die aus Mangel an Mitteln oder auch aus Uberzeu-
gung Schwestern zur Leitung des Betriebes bestel-
len. Hier allerdings setzt sich ein anderes äußeres
Gepräge durch: zweigeteilter Bau mit verbindendem,
zweigeteiltem Eß- oder Schulzimmer, eine Hälfte für
Jungen, eine für Mädchen. Bilder und Statuen der
Stifter im Saal, im übrigen kahle Wände, dunkle
Kleidung im Winter, blau-weiß gestreifte im Sommer,
immer etwas hinter der Mode zurück. Ein abge-
schlossener Boden mit den sorgfältig gepflegten
Kleiderbeständen — über allem aber die persönliche
Hingabe der Schwestern waltend.
Im großen ganzen zeigte der Anfang des 19. Jahr-
hunderts die beiden Typen: Anstalten für ein- bis
dreihundert Kinder mit eigener Schule und kleine
Häuser ohne eigene Schule nebeneinander. Völlig
neue Gedanken brachte die Gründung des Rauhen
Hauses in Hamburg 1833. Zum erstenmal wurde
hier in einer großen Anstalt die starre Masse der
Kinder in kleine Gruppen aufgelöst, die in Einzel-
häusern untergebracht wurden und nie mehr als
zwölf Köpfe umfaßten. Das zweite Bemerkenswerte
an der Gestaltung der Anstalt ist die Hinausver-
legung weit vor die Stadt und die Umfriedung mit
einem großen Garten.
Eine zeitgenössische Schilderung sagt bewun-
dernd: „Wir treten also in eins der Kinderhäuser.
Die beste Einrichtung haben die Räume zu ebener
Erde. Es findet sich in jedem ein Wohnzimmer mit
Tischen, Bänken und Schränken und neben demsel-
ben ein Schlafzimmer für die zwölf Kinder: beide
Wohnzimmer in Rummelsburg F°to Rehbein
Früherer Zustand
Atomisierung der Zöglinge Fot° Treumann
Wohnraum mit blankpolierten Schulbänken. Die persönliche
Hingabe der Schwestern macht erst das Zimmer freundlich
Räume teilt der Bruder oder die Schwester mit die-
ser Kinderschar. Alles Mobiliar ist in der Regel in
den Werkstätten von den Brüdern und Knaben ge-
arbeitet. Reinlichkeit und Ordnung sind der einzige
Schmuck der Wohnung, wenn nicht hier und da eines
der Kinder oder die ganze Familie mit einem Bilde
beglückt ist." Interessant ist auch, daß bereits die
Bilder aus der ersten Zeit zeigen, daß zwar die
Mädchen alle die gleichen Biedermeier-Frisuren tru-
gen, die Jungen dagegen individuellen Haarschnitt.
Auch die Sonntagskleider waren für jedes Kind ver-
schieden. Die wichtigste und modernste Neuerung
ist wohl aber die Schaffung großer Spielplätze. So
wurde eine glückliche Kombination zwischen Pesta-
lozzischer Hingabe des Lehrers an das Kind und
preußischer Willensbeugung durch gemeinsame kör-
perliche Übungen geschaffen.
Das Rauhe Haus ist für den Grundriß einer großen
Reihe von Anstalten vorbildlich geworden. Das
Rummelsburger Waisenhaus, heute führend in moder-
ner Waisenpflege, ist dem Hamburger Vorbild nach-
gebildet. Zwar sind die einzelnen Häuser zwei-
stöckig, für je zwei Gruppen, und entsprechend der
Backsteinmode seiner Entstehungszeit mit recht un-
freundlichen unverputzten Ziegeln aufgeführt, aber
das Prinzip ist das gleiche: Aufteilung der großen
5