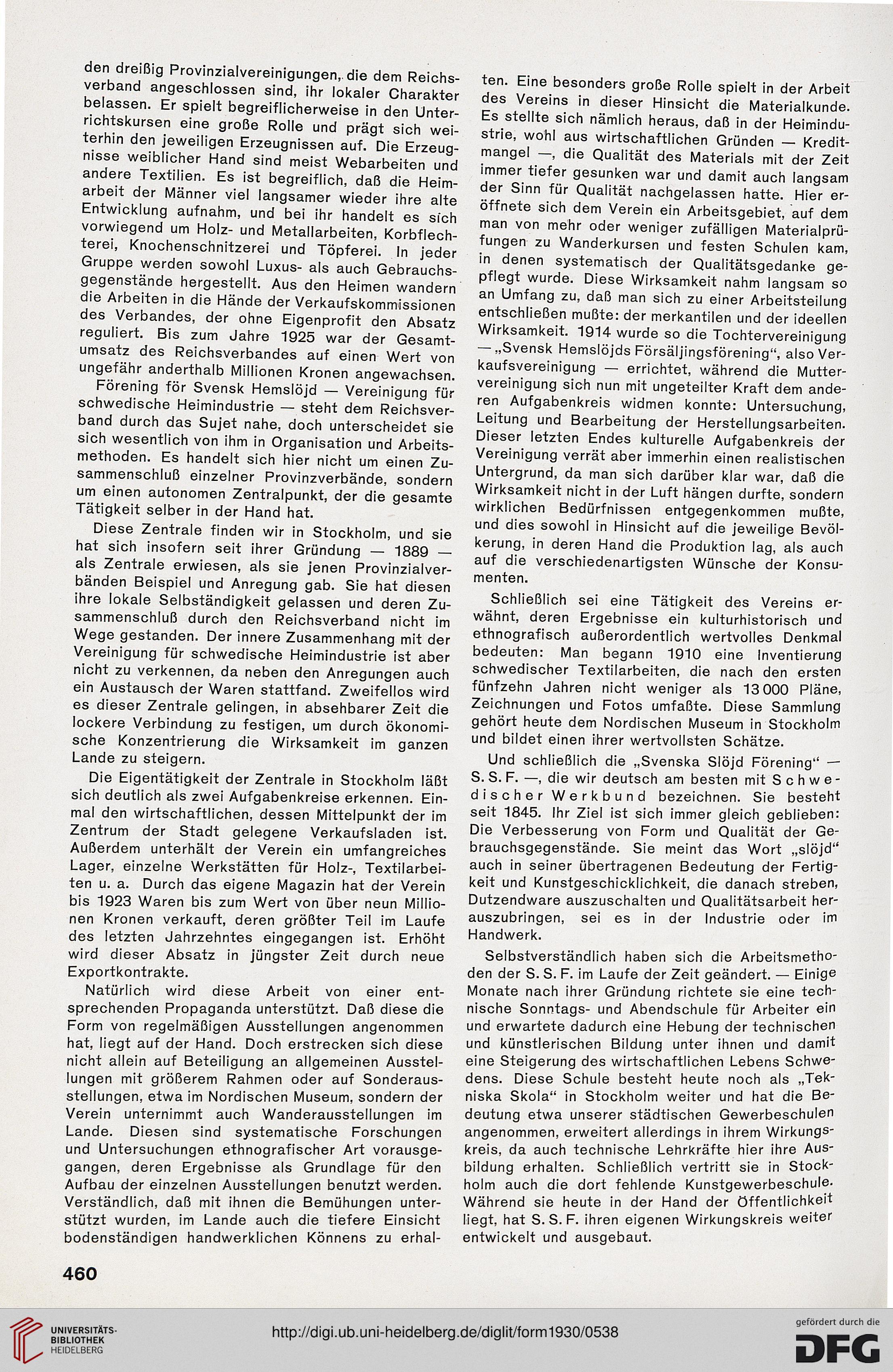den dreißig Provinzialvereinigungen, die dem Reichs-
verband angeschlossen sind, ihr lokaler Charakter
belassen. Er spielt begreiflicherweise in den Unter-
richtskursen eine große Rolle und prägt sich wei-
terhin den jeweiligen Erzeugnissen auf. Die Erzeug-
nisse weiblicher Hand sind meist Webarbeiten und
andere Textilien. Es ist begreiflich, daß die Heim-
arbeit der Männer viel langsamer wieder ihre alte
Entwicklung aufnahm, und bei ihr handelt es sich
vorwiegend um Holz- und Metallarbeiten, Korbflech-
terei, Knochenschnitzerei und Töpferei. In jeder
Gruppe werden sowohl Luxus- als auch Gebrauchs-
gegenstände hergestellt. Aus den Heimen wandern
die Arbeiten in die Hände der Verkaufskommissionen
des Verbandes, der ohne Eigenprofit den Absatz
reguliert. Bis zum Jahre 1925 war der Gesamt-
umsatz des Reichsverbandes auf einen Wert von
ungefähr anderthalb Millionen Kronen angewachsen.
Förening för Svensk Hemslöjd — Vereinigung für
schwedische Heimindustrie — steht dem Reichsver-
band durch das Sujet nahe, doch unterscheidet sie
sich wesentlich von ihm in Organisation und Arbeits-
methoden. Es handelt sich hier nicht um einen Zu-
sammenschluß einzelner Provinzverbände, sondern
um einen autonomen Zentralpunkt, der die gesamte
Tätigkeit selber in der Hand hat.
Diese Zentrale finden wir in Stockholm, und sie
hat sich insofern seit ihrer Gründung — 1889 —
als Zentrale erwiesen, als sie jenen Provinzialver-
bänden Beispiel und Anregung gab. Sie hat diesen
ihre lokale Selbständigkeit gelassen und deren Zu-
sammenschluß durch den Reichsverband nicht im
Wege gestanden. Der innere Zusammenhang mit der
Vereinigung für schwedische Heimindustrie ist aber
nicht zu verkennen, da neben den Anregungen auch
ein Austausch der Waren stattfand. Zweifellos wird
es dieser Zentrale gelingen, in absehbarer Zeit die
lockere Verbindung zu festigen, um durch ökonomi-
sche Konzentrierung die Wirksamkeit im ganzen
Lande zu steigern.
Die Eigentätigkeit der Zentrale in Stockholm läßt
sich deutlich als zwei Aufgabenkreise erkennen. Ein-
mal den wirtschaftlichen, dessen Mittelpunkt der im
Zentrum der Stadt gelegene Verkaufsladen ist.
Außerdem unterhält der Verein ein umfangreiches
Lager, einzelne Werkstätten für Holz-, Textilarbei-
ten u. a. Durch das eigene Magazin hat der Verein
bis 1923 Waren bis zum Wert von über neun Millio-
nen Kronen verkauft, deren größter Teil im Laufe
des letzten Jahrzehntes eingegangen ist. Erhöht
wird dieser Absatz in jüngster Zeit durch neue
Exportkontrakte.
Natürlich wird diese Arbeit von einer ent-
sprechenden Propaganda unterstützt. Daß diese die
Form von regelmäßigen Ausstellungen angenommen
hat, liegt auf der Hand. Doch erstrecken sich diese
nicht allein auf Beteiligung an allgemeinen Ausstel-
lungen mit größerem Rahmen oder auf Sonderaus-
stellungen, etwa im Nordischen Museum, sondern der
Verein unternimmt auch Wanderausstellungen im
Lande. Diesen sind systematische Forschungen
und Untersuchungen ethnografischer Art vorausge-
gangen, deren Ergebnisse als Grundlage für den
Aufbau der einzelnen Ausstellungen benutzt werden.
Verständlich, daß mit ihnen die Bemühungen unter-
stützt wurden, im Lande auch die tiefere Einsicht
bodenständigen handwerklichen Könnens zu erhal-
ten. Eine besonders große Rolle spielt in der Arbeit
des Vereins in dieser Hinsicht die Materialkunde.
Es stellte sich nämlich heraus, daß in der Heimindu-
strie, wohl aus wirtschaftlichen Gründen — Kredit-
mangel —, die Qualität des Materials mit der Zeit
immer tiefer gesunken war und damit auch langsam
der Sinn für Qualität nachgelassen hatte. Hier er-
öffnete sich dem Verein ein Arbeitsgebiet, auf dem
man von mehr oder weniger zufälligen Materialprü-
fungen zu Wanderkursen und festen Schulen kam,
in denen systematisch der Qualitätsgedanke ge-
pflegt wurde. Diese Wirksamkeit nahm langsam so
an Umfang zu, daß man sich zu einer Arbeitsteilung
entschließen mußte: der merkantilen und der ideellen
Wirksamkeit. 1914 wurde so die Tochtervereinigung
— Svensk Hemslöjds Försäljingsförening", also Ver-
kaufsvereinigung — errichtet, während die Mutter-
vereinigung sich nun mit ungeteilter Kraft dem ande-
ren Aufgabenkreis widmen konnte: Untersuchung,
Leitung und Bearbeitung der Herstellungsarbeiten.
Dieser letzten Endes kulturelle Aufgabenkreis der
Vereinigung verrät aber immerhin einen realistischen
Untergrund, da man sich darüber klar war, daß die
Wirksamkeit nicht in der Luft hängen durfte, sondern
wirklichen Bedürfnissen entgegenkommen mußte,
und dies sowohl in Hinsicht auf die jeweilige Bevöl-
kerung, in deren Hand die Produktion lag, als auch
auf die verschiedenartigsten Wünsche der Konsu-
menten.
Schließlich sei eine Tätigkeit des Vereins er-
wähnt, deren Ergebnisse ein kulturhistorisch und
ethnografisch außerordentlich wertvolles Denkmal
bedeuten: Man begann 1910 eine Inventierung
schwedischer Textilarbeiten, die nach den ersten
fünfzehn Jahren nicht weniger als 13 000 Pläne,
Zeichnungen und Fotos umfaßte. Diese Sammlung
gehört heute dem Nordischen Museum in Stockholm
und bildet einen ihrer wertvollsten Schätze.
Und schließlich die „Svenska Slöjd Förening" —
S. S. F. —, die wir deutsch am besten mit Schwe-
discher Werkbund bezeichnen. Sie besteht
seit 1845. Ihr Ziel ist sich immer gleich geblieben:
Die Verbesserung von Form und Qualität der Ge-
brauchsgegenstände. Sie meint das Wort „slöjd'
auch in seiner übertragenen Bedeutung der Fertig-
keit und Kunstgeschicklichkeit, die danach streben,
Dutzendware auszuschalten und Qualitätsarbeit her-
auszubringen, sei es in der Industrie oder im
Handwerk.
Selbstverständlich haben sich die Arbeitsmetho-
den der S. S. F. im Laufe der Zeit geändert. — Einige
Monate nach ihrer Gründung richtete sie eine tech-
nische Sonntags- und Abendschule für Arbeiter ein
und erwartete dadurch eine Hebung der technischen
und künstlerischen Bildung unter ihnen und damit
eine Steigerung des wirtschaftlichen Lebens Schwe-
dens. Diese Schule besteht heute noch als „Tek-
niska Skola" in Stockholm weiter und hat die Be-
deutung etwa unserer städtischen Gewerbeschulen
angenommen, erweitert allerdings in ihrem Wirkungs-
kreis, da auch technische Lehrkräfte hier ihre Aus-
bildung erhalten. Schließlich vertritt sie in Stock-
holm auch die dort fehlende Kunstgewerbeschule-
Während sie heute in der Hand der Öffentlichkeit
liegt, hat S. S. F. ihren eigenen Wirkungskreis weiter
entwickelt und ausgebaut.
460
verband angeschlossen sind, ihr lokaler Charakter
belassen. Er spielt begreiflicherweise in den Unter-
richtskursen eine große Rolle und prägt sich wei-
terhin den jeweiligen Erzeugnissen auf. Die Erzeug-
nisse weiblicher Hand sind meist Webarbeiten und
andere Textilien. Es ist begreiflich, daß die Heim-
arbeit der Männer viel langsamer wieder ihre alte
Entwicklung aufnahm, und bei ihr handelt es sich
vorwiegend um Holz- und Metallarbeiten, Korbflech-
terei, Knochenschnitzerei und Töpferei. In jeder
Gruppe werden sowohl Luxus- als auch Gebrauchs-
gegenstände hergestellt. Aus den Heimen wandern
die Arbeiten in die Hände der Verkaufskommissionen
des Verbandes, der ohne Eigenprofit den Absatz
reguliert. Bis zum Jahre 1925 war der Gesamt-
umsatz des Reichsverbandes auf einen Wert von
ungefähr anderthalb Millionen Kronen angewachsen.
Förening för Svensk Hemslöjd — Vereinigung für
schwedische Heimindustrie — steht dem Reichsver-
band durch das Sujet nahe, doch unterscheidet sie
sich wesentlich von ihm in Organisation und Arbeits-
methoden. Es handelt sich hier nicht um einen Zu-
sammenschluß einzelner Provinzverbände, sondern
um einen autonomen Zentralpunkt, der die gesamte
Tätigkeit selber in der Hand hat.
Diese Zentrale finden wir in Stockholm, und sie
hat sich insofern seit ihrer Gründung — 1889 —
als Zentrale erwiesen, als sie jenen Provinzialver-
bänden Beispiel und Anregung gab. Sie hat diesen
ihre lokale Selbständigkeit gelassen und deren Zu-
sammenschluß durch den Reichsverband nicht im
Wege gestanden. Der innere Zusammenhang mit der
Vereinigung für schwedische Heimindustrie ist aber
nicht zu verkennen, da neben den Anregungen auch
ein Austausch der Waren stattfand. Zweifellos wird
es dieser Zentrale gelingen, in absehbarer Zeit die
lockere Verbindung zu festigen, um durch ökonomi-
sche Konzentrierung die Wirksamkeit im ganzen
Lande zu steigern.
Die Eigentätigkeit der Zentrale in Stockholm läßt
sich deutlich als zwei Aufgabenkreise erkennen. Ein-
mal den wirtschaftlichen, dessen Mittelpunkt der im
Zentrum der Stadt gelegene Verkaufsladen ist.
Außerdem unterhält der Verein ein umfangreiches
Lager, einzelne Werkstätten für Holz-, Textilarbei-
ten u. a. Durch das eigene Magazin hat der Verein
bis 1923 Waren bis zum Wert von über neun Millio-
nen Kronen verkauft, deren größter Teil im Laufe
des letzten Jahrzehntes eingegangen ist. Erhöht
wird dieser Absatz in jüngster Zeit durch neue
Exportkontrakte.
Natürlich wird diese Arbeit von einer ent-
sprechenden Propaganda unterstützt. Daß diese die
Form von regelmäßigen Ausstellungen angenommen
hat, liegt auf der Hand. Doch erstrecken sich diese
nicht allein auf Beteiligung an allgemeinen Ausstel-
lungen mit größerem Rahmen oder auf Sonderaus-
stellungen, etwa im Nordischen Museum, sondern der
Verein unternimmt auch Wanderausstellungen im
Lande. Diesen sind systematische Forschungen
und Untersuchungen ethnografischer Art vorausge-
gangen, deren Ergebnisse als Grundlage für den
Aufbau der einzelnen Ausstellungen benutzt werden.
Verständlich, daß mit ihnen die Bemühungen unter-
stützt wurden, im Lande auch die tiefere Einsicht
bodenständigen handwerklichen Könnens zu erhal-
ten. Eine besonders große Rolle spielt in der Arbeit
des Vereins in dieser Hinsicht die Materialkunde.
Es stellte sich nämlich heraus, daß in der Heimindu-
strie, wohl aus wirtschaftlichen Gründen — Kredit-
mangel —, die Qualität des Materials mit der Zeit
immer tiefer gesunken war und damit auch langsam
der Sinn für Qualität nachgelassen hatte. Hier er-
öffnete sich dem Verein ein Arbeitsgebiet, auf dem
man von mehr oder weniger zufälligen Materialprü-
fungen zu Wanderkursen und festen Schulen kam,
in denen systematisch der Qualitätsgedanke ge-
pflegt wurde. Diese Wirksamkeit nahm langsam so
an Umfang zu, daß man sich zu einer Arbeitsteilung
entschließen mußte: der merkantilen und der ideellen
Wirksamkeit. 1914 wurde so die Tochtervereinigung
— Svensk Hemslöjds Försäljingsförening", also Ver-
kaufsvereinigung — errichtet, während die Mutter-
vereinigung sich nun mit ungeteilter Kraft dem ande-
ren Aufgabenkreis widmen konnte: Untersuchung,
Leitung und Bearbeitung der Herstellungsarbeiten.
Dieser letzten Endes kulturelle Aufgabenkreis der
Vereinigung verrät aber immerhin einen realistischen
Untergrund, da man sich darüber klar war, daß die
Wirksamkeit nicht in der Luft hängen durfte, sondern
wirklichen Bedürfnissen entgegenkommen mußte,
und dies sowohl in Hinsicht auf die jeweilige Bevöl-
kerung, in deren Hand die Produktion lag, als auch
auf die verschiedenartigsten Wünsche der Konsu-
menten.
Schließlich sei eine Tätigkeit des Vereins er-
wähnt, deren Ergebnisse ein kulturhistorisch und
ethnografisch außerordentlich wertvolles Denkmal
bedeuten: Man begann 1910 eine Inventierung
schwedischer Textilarbeiten, die nach den ersten
fünfzehn Jahren nicht weniger als 13 000 Pläne,
Zeichnungen und Fotos umfaßte. Diese Sammlung
gehört heute dem Nordischen Museum in Stockholm
und bildet einen ihrer wertvollsten Schätze.
Und schließlich die „Svenska Slöjd Förening" —
S. S. F. —, die wir deutsch am besten mit Schwe-
discher Werkbund bezeichnen. Sie besteht
seit 1845. Ihr Ziel ist sich immer gleich geblieben:
Die Verbesserung von Form und Qualität der Ge-
brauchsgegenstände. Sie meint das Wort „slöjd'
auch in seiner übertragenen Bedeutung der Fertig-
keit und Kunstgeschicklichkeit, die danach streben,
Dutzendware auszuschalten und Qualitätsarbeit her-
auszubringen, sei es in der Industrie oder im
Handwerk.
Selbstverständlich haben sich die Arbeitsmetho-
den der S. S. F. im Laufe der Zeit geändert. — Einige
Monate nach ihrer Gründung richtete sie eine tech-
nische Sonntags- und Abendschule für Arbeiter ein
und erwartete dadurch eine Hebung der technischen
und künstlerischen Bildung unter ihnen und damit
eine Steigerung des wirtschaftlichen Lebens Schwe-
dens. Diese Schule besteht heute noch als „Tek-
niska Skola" in Stockholm weiter und hat die Be-
deutung etwa unserer städtischen Gewerbeschulen
angenommen, erweitert allerdings in ihrem Wirkungs-
kreis, da auch technische Lehrkräfte hier ihre Aus-
bildung erhalten. Schließlich vertritt sie in Stock-
holm auch die dort fehlende Kunstgewerbeschule-
Während sie heute in der Hand der Öffentlichkeit
liegt, hat S. S. F. ihren eigenen Wirkungskreis weiter
entwickelt und ausgebaut.
460