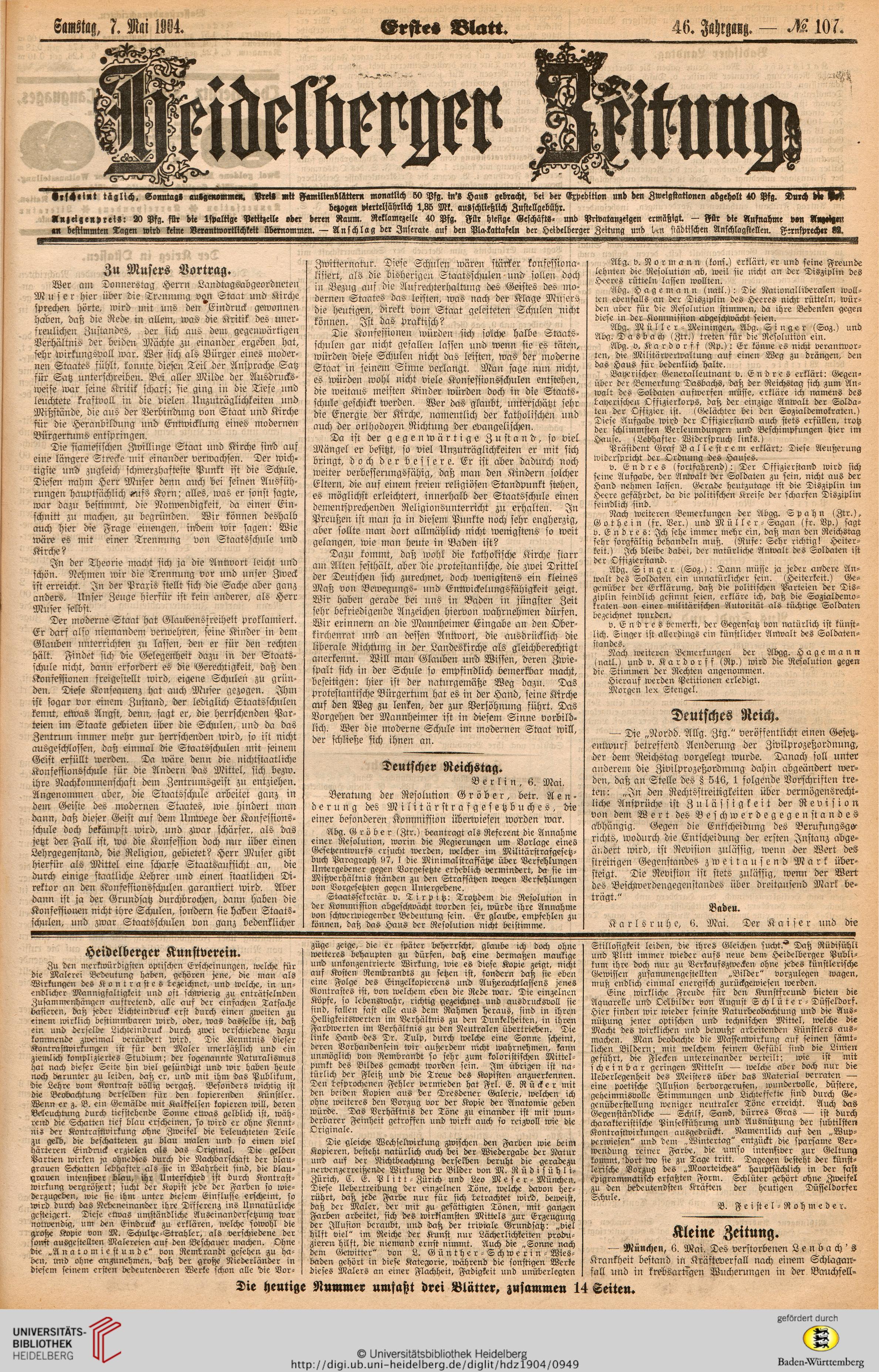Grste» Blatt
46. ZshkWß. — 107
Lmstllß, ?. Mai 18V.
G,fch»i«t täglich, Somltag» au»gmommeil. Pret» «tt KmnilienblSttent monatltch SV Pfg. in'S HauS grbracht, bei der Expedition «nd den Zwelgstationkn abgeholt 4V Pfg. Durch
bqogm vierteljährlich 1,86 Mk. auSschließlich Zustellgebühr.
»«teigeuprets: 20 Pfg. für die Ispaltige Petitzetle oder deren Raum. Reklamezeile 40 Pfg. Für hlefig« GeschäftS- und Privatanzeigen ermäßigt. — Für die Aufnahme v»n Aeqvigrn
«» bestimmten Tagen wird keine Verantwortlichkeit übernommen. — Anschlag der Jnserate aus den Pla-kattafeln der Heidelberger Zeitung und den städtischen Anschlagstellen. Frrnsprecher SS.
WS
Zu Musers Vortrag.
Wer am Donnerstag Herrn Landtagsabgeordneter:
Muser hier iiber Lie Trennrmg -v^n Staat und Kirche
sprechen hörte, wird mit uns den Eindruck gvwonnen
haben, daß die Rede in allem, was die Kritik des uner-
sreulichen Zustandes, der sich aus dem gegenwärtigen
Verhältnis der beiden Mächte zu einander erge'ben hat,
sehr wirkungsvoll war. Wer sich als Bürger eines nloder-
nen Staates siihlt, konnte diese:: Teil der Ansprache Satz
für Satz unterschreiben. Bei aller Milde der Ausdrucks-
weife war seine Kritik scharf; 'sie ging in die Tiefe nnld
leuchtete kraftvoll in die vielen Nnzuträglichkeiten und
Mißftände, die aus der Verbindung von Staat und Kirche
sur die Heranbildung und Entwicklung eines modernen
Bürgertums entspringen.
Die fiamefischen Zwillinge Staat uird Kirche sind auf
eine längere Strecke mit einander verwachsen. Der wich-
tigste und zug'leich schmerzhafteste Punkt ift die SchUle.
Diesen nähm Herr Muser denn auch bei seinen Ausfüh-
rungen hauptsächlich -rnifs Korn; alles, was er sonst sagte,
war dazu bestimmt, die Notlvendigkeit, da einen Ein-
schnitt zu machen, zu begründen. Wir können deshalb
auch hier die Frage einengen, indem wir sagen: Wie
wäre es mit einer Trennung von Staatsschnle und
Kirche?
Jn der Theorie macht sich ja die Antwort leicht und
schön. Nehmen wir die Trennung vor und unser Zweck
ist erreicht. Jn der Praxis stellt fich die Sache äber ganz
anders. Iknser Zeuge hierfür ift kein anderer, als Herr
Muser selbst.
Der moderne Staat hat Glaubensfrechett proklamiert.
Er darf also niemandem verwehven, seine Kinder in dem
Glaüben nnterrichten zn lassen, dtzn er für den rechten
hält. Findet stch 'die Gelegenheit dazn in der Staats-
schule nicht, dann erfoüdert es die Gerechtigkeit, daß den
Konfesfionen freigestellt wird, eigene Schn'len zu grün-
den. Diese Konsequenz hat auch Mufer gezogen. Jhm
ift sogar vor einem Zuftand, der Itzdiglich Staatsschnlen
kennt, etwas Angft, denn, sagt er, die herrschenden Par-
teien im Staate gebieten über die Schulen, und da das
Zentrum immer mehr znr herrscheuden wird, so ist nicht
ausgeschlossen, daß einmal 'die Staatsschnlen mtt seinem
Geist erfüllt wevden. Da wäre denn dis nichtstaatliche
Konfesfionsschule für die Andern das Mittel, sich bezw.
ihre Nachkommenschaft dem Zentrumsgeist zu entziehen.
Angenommen aber, 'die Staatsschule arbeitet ganz in
dem Geiste des modernen Staates, wie hindert man
dann, daß dieser Geist auf dew! Unüvege -der Konfefsions-
schule doch bekämpft mird, und zwar schärfer, als das
jetzt dev Fall ist, wo die Konfession doch mir über einen
Lehrgegenstand, die Religion, gtzbietet? Herr Muser gibt
hiersür als Mittel eine scharfe Staatsaufficht an, die
durch einige staatliche Lehrer und einen staatlichen M-
rektor an den Konsessionsschnlen garantiert wird. Wer
dann ist ja der Grundsatz durchbrochen, dann h'aben die
Konfessionen nicht ihre Schulen, sondern fie häben Staats-
schulen, und zwar Staatsschulen von ganz bedenklicher
ZwitternatUr. Ditzse Schiilcu wär'eu stävker konfessiona-
lisiert, als die bisherigen Stäatsschuten und sollen doch
in Bezug anf die Anfrechterhaltrmg des 'Geiftes des ino-
dernen Staates das leisten, was' nach dev Klage Musers
die heurigen, direkt vow! Staat geteiteteu Schulen nicht
können. Jst Las praktisch?
Die Konfessionen wiirden 'sich sotche halbe Staats-
schulen gar nicht gefallen lassen und wenn sie es täten,
würden diese Schulen nicht däs leiften, was der moderne
Staat in seinem Sinne ver'Iangt. Man fage nun nicht,
es würden wohl nicht viele Konftzssionsschulen entstehen,
die weitaus- meisten Kinder wüvden doch in die Staats-
schule geschickt werden. Wer das glaubt, unterschätzt sehr
die Energie der Kirche, nanientlich der katholischen und
auch der orthodoxen Richtnng der evangelischen.
Da ist der g e g e n w ä r t i g e Zustand, so viel
Mängel er besitzt, so viel Unzuträglichkeiten er mit sich
bringt, doch der besser e. Er ift äber dadurch noch
weiter verbesserungsfähig, daß man den Kindern sotcher
Eltern, die auf ein-em sreien religiösen Standpnnkt stehen,
es möglichft erleichtert, innechalb der Staatsschule einen
dementsprechendtzn Religtonsunterricht zu erhalten. Jn
Preußen tst man ja in diesem Punkte noch sehr eng'herzig,
aber sollte man dort allmählich nicht wenigstcns so weit
gelangen, wie man hente in Baden ist?
Dazu kommt, daß wo'HI die katholi'sche Ltirche starr
am 'Alten sesthält, aber die protestantische, die zwei Drittel
der Deutschen 'sich zurechntzt, doch wenigstens ein kleines
Maß von Bewegungs- nnd Entwickelungsfähigkeit zeigt.
Wir habtzn gerade 'be'i uns in Baden in jüngster Zeit
sehr besriedigende Anzeichen hiervon wahrnehmen dürfen.
Wir erinnern an die Mannheimtzr Eingabe au den Ober-
kirchenrat un'd an dessen Antiwort, die ausdrücklich die
liberale Richtüng in der Landeskirche als gkeichberechtigt
anerkennt. Will man Glauben und Wissen, deren Zwie-
spakt sich in der Schnle so empsindlich bemerkbar macht,
beseitigen: hier ist der naturgemäße Weg dazu. Das
prottzstantische Bürgertum hat es in der Hand, seine Ktrche
auf den Weg zu lenkm, der zur Versöhnung führt. Das
Vorg'ehen ^dtzr Mannheimer ist in diesem Sinne vorbild-
lich. Wer die moderne Schule im modernen Staat will,
der schließe sich ihnen an.
Deutscher Reichstag.
Berlin, 6. Mai.
Beratung der Rssolutton Gröber, betr. Aen-
derung des M i li t ä r str a fg e s e tz b u ch e s, die
einer befonderen Kommifsion übemüesen worden war.
Abg. Gröber (Ztr.) beantrc^t als RefereM die Annahme
einer Resolution, worin die Regierungen um Vorlage eines
Gcfetzentwurfs crsucht werden, welcher im Mllitärstrafgesetz-
buch Paragraph 67, I die Mininmlstrasfätze über Verfehlungen
Uniergebener gegen Vorgesetzte erheblich vermindert, da sie'im
Mißverhältnis ständen zu den Straffätzen wegen Verfehlungen
von Vorgefetzten gegen Untergebene.
Staatssekretär v. Tirpitz: Trotzdem die Resolution in
der Kommission abgeschwächt worden sei, würde ihre Annähme
von schwerwiegen-der Bedeutung sein. Er glaübe, empfehlen zu
können, daß das Hvus der Resolution nicht beistimme.
Akg. v. Normanni (konf.) erklärt, er und seine Freunde
lehnieu die Resolution ab, weil sie nicht an üer Disziplin des
Heeres rütteln lassen wolltcn.
'Abg. Hagemann (imtl.): Die Nationalli'beraten woll-
ten ebenfalls an der Disziplin des Heeres nicht rütteln, wür-
den aber für die Resolution stimmen, da ihre Bedenken gegev
dicse in der Kom-mission abgeschwächt seien.
Abg. M ü I l e r - Meiningen, ALg. -Singer (Soz.) und
Abg. Dasbach (Ztr.) treten für die Resoluiion ein.
Abg. v. Kardorss (Rp.): Er könne es nicht vcrantwor-
ten, die Militärverwaltung auf einen Weg zu drängen, den
das Haus für bedenklich halte.
Bttyerischer Generalleutnant v. Endres erklärt: Gegen-
über der Bemerkung Dasbachs, daß der Reichstag sich zum, An-
walt des Soldaten aufwerfen m'üsse, erkläre ich naniens des
bayerischen Offizierkorps, daß der einzige Anwalt der Solda-
ten der Osfizier ist. (Gelächter bei den Sozialdemokraten.)
Diese Aufgabe wird der Offizierstand auch, stets erfüllen, trotz
der schlimrnsten Verleumdunyen und Beschimpfungen hier im
Hause. (Levhafter Widerspruch links.)
PräsideM Graf Balleftrcm erklärt.: Diese Aeußerung
wider'spricht der Ordnung des Hauses.
v. Endres (fortfahrend): Der Offizierstan-d wird sich
seine Aufga-be, der Anwalt -der Soldaten zu sein, nicht aus der
Hand nehmen lassen. Gerade heutzutage ist die Disziplin im
Heere gefährdct, da die politischen Kreise der scharfen Disziplin
feind-lich sind.
Nach Weiteren Bemerkungcn der Abgg. Spahn (Ztr.) ,
Gothein (fr. Ver.) und Müller - Sagan (fr. Vp.) sagt
v. Endres: Jch, sehe immer mehr ein, dah man 'den Reichstag
sehr sorgsältig behandeln muß. (Rufe: Sehr richtig! Heiter-
keit.) Jch bleibe dabei, der natürliche Anwalt des Soldaten ist
der Osfizierstand.
Abg. Singer (Soz.): Dann müsse ja jeder andere An-
walt des Soldaten ein unnatürlicher sein. (Heiterkeit.) Ge--
gen-über der Erklärung, daß die politischen Parteien 'der Dis-
ziplin seindlich gesinnt seien, erkläre ich, daß die Sozialdemo-
kraten von einer mititärischen Autorität als tüchtige Soldaten
bezeichnet wurden.
v. Endrcs -bemerkt, der Gegensatz von natürlich ist künst-
lich. Singer ist allerdings cin künstlicher Anwalt des Soldaten-
standes.
Nach weiteren Mmerkungen der Abgg. Hagemann
(natl.) und v. Kardorsf (Rp.) wird die Refolution gegen
die Stimmen der Rechten angenommen.
Hierauf werden Petitionen erledigt.
Morgen lex Stengel.
Deutsches Reich.
— Die „Novdd. Allg. Ztg." veröffentlicht einen Gesetz-
entivurf 'Letreffend Aenderun-g der Zivilpro-zeßordnung',
der dem Reichstag vorgekegt tvurde. Danach soll unter
anderem die Zivitprozeßordnung dähin abgeändert tver-
den, daß an Stelle 'des Z 846, 1 folgende Vorfchristen tre-
ten: „Jn den Rechtsstreitigkeiten über vermögensrecht-
lick,e Ansprüchtz ist Zulässigkeit der Revision
von dem Wert des B e s ch w e r d e g e g e n st a n d e s
äbhängig. Gegen die Entscheidung des Berustingsgv'
richts, wodurch die -Entscheidung der ersten Jnstanz äbge-
ändert ioird, ist Revision zulässig, weiiu der Wert des
streitigen Gegenstaudes zweitausend Mark über-
steigt. Die Revisiou ist stets zulässig, wewn der Wert
des Beschwerdengegeustaiides über dreitauseiid Mark be-
trägt."
Badeu.
Karlsruhe, 6. Mai. Der 'K a i s e r uud die
Heidelberger Kunftverein.
Zu den inerkwürdigsten optischen Erfcheinungen, welche für
die Malerei Be'deutung haben, gehären jene, die man als
Wirkungen des Kontrastes bezeichnet, und welche, in un-
endlicher Mannigfaltigkeit und ost schwierig zu enträtselnden
Zusammenhängen auftretend, alle auf der einfachen Tatsache
basieren, datz jeder Lichteindruck erst durch eincn zweiten zu
einem wirklich bestimmbaren wird, oder, was dasselbe ist, daß
ein und Lerselbe Lichteindruck durch zwei vcrschiedcne Äazu
kommende zweimal verändert tvird. Die Kcnntnis -dieser
'Kontrasüvirkungen ist für den Maler u-nerläßlich und ein
zieinlich kompliziertes Studium; der sogenannte Naturalismus
hat nach dieser Seite hin viel 'gesündizt und 'wir haben heute
noch darunter zu leiden, datz cr, un'd mit ihm -das Publitum,
die Lehre vom Kontrast völlig vergaß. Besonders wichtig ist
die Beobachtung derselben für den kopierewden Künstler.
Wenn er z. B. ein Gemälde mit Kalkfelsen kopieren will, deren
Bckleuchtung durch tiefstehende Sonne etwas gelblich ist, tväh-
rcnd die Schatten ticf blau erscheinen, 'so wird er öhne Kennt-
nis der Kontrafiwirkung ohne Zweifel die Leleuchteten Teile
zu gelb, die beschatteten zu blau mvlen und so einen viel
härteren Eindruck erzielen als das Original. Die gelben
Partien wirken ja ohnedies durch die Nachbarschaft der blau-
grauen Schatten lebhafter als sie in Wahrheit sind, die blau-
grauen intensiver blau, ihr Unterschied ist durch Kontrast-
wirkung vergröbert; sucht der Kopist jcde der Farben so wie-
derzugeben, wie ste ihm unter diesem Einflusse erfchcint, so
wird durch das Nebeneinander ihre Diffcrcnz ins Unnatürliche
gesteigert. Diese ctwas umständliche Auseinandersehung war
notwendig, um den Einidruck zu erklären, welche sowohl die
große Kopie von M. Schultzc-Strahler, als verschiedene der
sonft ausgcstellten Malereien aus den Beschauer machen. Ohne
die „A n a t o m i e st u n d e" von Rembrandt gesehen zu ha-
ben, imd ohne anzunehmen, daß der grotzc Niederländer in
diesem seinem ersten bedeutendcren Werke schon allc bie Vor-
zügc zeige, die er später beherrscht, gl-aube ich doch ohne
weiteres behaupten zu dürfen, daß eine dermahen maukige
un!d unkonzentrierte Wirkung, 'lvie cs diese Kopie zeigt, nicht
auf Kosten- Remlbrandts zu setzen ist, sondern daß sie eben
cine Folge des Eingelkopierens un'd Außerachtlassens jenes
Kontrastes i'st, von welchem tzben die Rede war. Die einzmnen
Köpfe, so lcbenswahr, richtig gezeichnet und ausdrucksvoll ste
sind, fallen fast alle aus deni Rähnien heraus, sind in ihren
Helligkeitswerten im Verhältnis zu den Dunkelheiten, in ihren
FarLwcrten im Verhältnis zu dcn Neutralen übertrieben. Die
linke Hand -des Dr. Tulp, durch welche eine Sonne scheint,
deren Vorhändensein wir außerdem' n'icht wahrnehmen, kann
unmöglich von Rembran'dt fo sehr zum koloristischen Mittel-
punkt des Bildes gemacht tvoüden sein. Im -übrizen ist na-
türlich> der Fleiß und die Trene 'des Kopisten anzuerkennen.
Den besprochenen Fehler vermieden hat Frl. E. Rücker mit
den beidcn Kopien aus der Dresdener Galcrie, Ivelchen ich
ohnc weiteres den Vorzug vor der Kopie der Anatomie geben
würde. Das Verhältnis der Töne zu einander ist mit wun-
derbarer Feinheit getroffen und wirkt auch so reizvoll wie dic
Originalc.
Die gleickie Wechselwirkung zwischen den Fatben wie beim
Kopieren, besteht natürlich a-uch bei der Wiedergabe der Ikatur
un'd auf der Nichtbeachtung 'derselben beruht die geradezu
nervenzerreißende Wirtung der Bildcr von M. R ü d i s ü h l i-
Zürich, C. E. P l i t t - Zürich und Leo M e s e r - München.
Diese Uebertreibung -der einzelnen Tönc, 'wclche davon her-
rührt, daß jede Farbe nur sur sich betrachtet wiöd, beweist,
daß der Maler, der mit zu ge-sättigten Tönen, mit ganzen
Farben arbeitet, sich 'des wirksamsten Mittels zur Erzeugung
der Jllusion beraubt, und -datz der triviältz Grunbsatz: „viel
hilst viel" im Reichc der Kunst nur Lächerlichkeiten produ-
zieren hckft, die niemänd ernst nimmt. Auch die „Sonne nach
deni Gewitter" von L. G ü n t'h e r - S chw e r i n - Wies-
badcn gchürt in diese Katezvrie, während die sonstigen Werke
dieses Malers an einer Flachheit, Fadigkeit uiid unüberlegten
Stillosigkeit leiden, 'die ihres Gleichen sucht.^ Daß Rüdisühlr
und Plitt immer wieder aufs neue dem Heidelberger Publi-
kum ihre doch nur zu Verkaufszwccken ohne jedes tünstlerifche
Gewissen' zusammengestelltcn „Bilder" vorzulegen wagen,
niuß endlich einmal energisch zurückgewiesen werden.
Eine wirkliche Freude für den Kunsffreund bieten die
Aquarelle un'd Ocklbilder von August Schlüter- Düsseldorf.
Hier finden wir wieder feinste Naturbeobächtung und die Aus-
nützung jener optischen im'd- technischen Niittel, Ivelchc die
Mächt 'des wirklichen nnd be'irmßt arbeitenden Künstlers ans-
machen. Man beobachte die Massenwirkung auf seinen sämt-
lichen Bildern; mit welchem feinen' Gefühl sind die Linien
geführt, die Flecken uittereinander verteilt; wie ist mit
scheinbar geringen Mittcln — Ivelche aber doch nur die
Ueberlcgenhtzit des Meisters über das Niaterial verraten —
eine poetische 'Jllusion herborgevusen, wundervolle, düstere,
geheinmisvolle Stimmungcn und Lichtcffette sind durch Ge-
genllberstcllung weniger ncntraler Töne erreicht. Auch das
Gegenständliche — Schilf, -Svnd, dürres Gras — ist durch
charakteristische Pinselführimg und Ausnühung -der subtilster«
Kontrastwirtungen ausgedrückt. Nomeittlich auf den „Wup-
perwiescn" und dem „Wintertag" entzückt die sparfame Ver-
wendung reiner Farbe, die nm'so intenipver zur Geltung
komimt,'dort wo ste zu Tage tritt. Dagegen -besteht der künst-
lerische Vorzug des „Moorteiches" hanpffächlich in der fast
epigraminätisch erfatzten Form. Schlüter gehört ohne Zweifel
zu den bedeutendsten Krästen der heutigen Düsseldorfev
Schule.
B. F e i ste l - R oh m e d e r.
Kleine Zeitung.
— München, 6. Mcii. DeA verstorbenen LenLach ' S
Kr-ankheit bestand in Kräfteverfall nach einem Schtagan-
fall -nnü in krebsartigen Wncheinngen in der Bnuckifell»
Die heutige Nnmmer umfaßt drei Blätter, zujammen 14 Seite«.
46. ZshkWß. — 107
Lmstllß, ?. Mai 18V.
G,fch»i«t täglich, Somltag» au»gmommeil. Pret» «tt KmnilienblSttent monatltch SV Pfg. in'S HauS grbracht, bei der Expedition «nd den Zwelgstationkn abgeholt 4V Pfg. Durch
bqogm vierteljährlich 1,86 Mk. auSschließlich Zustellgebühr.
»«teigeuprets: 20 Pfg. für die Ispaltige Petitzetle oder deren Raum. Reklamezeile 40 Pfg. Für hlefig« GeschäftS- und Privatanzeigen ermäßigt. — Für die Aufnahme v»n Aeqvigrn
«» bestimmten Tagen wird keine Verantwortlichkeit übernommen. — Anschlag der Jnserate aus den Pla-kattafeln der Heidelberger Zeitung und den städtischen Anschlagstellen. Frrnsprecher SS.
WS
Zu Musers Vortrag.
Wer am Donnerstag Herrn Landtagsabgeordneter:
Muser hier iiber Lie Trennrmg -v^n Staat und Kirche
sprechen hörte, wird mit uns den Eindruck gvwonnen
haben, daß die Rede in allem, was die Kritik des uner-
sreulichen Zustandes, der sich aus dem gegenwärtigen
Verhältnis der beiden Mächte zu einander erge'ben hat,
sehr wirkungsvoll war. Wer sich als Bürger eines nloder-
nen Staates siihlt, konnte diese:: Teil der Ansprache Satz
für Satz unterschreiben. Bei aller Milde der Ausdrucks-
weife war seine Kritik scharf; 'sie ging in die Tiefe nnld
leuchtete kraftvoll in die vielen Nnzuträglichkeiten und
Mißftände, die aus der Verbindung von Staat und Kirche
sur die Heranbildung und Entwicklung eines modernen
Bürgertums entspringen.
Die fiamefischen Zwillinge Staat uird Kirche sind auf
eine längere Strecke mit einander verwachsen. Der wich-
tigste und zug'leich schmerzhafteste Punkt ift die SchUle.
Diesen nähm Herr Muser denn auch bei seinen Ausfüh-
rungen hauptsächlich -rnifs Korn; alles, was er sonst sagte,
war dazu bestimmt, die Notlvendigkeit, da einen Ein-
schnitt zu machen, zu begründen. Wir können deshalb
auch hier die Frage einengen, indem wir sagen: Wie
wäre es mit einer Trennung von Staatsschnle und
Kirche?
Jn der Theorie macht sich ja die Antwort leicht und
schön. Nehmen wir die Trennung vor und unser Zweck
ist erreicht. Jn der Praxis stellt fich die Sache äber ganz
anders. Iknser Zeuge hierfür ift kein anderer, als Herr
Muser selbst.
Der moderne Staat hat Glaubensfrechett proklamiert.
Er darf also niemandem verwehven, seine Kinder in dem
Glaüben nnterrichten zn lassen, dtzn er für den rechten
hält. Findet stch 'die Gelegenheit dazn in der Staats-
schule nicht, dann erfoüdert es die Gerechtigkeit, daß den
Konfesfionen freigestellt wird, eigene Schn'len zu grün-
den. Diese Konsequenz hat auch Mufer gezogen. Jhm
ift sogar vor einem Zuftand, der Itzdiglich Staatsschnlen
kennt, etwas Angft, denn, sagt er, die herrschenden Par-
teien im Staate gebieten über die Schulen, und da das
Zentrum immer mehr znr herrscheuden wird, so ist nicht
ausgeschlossen, daß einmal 'die Staatsschnlen mtt seinem
Geist erfüllt wevden. Da wäre denn dis nichtstaatliche
Konfesfionsschule für die Andern das Mittel, sich bezw.
ihre Nachkommenschaft dem Zentrumsgeist zu entziehen.
Angenommen aber, 'die Staatsschule arbeitet ganz in
dem Geiste des modernen Staates, wie hindert man
dann, daß dieser Geist auf dew! Unüvege -der Konfefsions-
schule doch bekämpft mird, und zwar schärfer, als das
jetzt dev Fall ist, wo die Konfession doch mir über einen
Lehrgegenstand, die Religion, gtzbietet? Herr Muser gibt
hiersür als Mittel eine scharfe Staatsaufficht an, die
durch einige staatliche Lehrer und einen staatlichen M-
rektor an den Konsessionsschnlen garantiert wird. Wer
dann ist ja der Grundsatz durchbrochen, dann h'aben die
Konfessionen nicht ihre Schulen, sondern fie häben Staats-
schulen, und zwar Staatsschulen von ganz bedenklicher
ZwitternatUr. Ditzse Schiilcu wär'eu stävker konfessiona-
lisiert, als die bisherigen Stäatsschuten und sollen doch
in Bezug anf die Anfrechterhaltrmg des 'Geiftes des ino-
dernen Staates das leisten, was' nach dev Klage Musers
die heurigen, direkt vow! Staat geteiteteu Schulen nicht
können. Jst Las praktisch?
Die Konfessionen wiirden 'sich sotche halbe Staats-
schulen gar nicht gefallen lassen und wenn sie es täten,
würden diese Schulen nicht däs leiften, was der moderne
Staat in seinem Sinne ver'Iangt. Man fage nun nicht,
es würden wohl nicht viele Konftzssionsschulen entstehen,
die weitaus- meisten Kinder wüvden doch in die Staats-
schule geschickt werden. Wer das glaubt, unterschätzt sehr
die Energie der Kirche, nanientlich der katholischen und
auch der orthodoxen Richtnng der evangelischen.
Da ist der g e g e n w ä r t i g e Zustand, so viel
Mängel er besitzt, so viel Unzuträglichkeiten er mit sich
bringt, doch der besser e. Er ift äber dadurch noch
weiter verbesserungsfähig, daß man den Kindern sotcher
Eltern, die auf ein-em sreien religiösen Standpnnkt stehen,
es möglichft erleichtert, innechalb der Staatsschule einen
dementsprechendtzn Religtonsunterricht zu erhalten. Jn
Preußen tst man ja in diesem Punkte noch sehr eng'herzig,
aber sollte man dort allmählich nicht wenigstcns so weit
gelangen, wie man hente in Baden ist?
Dazu kommt, daß wo'HI die katholi'sche Ltirche starr
am 'Alten sesthält, aber die protestantische, die zwei Drittel
der Deutschen 'sich zurechntzt, doch wenigstens ein kleines
Maß von Bewegungs- nnd Entwickelungsfähigkeit zeigt.
Wir habtzn gerade 'be'i uns in Baden in jüngster Zeit
sehr besriedigende Anzeichen hiervon wahrnehmen dürfen.
Wir erinnern an die Mannheimtzr Eingabe au den Ober-
kirchenrat un'd an dessen Antiwort, die ausdrücklich die
liberale Richtüng in der Landeskirche als gkeichberechtigt
anerkennt. Will man Glauben und Wissen, deren Zwie-
spakt sich in der Schnle so empsindlich bemerkbar macht,
beseitigen: hier ist der naturgemäße Weg dazu. Das
prottzstantische Bürgertum hat es in der Hand, seine Ktrche
auf den Weg zu lenkm, der zur Versöhnung führt. Das
Vorg'ehen ^dtzr Mannheimer ist in diesem Sinne vorbild-
lich. Wer die moderne Schule im modernen Staat will,
der schließe sich ihnen an.
Deutscher Reichstag.
Berlin, 6. Mai.
Beratung der Rssolutton Gröber, betr. Aen-
derung des M i li t ä r str a fg e s e tz b u ch e s, die
einer befonderen Kommifsion übemüesen worden war.
Abg. Gröber (Ztr.) beantrc^t als RefereM die Annahme
einer Resolution, worin die Regierungen um Vorlage eines
Gcfetzentwurfs crsucht werden, welcher im Mllitärstrafgesetz-
buch Paragraph 67, I die Mininmlstrasfätze über Verfehlungen
Uniergebener gegen Vorgesetzte erheblich vermindert, da sie'im
Mißverhältnis ständen zu den Straffätzen wegen Verfehlungen
von Vorgefetzten gegen Untergebene.
Staatssekretär v. Tirpitz: Trotzdem die Resolution in
der Kommission abgeschwächt worden sei, würde ihre Annähme
von schwerwiegen-der Bedeutung sein. Er glaübe, empfehlen zu
können, daß das Hvus der Resolution nicht beistimme.
Akg. v. Normanni (konf.) erklärt, er und seine Freunde
lehnieu die Resolution ab, weil sie nicht an üer Disziplin des
Heeres rütteln lassen wolltcn.
'Abg. Hagemann (imtl.): Die Nationalli'beraten woll-
ten ebenfalls an der Disziplin des Heeres nicht rütteln, wür-
den aber für die Resolution stimmen, da ihre Bedenken gegev
dicse in der Kom-mission abgeschwächt seien.
Abg. M ü I l e r - Meiningen, ALg. -Singer (Soz.) und
Abg. Dasbach (Ztr.) treten für die Resoluiion ein.
Abg. v. Kardorss (Rp.): Er könne es nicht vcrantwor-
ten, die Militärverwaltung auf einen Weg zu drängen, den
das Haus für bedenklich halte.
Bttyerischer Generalleutnant v. Endres erklärt: Gegen-
über der Bemerkung Dasbachs, daß der Reichstag sich zum, An-
walt des Soldaten aufwerfen m'üsse, erkläre ich naniens des
bayerischen Offizierkorps, daß der einzige Anwalt der Solda-
ten der Osfizier ist. (Gelächter bei den Sozialdemokraten.)
Diese Aufgabe wird der Offizierstand auch, stets erfüllen, trotz
der schlimrnsten Verleumdunyen und Beschimpfungen hier im
Hause. (Levhafter Widerspruch links.)
PräsideM Graf Balleftrcm erklärt.: Diese Aeußerung
wider'spricht der Ordnung des Hauses.
v. Endres (fortfahrend): Der Offizierstan-d wird sich
seine Aufga-be, der Anwalt -der Soldaten zu sein, nicht aus der
Hand nehmen lassen. Gerade heutzutage ist die Disziplin im
Heere gefährdct, da die politischen Kreise der scharfen Disziplin
feind-lich sind.
Nach Weiteren Bemerkungcn der Abgg. Spahn (Ztr.) ,
Gothein (fr. Ver.) und Müller - Sagan (fr. Vp.) sagt
v. Endres: Jch, sehe immer mehr ein, dah man 'den Reichstag
sehr sorgsältig behandeln muß. (Rufe: Sehr richtig! Heiter-
keit.) Jch bleibe dabei, der natürliche Anwalt des Soldaten ist
der Osfizierstand.
Abg. Singer (Soz.): Dann müsse ja jeder andere An-
walt des Soldaten ein unnatürlicher sein. (Heiterkeit.) Ge--
gen-über der Erklärung, daß die politischen Parteien 'der Dis-
ziplin seindlich gesinnt seien, erkläre ich, daß die Sozialdemo-
kraten von einer mititärischen Autorität als tüchtige Soldaten
bezeichnet wurden.
v. Endrcs -bemerkt, der Gegensatz von natürlich ist künst-
lich. Singer ist allerdings cin künstlicher Anwalt des Soldaten-
standes.
Nach weiteren Mmerkungen der Abgg. Hagemann
(natl.) und v. Kardorsf (Rp.) wird die Refolution gegen
die Stimmen der Rechten angenommen.
Hierauf werden Petitionen erledigt.
Morgen lex Stengel.
Deutsches Reich.
— Die „Novdd. Allg. Ztg." veröffentlicht einen Gesetz-
entivurf 'Letreffend Aenderun-g der Zivilpro-zeßordnung',
der dem Reichstag vorgekegt tvurde. Danach soll unter
anderem die Zivitprozeßordnung dähin abgeändert tver-
den, daß an Stelle 'des Z 846, 1 folgende Vorfchristen tre-
ten: „Jn den Rechtsstreitigkeiten über vermögensrecht-
lick,e Ansprüchtz ist Zulässigkeit der Revision
von dem Wert des B e s ch w e r d e g e g e n st a n d e s
äbhängig. Gegen die Entscheidung des Berustingsgv'
richts, wodurch die -Entscheidung der ersten Jnstanz äbge-
ändert ioird, ist Revision zulässig, weiiu der Wert des
streitigen Gegenstaudes zweitausend Mark über-
steigt. Die Revisiou ist stets zulässig, wewn der Wert
des Beschwerdengegeustaiides über dreitauseiid Mark be-
trägt."
Badeu.
Karlsruhe, 6. Mai. Der 'K a i s e r uud die
Heidelberger Kunftverein.
Zu den inerkwürdigsten optischen Erfcheinungen, welche für
die Malerei Be'deutung haben, gehären jene, die man als
Wirkungen des Kontrastes bezeichnet, und welche, in un-
endlicher Mannigfaltigkeit und ost schwierig zu enträtselnden
Zusammenhängen auftretend, alle auf der einfachen Tatsache
basieren, datz jeder Lichteindruck erst durch eincn zweiten zu
einem wirklich bestimmbaren wird, oder, was dasselbe ist, daß
ein und Lerselbe Lichteindruck durch zwei vcrschiedcne Äazu
kommende zweimal verändert tvird. Die Kcnntnis -dieser
'Kontrasüvirkungen ist für den Maler u-nerläßlich und ein
zieinlich kompliziertes Studium; der sogenannte Naturalismus
hat nach dieser Seite hin viel 'gesündizt und 'wir haben heute
noch darunter zu leiden, datz cr, un'd mit ihm -das Publitum,
die Lehre vom Kontrast völlig vergaß. Besonders wichtig ist
die Beobachtung derselben für den kopierewden Künstler.
Wenn er z. B. ein Gemälde mit Kalkfelsen kopieren will, deren
Bckleuchtung durch tiefstehende Sonne etwas gelblich ist, tväh-
rcnd die Schatten ticf blau erscheinen, 'so wird er öhne Kennt-
nis der Kontrafiwirkung ohne Zweifel die Leleuchteten Teile
zu gelb, die beschatteten zu blau mvlen und so einen viel
härteren Eindruck erzielen als das Original. Die gelben
Partien wirken ja ohnedies durch die Nachbarschaft der blau-
grauen Schatten lebhafter als sie in Wahrheit sind, die blau-
grauen intensiver blau, ihr Unterschied ist durch Kontrast-
wirkung vergröbert; sucht der Kopist jcde der Farben so wie-
derzugeben, wie ste ihm unter diesem Einflusse erfchcint, so
wird durch das Nebeneinander ihre Diffcrcnz ins Unnatürliche
gesteigert. Diese ctwas umständliche Auseinandersehung war
notwendig, um den Einidruck zu erklären, welche sowohl die
große Kopie von M. Schultzc-Strahler, als verschiedene der
sonft ausgcstellten Malereien aus den Beschauer machen. Ohne
die „A n a t o m i e st u n d e" von Rembrandt gesehen zu ha-
ben, imd ohne anzunehmen, daß der grotzc Niederländer in
diesem seinem ersten bedeutendcren Werke schon allc bie Vor-
zügc zeige, die er später beherrscht, gl-aube ich doch ohne
weiteres behaupten zu dürfen, daß eine dermahen maukige
un!d unkonzentrierte Wirkung, 'lvie cs diese Kopie zeigt, nicht
auf Kosten- Remlbrandts zu setzen ist, sondern daß sie eben
cine Folge des Eingelkopierens un'd Außerachtlassens jenes
Kontrastes i'st, von welchem tzben die Rede war. Die einzmnen
Köpfe, so lcbenswahr, richtig gezeichnet und ausdrucksvoll ste
sind, fallen fast alle aus deni Rähnien heraus, sind in ihren
Helligkeitswerten im Verhältnis zu den Dunkelheiten, in ihren
FarLwcrten im Verhältnis zu dcn Neutralen übertrieben. Die
linke Hand -des Dr. Tulp, durch welche eine Sonne scheint,
deren Vorhändensein wir außerdem' n'icht wahrnehmen, kann
unmöglich von Rembran'dt fo sehr zum koloristischen Mittel-
punkt des Bildes gemacht tvoüden sein. Im -übrizen ist na-
türlich> der Fleiß und die Trene 'des Kopisten anzuerkennen.
Den besprochenen Fehler vermieden hat Frl. E. Rücker mit
den beidcn Kopien aus der Dresdener Galcrie, Ivelchen ich
ohnc weiteres den Vorzug vor der Kopie der Anatomie geben
würde. Das Verhältnis der Töne zu einander ist mit wun-
derbarer Feinheit getroffen und wirkt auch so reizvoll wie dic
Originalc.
Die gleickie Wechselwirkung zwischen den Fatben wie beim
Kopieren, besteht natürlich a-uch bei der Wiedergabe der Ikatur
un'd auf der Nichtbeachtung 'derselben beruht die geradezu
nervenzerreißende Wirtung der Bildcr von M. R ü d i s ü h l i-
Zürich, C. E. P l i t t - Zürich und Leo M e s e r - München.
Diese Uebertreibung -der einzelnen Tönc, 'wclche davon her-
rührt, daß jede Farbe nur sur sich betrachtet wiöd, beweist,
daß der Maler, der mit zu ge-sättigten Tönen, mit ganzen
Farben arbeitet, sich 'des wirksamsten Mittels zur Erzeugung
der Jllusion beraubt, und -datz der triviältz Grunbsatz: „viel
hilst viel" im Reichc der Kunst nur Lächerlichkeiten produ-
zieren hckft, die niemänd ernst nimmt. Auch die „Sonne nach
deni Gewitter" von L. G ü n t'h e r - S chw e r i n - Wies-
badcn gchürt in diese Katezvrie, während die sonstigen Werke
dieses Malers an einer Flachheit, Fadigkeit uiid unüberlegten
Stillosigkeit leiden, 'die ihres Gleichen sucht.^ Daß Rüdisühlr
und Plitt immer wieder aufs neue dem Heidelberger Publi-
kum ihre doch nur zu Verkaufszwccken ohne jedes tünstlerifche
Gewissen' zusammengestelltcn „Bilder" vorzulegen wagen,
niuß endlich einmal energisch zurückgewiesen werden.
Eine wirkliche Freude für den Kunsffreund bieten die
Aquarelle un'd Ocklbilder von August Schlüter- Düsseldorf.
Hier finden wir wieder feinste Naturbeobächtung und die Aus-
nützung jener optischen im'd- technischen Niittel, Ivelchc die
Mächt 'des wirklichen nnd be'irmßt arbeitenden Künstlers ans-
machen. Man beobachte die Massenwirkung auf seinen sämt-
lichen Bildern; mit welchem feinen' Gefühl sind die Linien
geführt, die Flecken uittereinander verteilt; wie ist mit
scheinbar geringen Mittcln — Ivelche aber doch nur die
Ueberlcgenhtzit des Meisters über das Niaterial verraten —
eine poetische 'Jllusion herborgevusen, wundervolle, düstere,
geheinmisvolle Stimmungcn und Lichtcffette sind durch Ge-
genllberstcllung weniger ncntraler Töne erreicht. Auch das
Gegenständliche — Schilf, -Svnd, dürres Gras — ist durch
charakteristische Pinselführimg und Ausnühung -der subtilster«
Kontrastwirtungen ausgedrückt. Nomeittlich auf den „Wup-
perwiescn" und dem „Wintertag" entzückt die sparfame Ver-
wendung reiner Farbe, die nm'so intenipver zur Geltung
komimt,'dort wo ste zu Tage tritt. Dagegen -besteht der künst-
lerische Vorzug des „Moorteiches" hanpffächlich in der fast
epigraminätisch erfatzten Form. Schlüter gehört ohne Zweifel
zu den bedeutendsten Krästen der heutigen Düsseldorfev
Schule.
B. F e i ste l - R oh m e d e r.
Kleine Zeitung.
— München, 6. Mcii. DeA verstorbenen LenLach ' S
Kr-ankheit bestand in Kräfteverfall nach einem Schtagan-
fall -nnü in krebsartigen Wncheinngen in der Bnuckifell»
Die heutige Nnmmer umfaßt drei Blätter, zujammen 14 Seite«.