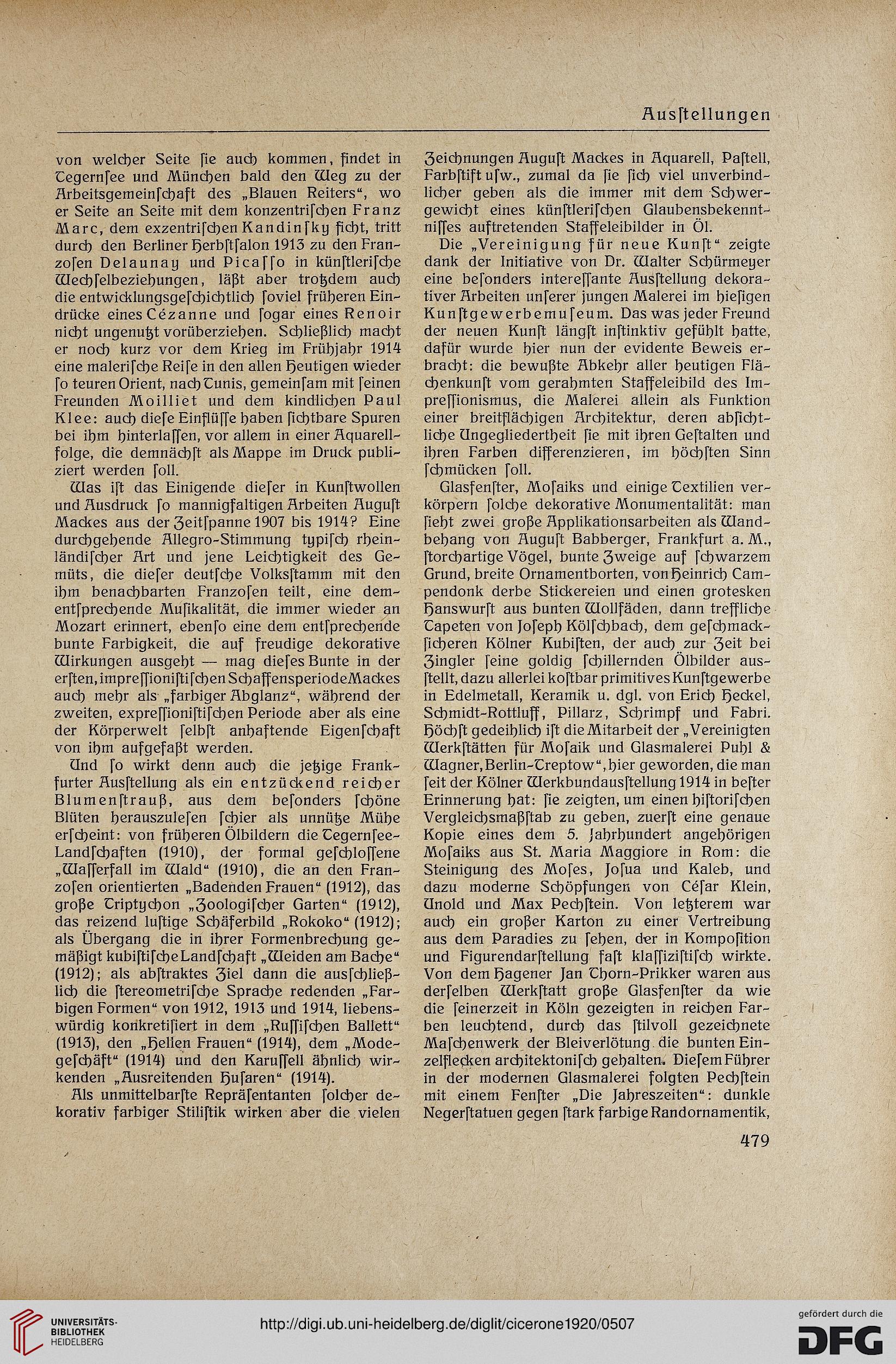Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 12.1920
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27227#0507
DOI Heft:
Heft 12
DOI Artikel:Ausstellungen
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27227#0507
Anstellungen
von welcher Seite [ie auch kommen, findet in
Cegernfee und München bald den Kleg zu der
Ärbeitsgemeinfchaft des „Blauen Reiters“, wo
er Seite an Seite mit dem konzentrifchen Franz
Marc, dem exzentrifchen Kandinfky ficht, tritt
durch den Berliner Fjerbftfalon 1913 zu den Fran-
zofen Delaunay und Picaffo in künftlerifcße
Klecßfelbezießungen, läßt aber troljdem auch
die entwicklungsgefcßicßtlich foviel früheren Ein-
drücke eines Cezanne und fogar eines Renoir
nicht ungenutzt vorüberziehen. Schließlich macht
er noch kurz vor dem Krieg im Frühjahr 1914
eine malerifche Reife in den allen Fjeutigen wieder
fo teuren Orient, nacßCunis, gemeinfam mit feinen
Freunden Moilliet und dem kindlichen Paul
Klee: auch diefe Einflüffe haben fichtbare Spuren
bei ihm ßinterlaffen, vor allein in einer Aquarell-
folge, die demnächft als Mappe im Druck publi-
ziert werden foll.
Klas ift das Einigende diefer in Kunftwollen
und Ausdruck fo mannigfaltigen Arbeiten Auguft
Mackes aus der 3eitfpanne 1907 bis 1914? Eine
durchgehende Allegro-Stimmung tgpifch rßein-
ländifcher Art und jene Leichtigkeit des Ge-
müts, die diefer deutfche Volksftamm mit den
ihm benachbarten Franzofen teilt, eine dem-
entfprechende Mufikalität, die immer wieder an
Mozart erinnert, ebenfo eine dem entfprechende
bunte Farbigkeit, die auf freudige dekorative
Klirkungen ausgeht — mag diefes Bunte in der
erften.impreffioniftifchenSchaffensperiodeMackes
auch mehr als „farbiger Abglanz“, während der
zweiten, expreffioniftifchen Periode aber als eine
der Körperweit feibft anhaftende Eigenfcßaft
von ihm aufgefaßt werden.
Und fo wirkt denn auch die jetzige Frank-
furter Ausftellung als ein entzückend reicher
Blumenftrauß, aus dem befonders fcßöne
Blüten ßerauszulefen fcßier als unnütze Mühe
erfcheint: von früheren Ölbildern die Uegernfee-
Landfchaften (1910), der formal gefchloffene
„Klafferfall im Klald“ (1910), die an den Fran-
zofen orientierten „Badenden Frauen“ (1912), das
große üriptycßon „3oologifcßer Garten“ (1912),
das reizend luftige Schäferbild „Rokoko“ (1912);
als Übergang die in ihrer Formenbrechung ge-
mäßigt kubiftifcheLandfchaft „Kleiden am Bache“
(1912); als abftraktes 3iel dann die ausfcßließ-
lid) die ftereometrifche Sprache redenden „Far-
bigen Formen“ von 1912, 1913 und 1914, liebens-
würdig konkretifiert in dem „Ruffifcßen Ballett“
(1913), den „Fällen Frauen“ (1914), dem „Mode-
gefchäft“ (1914) und den Karuffell ähnlich wir-
kenden „Äusreitenden Qufaren“ (1914).
Als unmittelbarfte Repräfentanten foldber de-
korativ farbiger Stiliftik wirken aber die vielen
3eid)nungen Auguft Mackes in Aquarell, Paftell,
Farbftift ufw., zumal da fie fich viel unverbind-
licher geben als die immer mit dem Schwer-
gewicht eines künftlerifchen Glaubensbekennt-
nis auftretenden Staffeleibilder in Öl.
Die „Vereinigung für neue Kunft“ zeigte
dank der Initiative von Dr. (Halter Schürmeyer
eine befonders intereffante Ausftellung dekora-
tiver Arbeiten unferer jungen Malerei im ßiefigen
Kunftgewerbemufeum. Das was jeder Freund
der neuen Kunp längft inftinktiv gefühlt hatte,
dafür wurde hier nun der evidente Beweis er-
bracht: die bewußte Abkehr aller heutigen Flä-
chenkunft vom gerahmten Staffeleibild des Im-
preffionismus, die Malerei allein als Funktion
einer breitflächigen Architektur, deren abpeßt-
lid)e Ungegliedertßeit fie mit ihren Geftalten und
ihren Farben differenzieren, im höchften Sinn
fchmücken foll.
Glasfenfter, Mofaiks und einige Textilien ver-
körpern folche dekorative Monumentalität: man
fieht zwei große Applikationsarbeiten als Kland-
beßang von Auguft Babberger, Frankfurt a. M.,
ftoreßartige Vögel, bunte 3weige auf feßwarzem
Grund, breite Ornamentborten, von Heinrich Cam-
pendonk derbe Stickereien und einen grotesken
Fjanswurft aus bunten Klollfäden, dann treffliche
Capeten von Jofeph Kölfcßbach, dem gefcßmack-
fießeren Kölner Kubiften, der auch zur 3eit bei
3ingler feine goldig fcßiHernden Ölbilder aus-
ftellt, dazu allerlei koftbar primitivesKunftgewerbe
in Edelmetall, Keramik u. dgl. von Erich Fjeckel,
Schmidt-Rottluff, Pillarz, Scßrimpf und Fabri.
Fjöcßft gedeißlicß ift die Mitarbeit der „Vereinigten
Klerkftätten für Mofaik und Glasmalerei Puhl &
<Hagner,Berlin-Creptow“,l)ier geworden, die man
feit der Kölner Klerkbundausftellung 1914 in befter
Erinnerung hat: fie zeigten, um einen hiftorifeßen
Vergleicßsmaßftab zu geben, zuerft eine genaue
Kopie eines dem 5. Jahrhundert angeßörigen
Mofaiks aus St. Maria Maggiore in Rom: die
Steinigung des Mofes, Jofua und Kaleb, und
dazu moderne Schöpfungen von Cefar Klein,
Unold und Max Pecßftein. Von letzterem War
auch ein großer Karton zu einer Vertreibung
aus dem Paradies zu feßen, d^er in Kompoption
und Figurendarftellung faft klaffiziftifcß wirkte.
Von dem FJagener jan Cßorn-Prikker waren aus
derfelben Klerkftatt große Glasfenfter da wie
die feinerzeit in Köln gezeigten in reichen Far-
ben leuchtend, durch das ftilvoll gezeichnete
Mafcßenwerk der Bleiverlötung die bunten Ein-
zelßecken architektonifcß gehalten, DiefemFüßrer
in der modernen Glasmalerei folgten Pecßftein
mit einem Fenfter „Die Jahreszeiten“: dunkle
Negerftatuen gegen ftark farbige Randornamentik,
479
von welcher Seite [ie auch kommen, findet in
Cegernfee und München bald den Kleg zu der
Ärbeitsgemeinfchaft des „Blauen Reiters“, wo
er Seite an Seite mit dem konzentrifchen Franz
Marc, dem exzentrifchen Kandinfky ficht, tritt
durch den Berliner Fjerbftfalon 1913 zu den Fran-
zofen Delaunay und Picaffo in künftlerifcße
Klecßfelbezießungen, läßt aber troljdem auch
die entwicklungsgefcßicßtlich foviel früheren Ein-
drücke eines Cezanne und fogar eines Renoir
nicht ungenutzt vorüberziehen. Schließlich macht
er noch kurz vor dem Krieg im Frühjahr 1914
eine malerifche Reife in den allen Fjeutigen wieder
fo teuren Orient, nacßCunis, gemeinfam mit feinen
Freunden Moilliet und dem kindlichen Paul
Klee: auch diefe Einflüffe haben fichtbare Spuren
bei ihm ßinterlaffen, vor allein in einer Aquarell-
folge, die demnächft als Mappe im Druck publi-
ziert werden foll.
Klas ift das Einigende diefer in Kunftwollen
und Ausdruck fo mannigfaltigen Arbeiten Auguft
Mackes aus der 3eitfpanne 1907 bis 1914? Eine
durchgehende Allegro-Stimmung tgpifch rßein-
ländifcher Art und jene Leichtigkeit des Ge-
müts, die diefer deutfche Volksftamm mit den
ihm benachbarten Franzofen teilt, eine dem-
entfprechende Mufikalität, die immer wieder an
Mozart erinnert, ebenfo eine dem entfprechende
bunte Farbigkeit, die auf freudige dekorative
Klirkungen ausgeht — mag diefes Bunte in der
erften.impreffioniftifchenSchaffensperiodeMackes
auch mehr als „farbiger Abglanz“, während der
zweiten, expreffioniftifchen Periode aber als eine
der Körperweit feibft anhaftende Eigenfcßaft
von ihm aufgefaßt werden.
Und fo wirkt denn auch die jetzige Frank-
furter Ausftellung als ein entzückend reicher
Blumenftrauß, aus dem befonders fcßöne
Blüten ßerauszulefen fcßier als unnütze Mühe
erfcheint: von früheren Ölbildern die Uegernfee-
Landfchaften (1910), der formal gefchloffene
„Klafferfall im Klald“ (1910), die an den Fran-
zofen orientierten „Badenden Frauen“ (1912), das
große üriptycßon „3oologifcßer Garten“ (1912),
das reizend luftige Schäferbild „Rokoko“ (1912);
als Übergang die in ihrer Formenbrechung ge-
mäßigt kubiftifcheLandfchaft „Kleiden am Bache“
(1912); als abftraktes 3iel dann die ausfcßließ-
lid) die ftereometrifche Sprache redenden „Far-
bigen Formen“ von 1912, 1913 und 1914, liebens-
würdig konkretifiert in dem „Ruffifcßen Ballett“
(1913), den „Fällen Frauen“ (1914), dem „Mode-
gefchäft“ (1914) und den Karuffell ähnlich wir-
kenden „Äusreitenden Qufaren“ (1914).
Als unmittelbarfte Repräfentanten foldber de-
korativ farbiger Stiliftik wirken aber die vielen
3eid)nungen Auguft Mackes in Aquarell, Paftell,
Farbftift ufw., zumal da fie fich viel unverbind-
licher geben als die immer mit dem Schwer-
gewicht eines künftlerifchen Glaubensbekennt-
nis auftretenden Staffeleibilder in Öl.
Die „Vereinigung für neue Kunft“ zeigte
dank der Initiative von Dr. (Halter Schürmeyer
eine befonders intereffante Ausftellung dekora-
tiver Arbeiten unferer jungen Malerei im ßiefigen
Kunftgewerbemufeum. Das was jeder Freund
der neuen Kunp längft inftinktiv gefühlt hatte,
dafür wurde hier nun der evidente Beweis er-
bracht: die bewußte Abkehr aller heutigen Flä-
chenkunft vom gerahmten Staffeleibild des Im-
preffionismus, die Malerei allein als Funktion
einer breitflächigen Architektur, deren abpeßt-
lid)e Ungegliedertßeit fie mit ihren Geftalten und
ihren Farben differenzieren, im höchften Sinn
fchmücken foll.
Glasfenfter, Mofaiks und einige Textilien ver-
körpern folche dekorative Monumentalität: man
fieht zwei große Applikationsarbeiten als Kland-
beßang von Auguft Babberger, Frankfurt a. M.,
ftoreßartige Vögel, bunte 3weige auf feßwarzem
Grund, breite Ornamentborten, von Heinrich Cam-
pendonk derbe Stickereien und einen grotesken
Fjanswurft aus bunten Klollfäden, dann treffliche
Capeten von Jofeph Kölfcßbach, dem gefcßmack-
fießeren Kölner Kubiften, der auch zur 3eit bei
3ingler feine goldig fcßiHernden Ölbilder aus-
ftellt, dazu allerlei koftbar primitivesKunftgewerbe
in Edelmetall, Keramik u. dgl. von Erich Fjeckel,
Schmidt-Rottluff, Pillarz, Scßrimpf und Fabri.
Fjöcßft gedeißlicß ift die Mitarbeit der „Vereinigten
Klerkftätten für Mofaik und Glasmalerei Puhl &
<Hagner,Berlin-Creptow“,l)ier geworden, die man
feit der Kölner Klerkbundausftellung 1914 in befter
Erinnerung hat: fie zeigten, um einen hiftorifeßen
Vergleicßsmaßftab zu geben, zuerft eine genaue
Kopie eines dem 5. Jahrhundert angeßörigen
Mofaiks aus St. Maria Maggiore in Rom: die
Steinigung des Mofes, Jofua und Kaleb, und
dazu moderne Schöpfungen von Cefar Klein,
Unold und Max Pecßftein. Von letzterem War
auch ein großer Karton zu einer Vertreibung
aus dem Paradies zu feßen, d^er in Kompoption
und Figurendarftellung faft klaffiziftifcß wirkte.
Von dem FJagener jan Cßorn-Prikker waren aus
derfelben Klerkftatt große Glasfenfter da wie
die feinerzeit in Köln gezeigten in reichen Far-
ben leuchtend, durch das ftilvoll gezeichnete
Mafcßenwerk der Bleiverlötung die bunten Ein-
zelßecken architektonifcß gehalten, DiefemFüßrer
in der modernen Glasmalerei folgten Pecßftein
mit einem Fenfter „Die Jahreszeiten“: dunkle
Negerftatuen gegen ftark farbige Randornamentik,
479