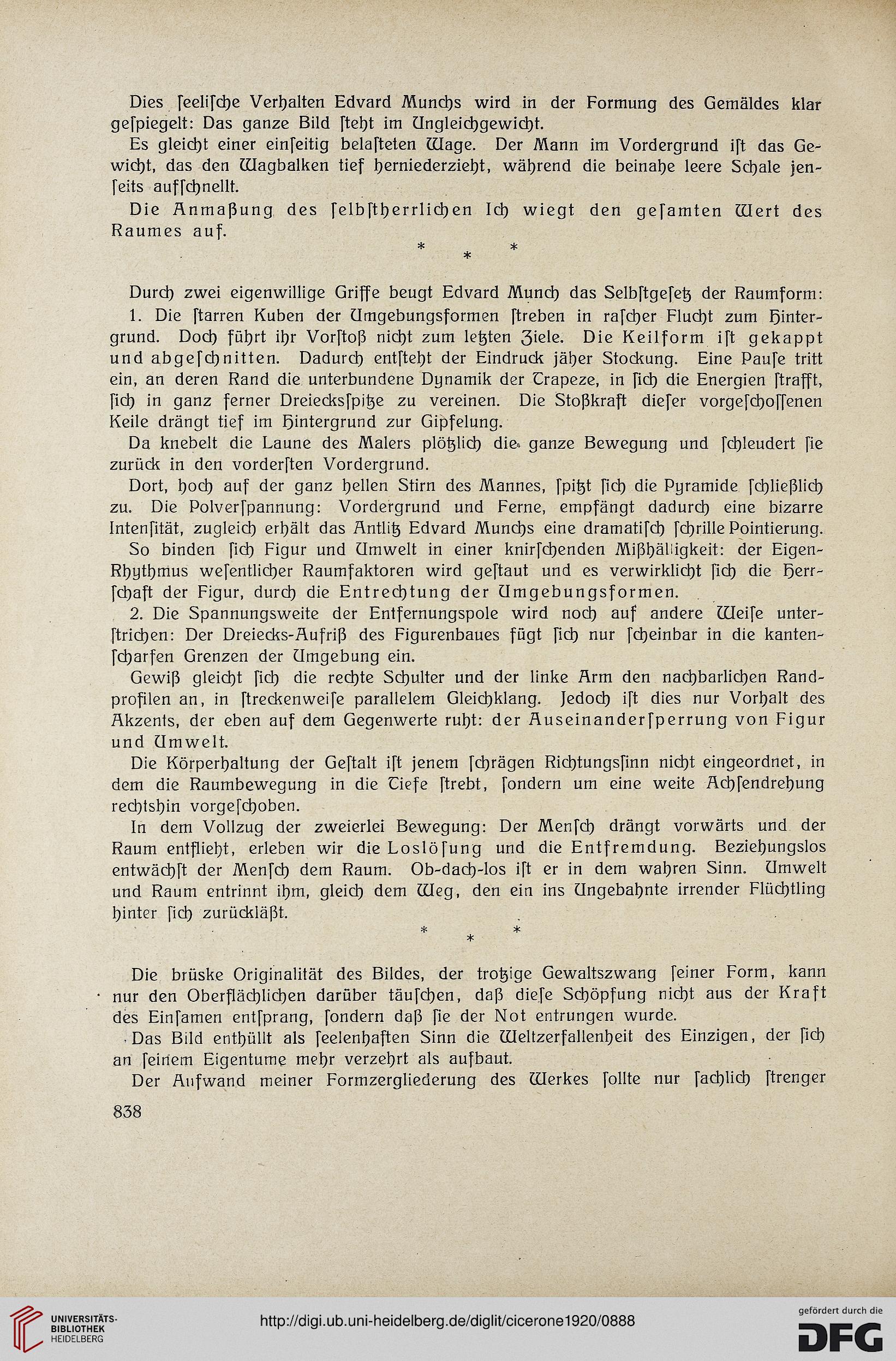Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 12.1920
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27227#0888
DOI Heft:
Heft 23
DOI Artikel:Fraenger, Wilhelm: Zu einem Selbstbildnis von Edvard Munch
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27227#0888
Dies feelifcße Verhalten Edvard Munchs wird in der Formung des Gemäldes klar
gefpiegelt: Das ganze Bild fteßt im Ungleichgewicht.
Es gleicht einer einfeitig belafteten Klage. Der Mann im Vordergrund ift das Ge-
wicht, das den Klagbalken tief herniederzieht, während die beinahe leere Schale jen-
feits auffchnellt.
Die Anmaßung des felbftßerrlicßen Ich wiegt den gefamten Klert des
Raumes auf.
* *
*
Durch zwei eigenwillige Griffe beugt Edvard Munch das Selbftgefeß der Raumform:
1. Die ftarren Kuben der Umgebungsformen ftreben in rafcher Flucht zum Hinter-
grund. Doch führt ihr Vorftoß nicht zum leßten Die Keilform ift gekappt
und abgefchnitten. Dadurch entfteht der Eindruck jäher Stockung. Eine Paufe tritt
ein, an deren Rand die unterbundene Dynamik der Crapeze, in fid) die Energien ftrafft,
fiel) in ganz ferner Dreiecksfpiße zu vereinen. Die Stoßkraft diefer vorgefeßoffenen
Keile drängt tief im Hintergrund zur Gipfelung.
Da knebelt die Laune des Malers plößlicß die-, ganze Bewegung und fcßleudert fie
zurück in den vorderften Vordergrund.
Dort, hoch auf der ganz hellen Stirn des Mannes, fpißt [ich die Pyramide fcßließlicß
zu. Die Polverfpannung: Vordergrund und Ferne, empfängt dadurch eine bizarre
Intenfität, zugleich erhält das Antliß Edvard Muncßs eine dramatifcß [chrille Pointierung.
So binden [ich Figur und Umwelt in einer knirfchenden Mißßäliigkeit: der Eigen-
Rhythmus wefentlicßer Raumfaktoren wird geftaut und es verwirklicht [ich die Herr-
fchaft der Figur, durch die Entrechtung der Umgebungsformen.
2. Die Spannungsweite der Entfernungspole wird noch auf andere Kleife unter-
[trichen: Der Dreiecks-Aufriß des Figurenbaues fügt fiel) nur feßeinbar in die kanten-
feßarfen Grenzen der Umgebung ein.
Gewiß gleicht fieß die rechte Schulter und der linke Arm den nachbarlichen Rand-
profilen an, in ftreckenweife parallelem Gleicßklang. Jedoch ift dies nur Vorhalt des
Akzents, der eben auf dem Gegenwerte rußt: der Auseinanderfperrung von Figur
und Umwelt.
Die Körperhaltung der Geftalt ift jenem feßrägen Ricßtungsfinn nicht eingeordnet, in
dem die Raumbewegung in die Ciefe ftrebt, fondern um eine weite Acßfendreßung
rechtshin vorgefeßoben.
In dem Vollzug der zweierlei Bewegung: Der Menfcß drängt vorwärts und der
Raum entßießt, erleben wir die Loslöfung und die Entfremdung. Beziehungslos
entwäcßft der Menfcß dem Raum. Ob-dacß-los ift er in dem wahren Sinn. Umwelt
und Raum entrinnt ißm, gleich dem Kleg, den ein ins Ungebahnte irrender Flüchtling
hinter fieß zurückläßt.
* *
*
Die brüske Originalität des Bildes, der trotzige Gewaltszwang feiner Form, kann
nur den Oberßäcßlicßen darüber täufeßen, daß diefe Schöpfung nicht aus der Kraft
des Einfamen entfprang, fondern daß ße der Not entrungen wurde.
Das Bild entßüllt als feelenßaften Sinn die Kleltzerfallenßeit des Einzigen, der fieß
an feinem Eigentume meßr verzehrt als aufbaut.
Der Aufwand meiner Formzergliederung des Klerkes füllte nur fachlich ftrenger
838
gefpiegelt: Das ganze Bild fteßt im Ungleichgewicht.
Es gleicht einer einfeitig belafteten Klage. Der Mann im Vordergrund ift das Ge-
wicht, das den Klagbalken tief herniederzieht, während die beinahe leere Schale jen-
feits auffchnellt.
Die Anmaßung des felbftßerrlicßen Ich wiegt den gefamten Klert des
Raumes auf.
* *
*
Durch zwei eigenwillige Griffe beugt Edvard Munch das Selbftgefeß der Raumform:
1. Die ftarren Kuben der Umgebungsformen ftreben in rafcher Flucht zum Hinter-
grund. Doch führt ihr Vorftoß nicht zum leßten Die Keilform ift gekappt
und abgefchnitten. Dadurch entfteht der Eindruck jäher Stockung. Eine Paufe tritt
ein, an deren Rand die unterbundene Dynamik der Crapeze, in fid) die Energien ftrafft,
fiel) in ganz ferner Dreiecksfpiße zu vereinen. Die Stoßkraft diefer vorgefeßoffenen
Keile drängt tief im Hintergrund zur Gipfelung.
Da knebelt die Laune des Malers plößlicß die-, ganze Bewegung und fcßleudert fie
zurück in den vorderften Vordergrund.
Dort, hoch auf der ganz hellen Stirn des Mannes, fpißt [ich die Pyramide fcßließlicß
zu. Die Polverfpannung: Vordergrund und Ferne, empfängt dadurch eine bizarre
Intenfität, zugleich erhält das Antliß Edvard Muncßs eine dramatifcß [chrille Pointierung.
So binden [ich Figur und Umwelt in einer knirfchenden Mißßäliigkeit: der Eigen-
Rhythmus wefentlicßer Raumfaktoren wird geftaut und es verwirklicht [ich die Herr-
fchaft der Figur, durch die Entrechtung der Umgebungsformen.
2. Die Spannungsweite der Entfernungspole wird noch auf andere Kleife unter-
[trichen: Der Dreiecks-Aufriß des Figurenbaues fügt fiel) nur feßeinbar in die kanten-
feßarfen Grenzen der Umgebung ein.
Gewiß gleicht fieß die rechte Schulter und der linke Arm den nachbarlichen Rand-
profilen an, in ftreckenweife parallelem Gleicßklang. Jedoch ift dies nur Vorhalt des
Akzents, der eben auf dem Gegenwerte rußt: der Auseinanderfperrung von Figur
und Umwelt.
Die Körperhaltung der Geftalt ift jenem feßrägen Ricßtungsfinn nicht eingeordnet, in
dem die Raumbewegung in die Ciefe ftrebt, fondern um eine weite Acßfendreßung
rechtshin vorgefeßoben.
In dem Vollzug der zweierlei Bewegung: Der Menfcß drängt vorwärts und der
Raum entßießt, erleben wir die Loslöfung und die Entfremdung. Beziehungslos
entwäcßft der Menfcß dem Raum. Ob-dacß-los ift er in dem wahren Sinn. Umwelt
und Raum entrinnt ißm, gleich dem Kleg, den ein ins Ungebahnte irrender Flüchtling
hinter fieß zurückläßt.
* *
*
Die brüske Originalität des Bildes, der trotzige Gewaltszwang feiner Form, kann
nur den Oberßäcßlicßen darüber täufeßen, daß diefe Schöpfung nicht aus der Kraft
des Einfamen entfprang, fondern daß ße der Not entrungen wurde.
Das Bild entßüllt als feelenßaften Sinn die Kleltzerfallenßeit des Einzigen, der fieß
an feinem Eigentume meßr verzehrt als aufbaut.
Der Aufwand meiner Formzergliederung des Klerkes füllte nur fachlich ftrenger
838