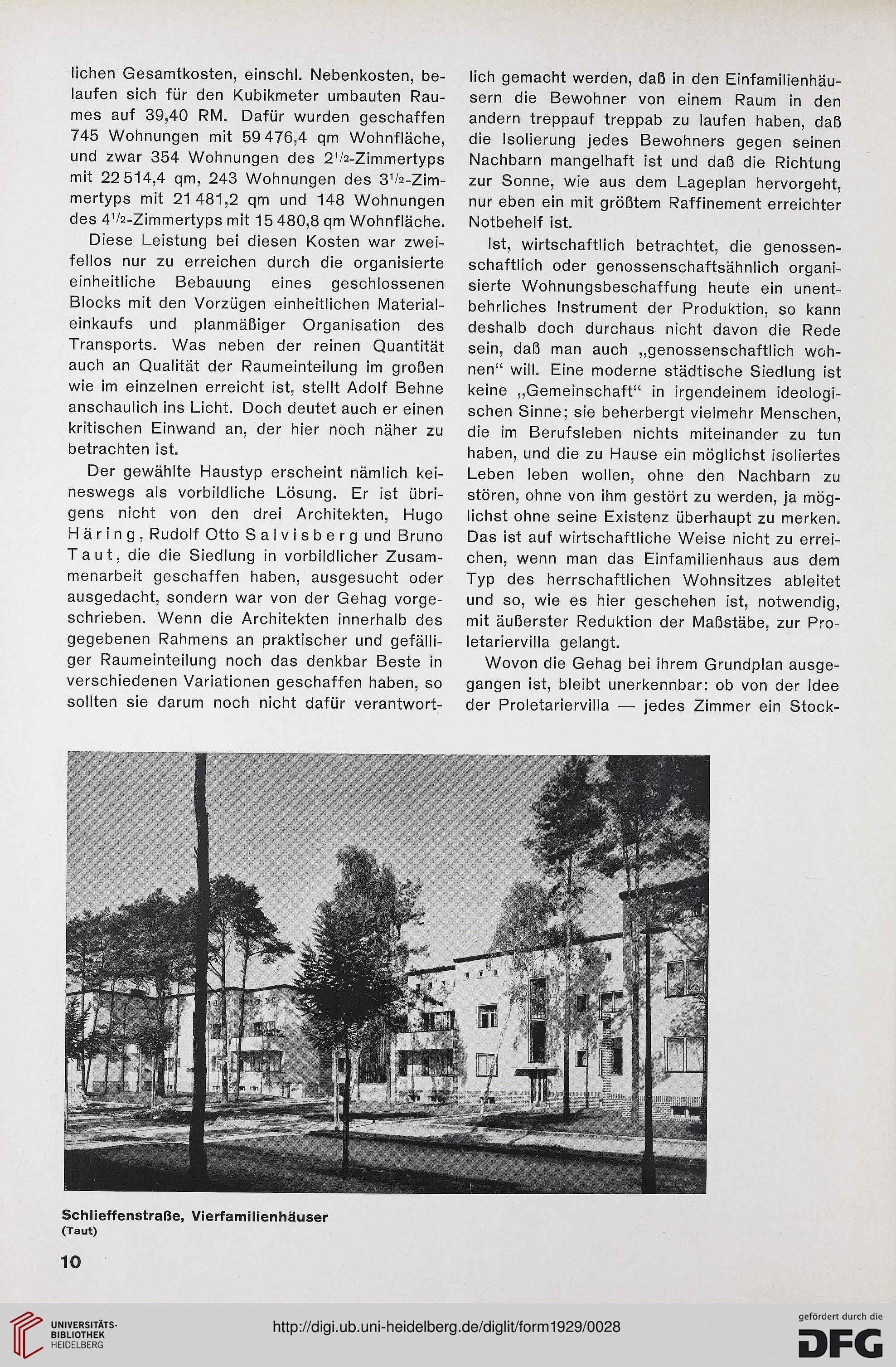Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 4.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0028
DOI Artikel:
Schwab, Alexander: Zur Gehagsiedlung Zehlendorf: Grundsätzliches und Wirtschaftliches
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0028
liehen Gesamtkosten, einschl. Nebenkosten, be-
laufen sich für den Kubikmeter umbauten Rau-
mes auf 39,40 RM. Dafür wurden geschaffen
745 Wohnungen mit 59 476,4 qm Wohnfläche,
und zwar 354 Wohnungen des 21/2-Zimmertyps
mit 22 514,4 qm, 243 Wohnungen des 31/2-Zim-
mertyps mit 21 481,2 qm und 148 Wohnungen
des 41/2-Zimmertyps mit 15 480,8 qm Wohnfläche.
Diese Leistung bei diesen Kosten war zwei-
fellos nur zu erreichen durch die organisierte
einheitliche Bebauung eines geschlossenen
Blocks mit den Vorzügen einheitlichen Material-
einkaufs und planmäßiger Organisation des
Transports. Was neben der reinen Quantität
auch an Qualität der Raumeinteilung im großen
wie im einzelnen erreicht ist, stellt Adolf Behne
anschaulich ins Licht. Doch deutet auch er einen
kritischen Einwand an, der hier noch näher zu
betrachten ist.
Der gewählte Haustyp erscheint nämlich kei-
neswegs als vorbildliche Lösung. Er ist übri-
gens nicht von den drei Architekten, Hugo
H ä r i n g , Rudolf Otto Salvisberg und Bruno
Taut, die die Siedlung in vorbildlicher Zusam-
menarbeit geschaffen haben, ausgesucht oder
ausgedacht, sondern war von der Gehag vorge-
schrieben. Wenn die Architekten innerhalb des
gegebenen Rahmens an praktischer und gefälli-
ger Raumeinteilung noch das denkbar Beste in
verschiedenen Variationen geschaffen haben, so
sollten sie darum noch nicht dafür verantwort-
lich gemacht werden, daß in den Einfamilienhäu-
sern die Bewohner von einem Raum in den
andern treppauf treppab zu laufen haben, daß
die Isolierung jedes Bewohners gegen seinen
Nachbarn mangelhaft ist und daß die Richtung
zur Sonne, wie aus dem Lageplan hervorgeht,
nur eben ein mit größtem Raffinement erreichter
Notbehelf ist.
Ist, wirtschaftlich betrachtet, die genossen-
schaftlich oder genossenschaftsähnlich organi-
sierte Wohnungsbeschaffung heute ein unent-
behrliches Instrument der Produktion, so kann
deshalb doch durchaus nicht davon die Rede
sein, daß man auch „genossenschaftlich woh-
nen" will. Eine moderne städtische Siedlung ist
keine „Gemeinschaft" in irgendeinem ideologi-
schen Sinne; sie beherbergt vielmehr Menschen,
die im Berufsleben nichts miteinander zu tun
haben, und die zu Hause ein möglichst isoliertes
Leben leben wollen, ohne den Nachbarn zu
stören, ohne von ihm gestört zu werden, ja mög-
lichst ohne seine Existenz überhaupt zu merken.
Das ist auf wirtschaftliche Weise nicht zu errei-
chen, wenn man das Einfamilienhaus aus dem
Typ des herrschaftlichen Wohnsitzes ableitet
und so, wie es hier geschehen ist, notwendig,
mit äußerster Reduktion der Maßstäbe, zur Pro-
letariervilla gelangt.
Wovon die Gehag bei ihrem Grundplan ausge-
gangen ist, bleibt unerkennbar: ob von der Idee
der Proletariervilla — jedes Zimmer ein Stock-
Schlieffenstraße,
(Taut)
10
Vierfamilienhäuser
laufen sich für den Kubikmeter umbauten Rau-
mes auf 39,40 RM. Dafür wurden geschaffen
745 Wohnungen mit 59 476,4 qm Wohnfläche,
und zwar 354 Wohnungen des 21/2-Zimmertyps
mit 22 514,4 qm, 243 Wohnungen des 31/2-Zim-
mertyps mit 21 481,2 qm und 148 Wohnungen
des 41/2-Zimmertyps mit 15 480,8 qm Wohnfläche.
Diese Leistung bei diesen Kosten war zwei-
fellos nur zu erreichen durch die organisierte
einheitliche Bebauung eines geschlossenen
Blocks mit den Vorzügen einheitlichen Material-
einkaufs und planmäßiger Organisation des
Transports. Was neben der reinen Quantität
auch an Qualität der Raumeinteilung im großen
wie im einzelnen erreicht ist, stellt Adolf Behne
anschaulich ins Licht. Doch deutet auch er einen
kritischen Einwand an, der hier noch näher zu
betrachten ist.
Der gewählte Haustyp erscheint nämlich kei-
neswegs als vorbildliche Lösung. Er ist übri-
gens nicht von den drei Architekten, Hugo
H ä r i n g , Rudolf Otto Salvisberg und Bruno
Taut, die die Siedlung in vorbildlicher Zusam-
menarbeit geschaffen haben, ausgesucht oder
ausgedacht, sondern war von der Gehag vorge-
schrieben. Wenn die Architekten innerhalb des
gegebenen Rahmens an praktischer und gefälli-
ger Raumeinteilung noch das denkbar Beste in
verschiedenen Variationen geschaffen haben, so
sollten sie darum noch nicht dafür verantwort-
lich gemacht werden, daß in den Einfamilienhäu-
sern die Bewohner von einem Raum in den
andern treppauf treppab zu laufen haben, daß
die Isolierung jedes Bewohners gegen seinen
Nachbarn mangelhaft ist und daß die Richtung
zur Sonne, wie aus dem Lageplan hervorgeht,
nur eben ein mit größtem Raffinement erreichter
Notbehelf ist.
Ist, wirtschaftlich betrachtet, die genossen-
schaftlich oder genossenschaftsähnlich organi-
sierte Wohnungsbeschaffung heute ein unent-
behrliches Instrument der Produktion, so kann
deshalb doch durchaus nicht davon die Rede
sein, daß man auch „genossenschaftlich woh-
nen" will. Eine moderne städtische Siedlung ist
keine „Gemeinschaft" in irgendeinem ideologi-
schen Sinne; sie beherbergt vielmehr Menschen,
die im Berufsleben nichts miteinander zu tun
haben, und die zu Hause ein möglichst isoliertes
Leben leben wollen, ohne den Nachbarn zu
stören, ohne von ihm gestört zu werden, ja mög-
lichst ohne seine Existenz überhaupt zu merken.
Das ist auf wirtschaftliche Weise nicht zu errei-
chen, wenn man das Einfamilienhaus aus dem
Typ des herrschaftlichen Wohnsitzes ableitet
und so, wie es hier geschehen ist, notwendig,
mit äußerster Reduktion der Maßstäbe, zur Pro-
letariervilla gelangt.
Wovon die Gehag bei ihrem Grundplan ausge-
gangen ist, bleibt unerkennbar: ob von der Idee
der Proletariervilla — jedes Zimmer ein Stock-
Schlieffenstraße,
(Taut)
10
Vierfamilienhäuser