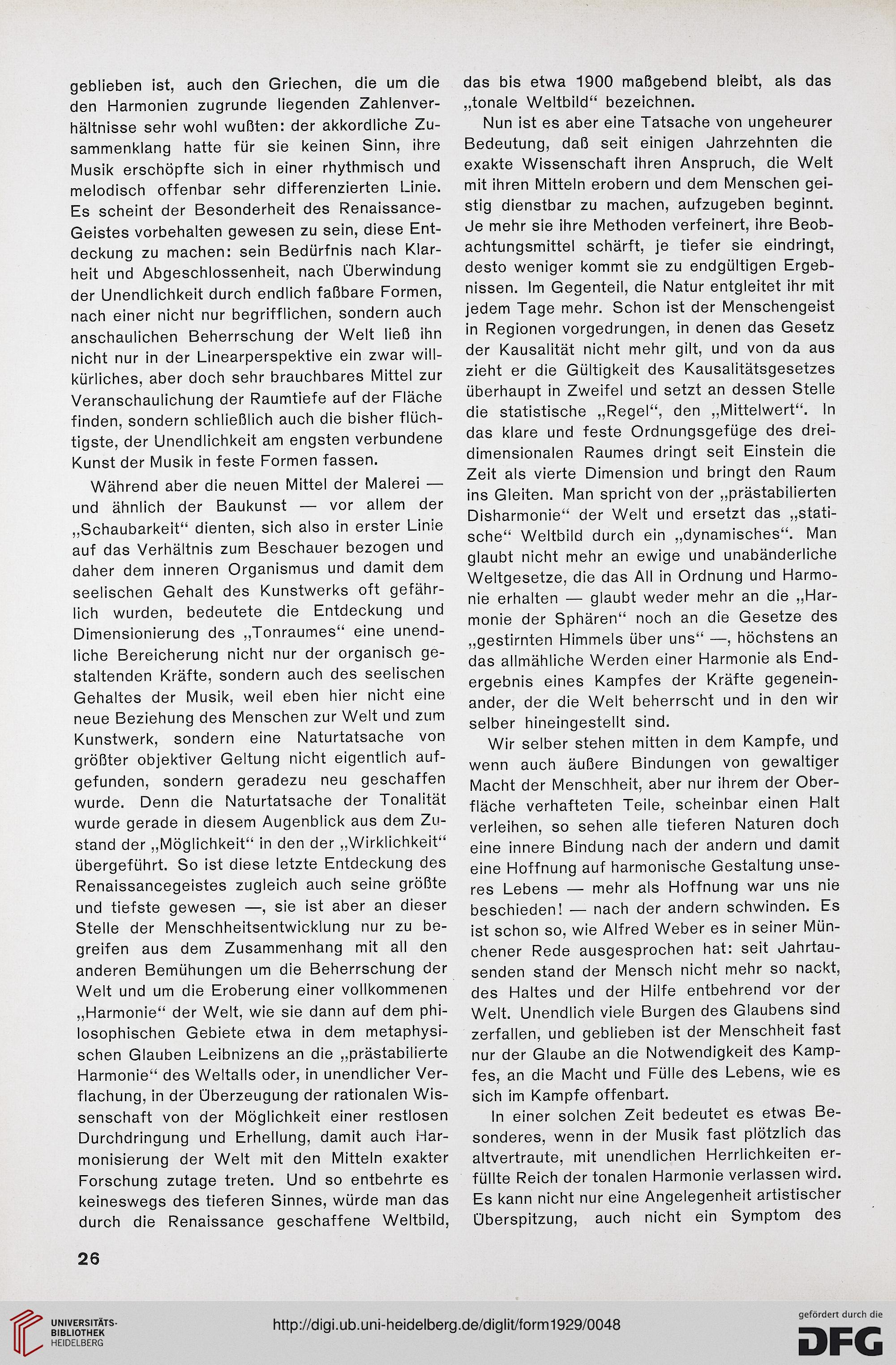Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 4.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0048
DOI Artikel:
Riezler, Walter: Die atonale Welt
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0048
geblieben ist, auch den Griechen, die um die
den Harmonien zugrunde liegenden Zahlenver-
hältnisse sehr wohl wußten: der akkordliche Zu-
sammenklang hatte für sie keinen Sinn, ihre
Musik erschöpfte sich in einer rhythmisch und
melodisch offenbar sehr differenzierten Linie.
Es scheint der Besonderheit des Renaissance-
Geistes vorbehalten gewesen zu sein, diese Ent-
deckung zu machen: sein Bedürfnis nach Klar-
heit und Abgeschlossenheit, nach Überwindung
der Unendlichkeit durch endlich faßbare Formen,
nach einer nicht nur begrifflichen, sondern auch
anschaulichen Beherrschung der Welt ließ ihn
nicht nur in der Linearperspektive ein zwar will-
kürliches, aber doch sehr brauchbares Mittel zur
Veranschaulichung der Raumtiefe auf der Fläche
finden, sondern schließlich auch die bisher flüch-
tigste, der Unendlichkeit am engsten verbundene
Kunst der Musik in feste Formen fassen.
Während aber die neuen Mittel der Malerei —
und ähnlich der Baukunst — vor allem der
,,Schaubarkeit" dienten, sich also in erster Linie
auf das Verhältnis zum Beschauer bezogen und
daher dem inneren Organismus und damit dem
seelischen Gehalt des Kunstwerks oft gefähr-
lich wurden, bedeutete die Entdeckung und
Dimensionierung des „Tonraumes" eine unend-
liche Bereicherung nicht nur der organisch ge-
staltenden Kräfte, sondern auch des seelischen
Gehaltes der Musik, weil eben hier nicht eine
neue Beziehung des Menschen zur Welt und zum
Kunstwerk, sondern eine Naturtatsache von
größter objektiver Geltung nicht eigentlich auf-
gefunden, sondern geradezu neu geschaffen
wurde. Denn die Naturtatsache der Tonalität
wurde gerade in diesem Augenblick aus dem Zu-
stand der „Möglichkeit" in den der „Wirklichkeit"
übergeführt. So ist diese letzte Entdeckung des
Renaissancegeistes zugleich auch seine größte
und tiefste gewesen —, sie ist aber an dieser
Stelle der Menschheitsentwicklung nur zu be-
greifen aus dem Zusammenhang mit all den
anderen Bemühungen um die Beherrschung der
Welt und um die Eroberung einer vollkommenen
„Harmonie" der Welt, wie sie dann auf dem phi-
losophischen Gebiete etwa in dem metaphysi-
schen Glauben Leibnizens an die „prästabilierte
Harmonie" des Weltalls oder, in unendlicher Ver-
flachung, in der Überzeugung der rationalen Wis-
senschaft von der Möglichkeit einer restlosen
Durchdringung und Erhellung, damit auch Har-
monisierung der Welt mit den Mitteln exakter
Forschung zutage treten. Und so entbehrte es
keineswegs des tieferen Sinnes, würde man das
durch die Renaissance geschaffene Weltbild,
26
das bis etwa 1900 maßgebend bleibt, als das
„tonale Weltbild" bezeichnen.
Nun ist es aber eine Tatsache von ungeheurer
Bedeutung, daß seit einigen Jahrzehnten die
exakte Wissenschaft ihren Anspruch, die Welt
mit ihren Mitteln erobern und dem Menschen gei-
stig dienstbar zu machen, aufzugeben beginnt.
Je mehr sie ihre Methoden verfeinert, ihre Beob-
achtungsmittel schärft, je tiefer sie eindringt,
desto weniger kommt sie zu endgültigen Ergeb-
nissen. Im Gegenteil, die Natur entgleitet ihr mit
jedem Tage mehr. Schon ist der Menschengeist
in Regionen vorgedrungen, in denen das Gesetz
der Kausalität nicht mehr gilt, und von da aus
zieht er die Gültigkeit des Kausalitätsgesetzes
überhaupt in Zweifel und setzt an dessen Stelle
die statistische „Regel", den „Mittelwert". In
das klare und feste Ordnungsgefüge des drei-
dimensionalen Raumes dringt seit Einstein die
Zeit als vierte Dimension und bringt den Raum
ins Gleiten. Man spricht von der „prästabilierten
Disharmonie" der Welt und ersetzt das „stati-
sche" Weltbild durch ein „dynamisches". Man
glaubt nicht mehr an ewige und unabänderliche
Weltgesetze, die das All in Ordnung und Harmo-
nie erhalten — glaubt weder mehr an die „Har-
monie der Sphären" noch an die Gesetze des
„gestirnten Himmels über uns" —, höchstens an
das allmähliche Werden einer Harmonie als End-
ergebnis eines Kampfes der Kräfte gegenein-
ander, der die Welt beherrscht und in den wir
selber hineingestellt sind.
Wir selber stehen mitten in dem Kampfe, und
wenn auch äußere Bindungen von gewaltiger
Macht der Menschheit, aber nur ihrem der Ober-
fläche verhafteten Teile, scheinbar einen Halt
verleihen, so sehen alle tieferen Naturen doch
eine innere Bindung nach der andern und damit
eine Hoffnung auf harmonische Gestaltung unse-
res Lebens — mehr als Hoffnung war uns nie
beschieden! — nach der andern schwinden. Es
ist schon so, wie Alfred Weber es in seiner Mün-
chener Rede ausgesprochen hat: seit Jahrtau-
senden stand der Mensch nicht mehr so nackt,
des Haltes und der Hilfe entbehrend vor der
Welt. Unendlich viele Burgen des Glaubens sind
zerfallen, und geblieben ist der Menschheit fast
nur der Glaube an die Notwendigkeit des Kamp-
fes, an die Macht und Fülle des Lebens, wie es
sich im Kampfe offenbart.
In einer solchen Zeit bedeutet es etwas Be-
sonderes, wenn in der Musik fast plötzlich das
altvertraute, mit unendlichen Herrlichkeiten er-
füllte Reich der tonalen Harmonie verlassen wird.
Es kann nicht nur eine Angelegenheit artistischer
Überspitzung, auch nicht ein Symptom des
den Harmonien zugrunde liegenden Zahlenver-
hältnisse sehr wohl wußten: der akkordliche Zu-
sammenklang hatte für sie keinen Sinn, ihre
Musik erschöpfte sich in einer rhythmisch und
melodisch offenbar sehr differenzierten Linie.
Es scheint der Besonderheit des Renaissance-
Geistes vorbehalten gewesen zu sein, diese Ent-
deckung zu machen: sein Bedürfnis nach Klar-
heit und Abgeschlossenheit, nach Überwindung
der Unendlichkeit durch endlich faßbare Formen,
nach einer nicht nur begrifflichen, sondern auch
anschaulichen Beherrschung der Welt ließ ihn
nicht nur in der Linearperspektive ein zwar will-
kürliches, aber doch sehr brauchbares Mittel zur
Veranschaulichung der Raumtiefe auf der Fläche
finden, sondern schließlich auch die bisher flüch-
tigste, der Unendlichkeit am engsten verbundene
Kunst der Musik in feste Formen fassen.
Während aber die neuen Mittel der Malerei —
und ähnlich der Baukunst — vor allem der
,,Schaubarkeit" dienten, sich also in erster Linie
auf das Verhältnis zum Beschauer bezogen und
daher dem inneren Organismus und damit dem
seelischen Gehalt des Kunstwerks oft gefähr-
lich wurden, bedeutete die Entdeckung und
Dimensionierung des „Tonraumes" eine unend-
liche Bereicherung nicht nur der organisch ge-
staltenden Kräfte, sondern auch des seelischen
Gehaltes der Musik, weil eben hier nicht eine
neue Beziehung des Menschen zur Welt und zum
Kunstwerk, sondern eine Naturtatsache von
größter objektiver Geltung nicht eigentlich auf-
gefunden, sondern geradezu neu geschaffen
wurde. Denn die Naturtatsache der Tonalität
wurde gerade in diesem Augenblick aus dem Zu-
stand der „Möglichkeit" in den der „Wirklichkeit"
übergeführt. So ist diese letzte Entdeckung des
Renaissancegeistes zugleich auch seine größte
und tiefste gewesen —, sie ist aber an dieser
Stelle der Menschheitsentwicklung nur zu be-
greifen aus dem Zusammenhang mit all den
anderen Bemühungen um die Beherrschung der
Welt und um die Eroberung einer vollkommenen
„Harmonie" der Welt, wie sie dann auf dem phi-
losophischen Gebiete etwa in dem metaphysi-
schen Glauben Leibnizens an die „prästabilierte
Harmonie" des Weltalls oder, in unendlicher Ver-
flachung, in der Überzeugung der rationalen Wis-
senschaft von der Möglichkeit einer restlosen
Durchdringung und Erhellung, damit auch Har-
monisierung der Welt mit den Mitteln exakter
Forschung zutage treten. Und so entbehrte es
keineswegs des tieferen Sinnes, würde man das
durch die Renaissance geschaffene Weltbild,
26
das bis etwa 1900 maßgebend bleibt, als das
„tonale Weltbild" bezeichnen.
Nun ist es aber eine Tatsache von ungeheurer
Bedeutung, daß seit einigen Jahrzehnten die
exakte Wissenschaft ihren Anspruch, die Welt
mit ihren Mitteln erobern und dem Menschen gei-
stig dienstbar zu machen, aufzugeben beginnt.
Je mehr sie ihre Methoden verfeinert, ihre Beob-
achtungsmittel schärft, je tiefer sie eindringt,
desto weniger kommt sie zu endgültigen Ergeb-
nissen. Im Gegenteil, die Natur entgleitet ihr mit
jedem Tage mehr. Schon ist der Menschengeist
in Regionen vorgedrungen, in denen das Gesetz
der Kausalität nicht mehr gilt, und von da aus
zieht er die Gültigkeit des Kausalitätsgesetzes
überhaupt in Zweifel und setzt an dessen Stelle
die statistische „Regel", den „Mittelwert". In
das klare und feste Ordnungsgefüge des drei-
dimensionalen Raumes dringt seit Einstein die
Zeit als vierte Dimension und bringt den Raum
ins Gleiten. Man spricht von der „prästabilierten
Disharmonie" der Welt und ersetzt das „stati-
sche" Weltbild durch ein „dynamisches". Man
glaubt nicht mehr an ewige und unabänderliche
Weltgesetze, die das All in Ordnung und Harmo-
nie erhalten — glaubt weder mehr an die „Har-
monie der Sphären" noch an die Gesetze des
„gestirnten Himmels über uns" —, höchstens an
das allmähliche Werden einer Harmonie als End-
ergebnis eines Kampfes der Kräfte gegenein-
ander, der die Welt beherrscht und in den wir
selber hineingestellt sind.
Wir selber stehen mitten in dem Kampfe, und
wenn auch äußere Bindungen von gewaltiger
Macht der Menschheit, aber nur ihrem der Ober-
fläche verhafteten Teile, scheinbar einen Halt
verleihen, so sehen alle tieferen Naturen doch
eine innere Bindung nach der andern und damit
eine Hoffnung auf harmonische Gestaltung unse-
res Lebens — mehr als Hoffnung war uns nie
beschieden! — nach der andern schwinden. Es
ist schon so, wie Alfred Weber es in seiner Mün-
chener Rede ausgesprochen hat: seit Jahrtau-
senden stand der Mensch nicht mehr so nackt,
des Haltes und der Hilfe entbehrend vor der
Welt. Unendlich viele Burgen des Glaubens sind
zerfallen, und geblieben ist der Menschheit fast
nur der Glaube an die Notwendigkeit des Kamp-
fes, an die Macht und Fülle des Lebens, wie es
sich im Kampfe offenbart.
In einer solchen Zeit bedeutet es etwas Be-
sonderes, wenn in der Musik fast plötzlich das
altvertraute, mit unendlichen Herrlichkeiten er-
füllte Reich der tonalen Harmonie verlassen wird.
Es kann nicht nur eine Angelegenheit artistischer
Überspitzung, auch nicht ein Symptom des