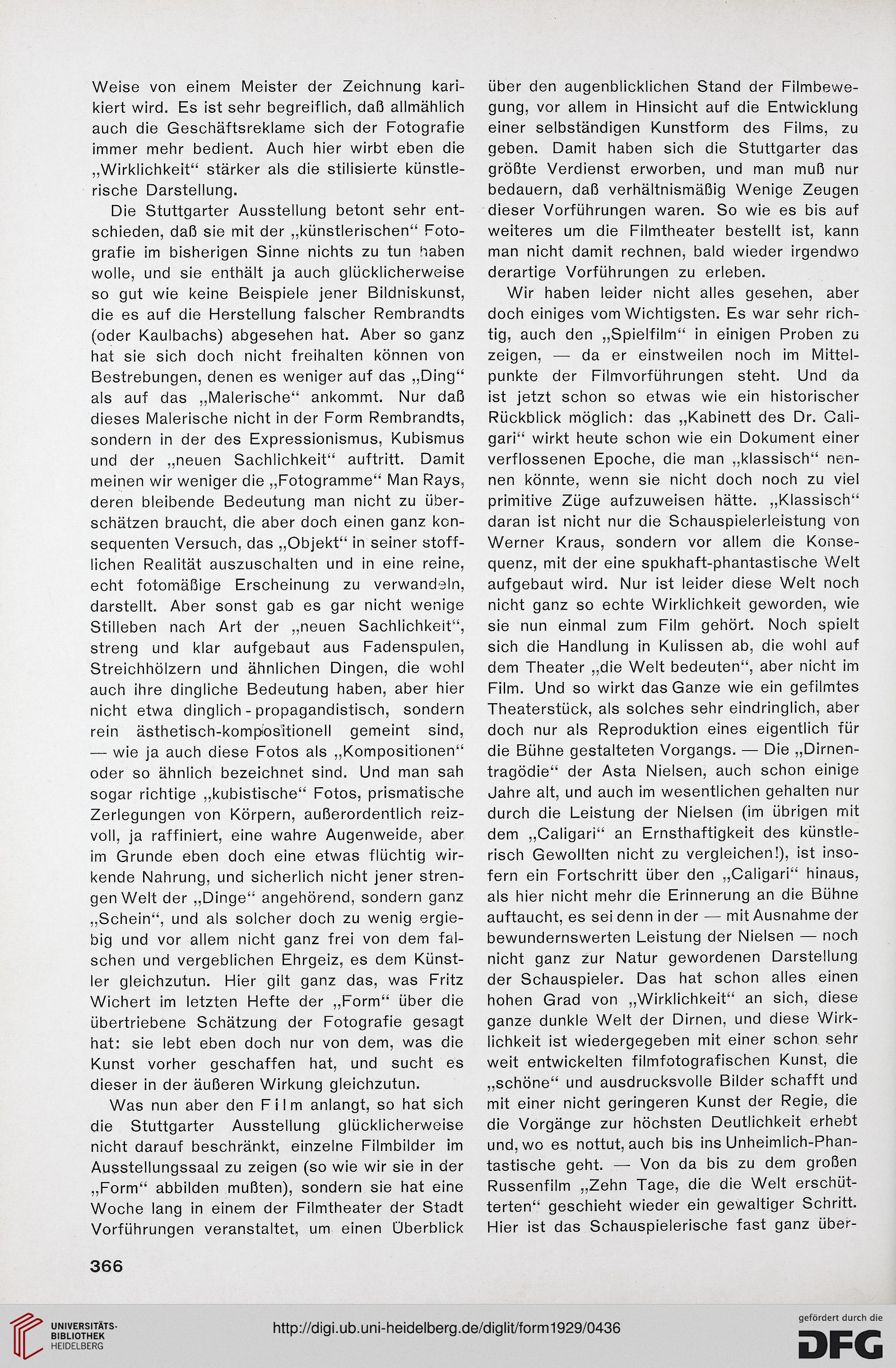Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 4.1929
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0436
DOI Artikel:
Riezler, Walter: "Form", Foto und Film
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0436
Weise von einem Meister der Zeichnung kari-
kiert wird. Es ist sehr begreiflich, daß allmählich
auch die Geschäftsreklame sich der Fotografie
immer mehr bedient. Auch hier wirbt eben die
„Wirklichkeit" stärker als die stilisierte künstle-
rische Darstellung.
Die Stuttgarter Ausstellung betont sehr ent-
schieden, daß sie mit der „künstlerischen" Foto-
grafie im bisherigen Sinne nichts zu tun haben
wolle, und sie enthält ja auch glücklicherweise
so gut wie keine Beispiele jener Bildniskunst,
die es auf die Herstellung falscher Rembrandts
(oder Kaulbachs) abgesehen hat. Aber so ganz
hat sie sich doch nicht freihalten können von
Bestrebungen, denen es weniger auf das ,,Ding"
als auf das „Malerische" ankommt. Nur daß
dieses Malerische nicht in der Form Rembrandts,
sondern in der des Expressionismus, Kubismus
und der „neuen Sachlichkeit" auftritt. Damit
meinen wir weniger die „Fotogramme" Man Rays,
deren bleibende Bedeutung man nicht zu über-
schätzen braucht, die aber doch einen ganz kon-
sequenten Versuch, das „Objekt" in seiner stoff-
lichen Realität auszuschalten und in eine reine,
echt fotomäßige Erscheinung zu verwandeln,
darstellt. Aber sonst gab es gar nicht wenige
Stilleben nach Art der „neuen Sachlichkeit",
streng und klar aufgebaut aus Fadenspulen,
Streichhölzern und ähnlichen Dingen, die wohl
auch ihre dingliche Bedeutung haben, aber hier
nicht etwa dinglich - propagandistisch, sondern
rein ästhetisch-kompiositionell gemeint sind,
— wie ja auch diese Fotos als „Kompositionen"
oder so ähnlich bezeichnet sind. Und man sah
sogar richtige „kubistische" Fotos, prismatische
Zerlegungen von Körpern, außerordentlich reiz-
voll, ja raffiniert, eine wahre Augenweide, aber
im Grunde eben doch eine etwas flüchtig wir-
kende Nahrung, und sicherlich nicht jener stren-
gen Welt der „Dinge" angehörend, sondern ganz
„Schein", und als solcher doch zu wenig ergie-
big und vor allem nicht ganz frei von dem fal-
schen und vergeblichen Ehrgeiz, es dem Künst-
ler gleichzutun. Hier gilt ganz das, was Fritz
Wiehert im letzten Hefte der „Form" über die
übertriebene Schätzung der Fotografie gesagt
hat: sie lebt eben doch nur von dem, was die
Kunst vorher geschaffen hat, und sucht es
dieser in der äußeren Wirkung gleichzutun.
Was nun aber den Film anlangt, so hat sich
die Stuttgarter Ausstellung glücklicherweise
nicht darauf beschränkt, einzelne Filmbilder im
Ausstellungssaal zu zeigen (so wie wir sie in der
„Form" abbilden mußten), sondern sie hat eine
Woche lang in einem der Filmtheater der Stadt
Vorführungen veranstaltet, um einen Überblick
über den augenblicklichen Stand der Filmbewe-
gung, vor allem in Hinsicht auf die Entwicklung
einer selbständigen Kunstform des Films, zu
geben. Damit haben sich die Stuttgarter das
größte Verdienst erworben, und man muß nur
bedauern, daß verhältnismäßig Wenige Zeugen
dieser Vorführungen waren. So wie es bis auf
weiteres um die Filmtheater bestellt ist, kann
man nicht damit rechnen, bald wieder irgendwo
derartige Vorführungen zu erleben.
Wir haben leider nicht alles gesehen, aber
doch einiges vom Wichtigsten. Es war sehr rich-
tig, auch den „Spielfilm" in einigen Proben zu
zeigen, — da er einstweilen noch im Mittel-
punkte der Filmvorführungen steht. Und da
ist jetzt schon so etwas wie ein historischer
Rückblick möglich: das „Kabinett des Dr. Cali-
gari" wirkt heute schon wie ein Dokument einer
verflossenen Epoche, die man „klassisch" nen-
nen könnte, wenn sie nicht doch noch zu viel
primitive Züge aufzuweisen hätte. „Klassisch"
daran ist nicht nur die Schauspielerleistung von
Werner Kraus, sondern vor allem die Konse-
quenz, mit der eine spukhaft-phantastische Welt
aufgebaut wird. Nur ist leider diese Welt noch
nicht ganz so echte Wirklichkeit geworden, wie
sie nun einmal zum Film gehört. Noch spielt
sich die Handlung in Kulissen ab, die wohl auf
dem Theater „die Welt bedeuten", aber nicht im
Film. Und so wirkt das Ganze wie ein gefilmtes
Theaterstück, als solches sehr eindringlich, aber
doch nur als Reproduktion eines eigentlich für
die Bühne gestalteten Vorgangs. — Die „Dirnen-
tragödie" der Asta Nielsen, auch schon einige
Jahre alt, und auch im wesentlichen gehalten nur
durch die Leistung der Nielsen (im übrigen mit
dem „Caligari" an Ernsthaftigkeit des künstle-
risch Gewollten nicht zu vergleichen!), ist inso-
fern ein Fortschritt über den „Caligari" hinaus,
als hier nicht mehr die Erinnerung an die Bühne
auftaucht, es sei denn in der — mit Ausnahme der
bewundernswerten Leistung der Nielsen — noch
nicht ganz zur Natur gewordenen Darstellung
der Schauspieler. Das hat schon alles einen
hohen Grad von „Wirklichkeit" an sich, diese
ganze dunkle Welt der Dirnen, und diese Wirk-
lichkeit ist wiedergegeben mit einer schon sehr
weit entwickelten filmfotografischen Kunst, die
„schöne" und ausdrucksvolle Bilder schafft und
mit einer nicht geringeren Kunst der Regie, die
die Vorgänge zur höchsten Deutlichkeit erhebt
und, wo es nottut, auch bis ins Unheimlich-Phan-
tastische geht. — Von da bis zu dem großen
Russenfilm „Zehn Tage, die die Welt erschüt-
terten" geschieht wieder ein gewaltiger Schritt.
Hier ist das Schauspielerische fast ganz über-
366
kiert wird. Es ist sehr begreiflich, daß allmählich
auch die Geschäftsreklame sich der Fotografie
immer mehr bedient. Auch hier wirbt eben die
„Wirklichkeit" stärker als die stilisierte künstle-
rische Darstellung.
Die Stuttgarter Ausstellung betont sehr ent-
schieden, daß sie mit der „künstlerischen" Foto-
grafie im bisherigen Sinne nichts zu tun haben
wolle, und sie enthält ja auch glücklicherweise
so gut wie keine Beispiele jener Bildniskunst,
die es auf die Herstellung falscher Rembrandts
(oder Kaulbachs) abgesehen hat. Aber so ganz
hat sie sich doch nicht freihalten können von
Bestrebungen, denen es weniger auf das ,,Ding"
als auf das „Malerische" ankommt. Nur daß
dieses Malerische nicht in der Form Rembrandts,
sondern in der des Expressionismus, Kubismus
und der „neuen Sachlichkeit" auftritt. Damit
meinen wir weniger die „Fotogramme" Man Rays,
deren bleibende Bedeutung man nicht zu über-
schätzen braucht, die aber doch einen ganz kon-
sequenten Versuch, das „Objekt" in seiner stoff-
lichen Realität auszuschalten und in eine reine,
echt fotomäßige Erscheinung zu verwandeln,
darstellt. Aber sonst gab es gar nicht wenige
Stilleben nach Art der „neuen Sachlichkeit",
streng und klar aufgebaut aus Fadenspulen,
Streichhölzern und ähnlichen Dingen, die wohl
auch ihre dingliche Bedeutung haben, aber hier
nicht etwa dinglich - propagandistisch, sondern
rein ästhetisch-kompiositionell gemeint sind,
— wie ja auch diese Fotos als „Kompositionen"
oder so ähnlich bezeichnet sind. Und man sah
sogar richtige „kubistische" Fotos, prismatische
Zerlegungen von Körpern, außerordentlich reiz-
voll, ja raffiniert, eine wahre Augenweide, aber
im Grunde eben doch eine etwas flüchtig wir-
kende Nahrung, und sicherlich nicht jener stren-
gen Welt der „Dinge" angehörend, sondern ganz
„Schein", und als solcher doch zu wenig ergie-
big und vor allem nicht ganz frei von dem fal-
schen und vergeblichen Ehrgeiz, es dem Künst-
ler gleichzutun. Hier gilt ganz das, was Fritz
Wiehert im letzten Hefte der „Form" über die
übertriebene Schätzung der Fotografie gesagt
hat: sie lebt eben doch nur von dem, was die
Kunst vorher geschaffen hat, und sucht es
dieser in der äußeren Wirkung gleichzutun.
Was nun aber den Film anlangt, so hat sich
die Stuttgarter Ausstellung glücklicherweise
nicht darauf beschränkt, einzelne Filmbilder im
Ausstellungssaal zu zeigen (so wie wir sie in der
„Form" abbilden mußten), sondern sie hat eine
Woche lang in einem der Filmtheater der Stadt
Vorführungen veranstaltet, um einen Überblick
über den augenblicklichen Stand der Filmbewe-
gung, vor allem in Hinsicht auf die Entwicklung
einer selbständigen Kunstform des Films, zu
geben. Damit haben sich die Stuttgarter das
größte Verdienst erworben, und man muß nur
bedauern, daß verhältnismäßig Wenige Zeugen
dieser Vorführungen waren. So wie es bis auf
weiteres um die Filmtheater bestellt ist, kann
man nicht damit rechnen, bald wieder irgendwo
derartige Vorführungen zu erleben.
Wir haben leider nicht alles gesehen, aber
doch einiges vom Wichtigsten. Es war sehr rich-
tig, auch den „Spielfilm" in einigen Proben zu
zeigen, — da er einstweilen noch im Mittel-
punkte der Filmvorführungen steht. Und da
ist jetzt schon so etwas wie ein historischer
Rückblick möglich: das „Kabinett des Dr. Cali-
gari" wirkt heute schon wie ein Dokument einer
verflossenen Epoche, die man „klassisch" nen-
nen könnte, wenn sie nicht doch noch zu viel
primitive Züge aufzuweisen hätte. „Klassisch"
daran ist nicht nur die Schauspielerleistung von
Werner Kraus, sondern vor allem die Konse-
quenz, mit der eine spukhaft-phantastische Welt
aufgebaut wird. Nur ist leider diese Welt noch
nicht ganz so echte Wirklichkeit geworden, wie
sie nun einmal zum Film gehört. Noch spielt
sich die Handlung in Kulissen ab, die wohl auf
dem Theater „die Welt bedeuten", aber nicht im
Film. Und so wirkt das Ganze wie ein gefilmtes
Theaterstück, als solches sehr eindringlich, aber
doch nur als Reproduktion eines eigentlich für
die Bühne gestalteten Vorgangs. — Die „Dirnen-
tragödie" der Asta Nielsen, auch schon einige
Jahre alt, und auch im wesentlichen gehalten nur
durch die Leistung der Nielsen (im übrigen mit
dem „Caligari" an Ernsthaftigkeit des künstle-
risch Gewollten nicht zu vergleichen!), ist inso-
fern ein Fortschritt über den „Caligari" hinaus,
als hier nicht mehr die Erinnerung an die Bühne
auftaucht, es sei denn in der — mit Ausnahme der
bewundernswerten Leistung der Nielsen — noch
nicht ganz zur Natur gewordenen Darstellung
der Schauspieler. Das hat schon alles einen
hohen Grad von „Wirklichkeit" an sich, diese
ganze dunkle Welt der Dirnen, und diese Wirk-
lichkeit ist wiedergegeben mit einer schon sehr
weit entwickelten filmfotografischen Kunst, die
„schöne" und ausdrucksvolle Bilder schafft und
mit einer nicht geringeren Kunst der Regie, die
die Vorgänge zur höchsten Deutlichkeit erhebt
und, wo es nottut, auch bis ins Unheimlich-Phan-
tastische geht. — Von da bis zu dem großen
Russenfilm „Zehn Tage, die die Welt erschüt-
terten" geschieht wieder ein gewaltiger Schritt.
Hier ist das Schauspielerische fast ganz über-
366