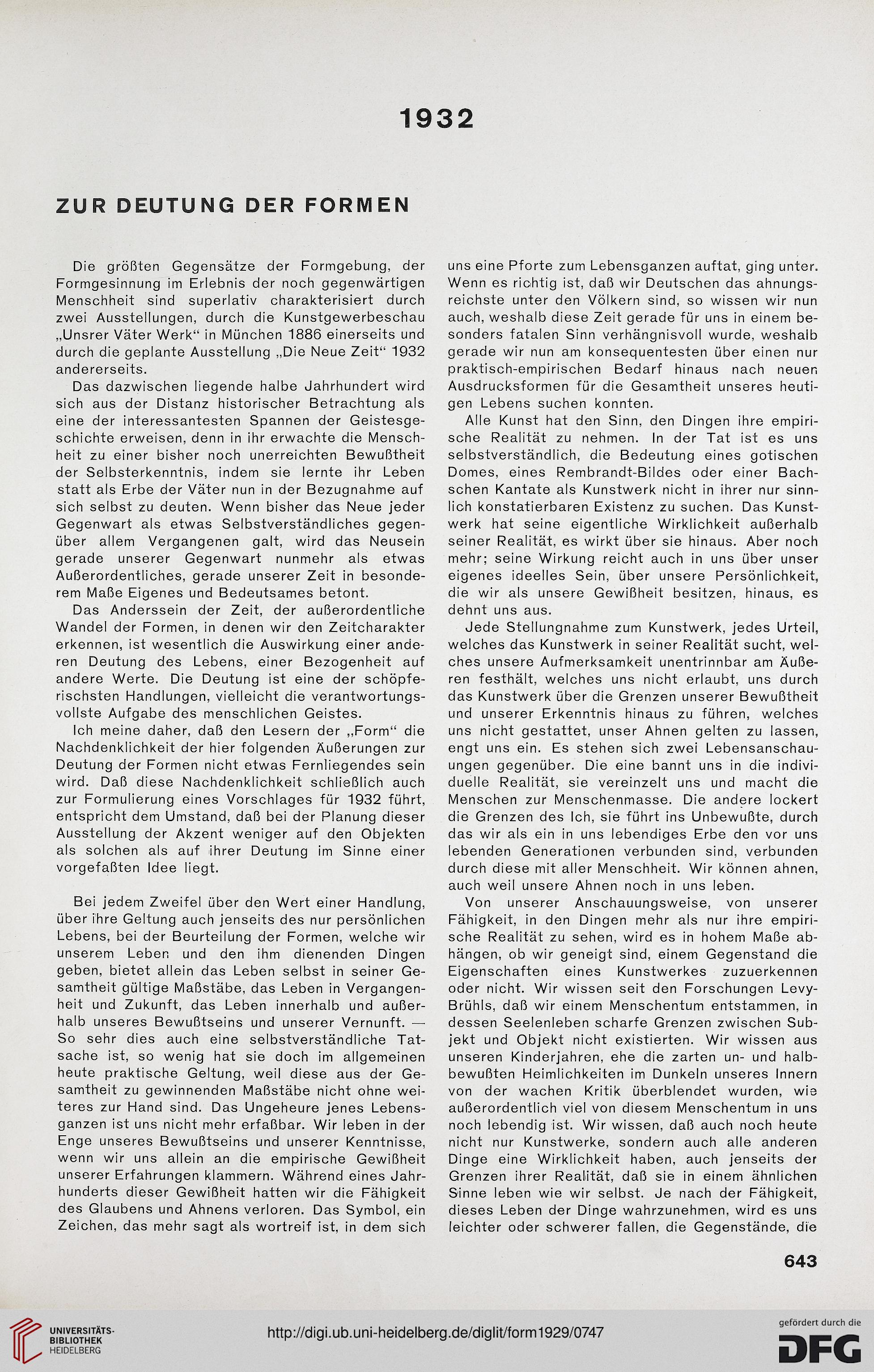Die Form: Zeitschrift für gestaltende Arbeit — 4.1929
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0747
DOI article:
Debschitz, Wilhelm von: Zur Deutung der Formen
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.13710#0747
1932
ZUR DEUTUNG DER FORMEN
Die größten Gegensätze der Formgebung, der
Formgesinnung im Erlebnis der noch gegenwärtigen
Menschheit sind Superlativ charakterisiert durch
zwei Ausstellungen, durch die Kunstgewerbeschau
„Unsrer Väter Werk" in München 1886 einerseits und
durch die geplante Ausstellung „Die Neue Zeit" 1932
andererseits.
Das dazwischen liegende halbe Jahrhundert wird
sich aus der Distanz historischer Betrachtung als
eine der interessantesten Spannen der Geistesge-
schichte erweisen, denn in ihr erwachte die Mensch-
heit zu einer bisher noch unerreichten Bewußtheit
der Selbsterkenntnis, indem sie lernte ihr Leben
statt als Erbe der Väter nun in der Bezugnahme auf
sich selbst zu deuten. Wenn bisher das Neue jeder
Gegenwart als etwas Selbstverständliches gegen-
über allem Vergangenen galt, wird das Neusein
gerade unserer Gegenwart nunmehr als etwas
Außerordentliches, gerade unserer Zeit in besonde-
rem Maße Eigenes und Bedeutsames betont.
Das Anderssein der Zeit, der außerordentliche
Wandel der Formen, in denen wir den Zeitcharakter
erkennen, ist wesentlich die Auswirkung einer ande-
ren Deutung des Lebens, einer Bezogenheit auf
andere Werte. Die Deutung ist eine der schöpfe-
rischsten Handlungen, vielleicht die verantwortungs-
vollste Aufgabe des menschlichen Geistes.
Ich meine daher, daß den Lesern der „Form" die
Nachdenklichkeit der hier folgenden Äußerungen zur
Deutung der Formen nicht etwas Fernliegendes sein
wird. Daß diese Nachdenklichkeit schließlich auch
zur Formulierung eines Vorschlages für 1932 führt,
entspricht dem Umstand, daß bei der Planung dieser
Ausstellung der Akzent weniger auf den Objekten
als solchen als auf ihrer Deutung im Sinne einer
vorgefaßten Idee liegt.
Bei jedem Zweifel über den Wert einer Handlung,
über ihre Geltung auch jenseits des nur persönlichen
Lebens, bei der Beurteilung der Formen, welche wir
unserem Leben und den ihm dienenden Dingen
geben, bietet allein das Leben selbst in seiner Ge-
samtheit gültige Maßstäbe, das Leben in Vergangen-
heit und Zukunft, das Leben innerhalb und außer-
halb unseres Bewußtseins und unserer Vernunft. —
So sehr dies auch eine selbstverständliche Tat-
sache ist, so wenig hat sie doch im allgemeinen
heute praktische Geltung, weil diese aus der Ge-
samtheit zu gewinnenden Maßstäbe nicht ohne wei-
teres zur Hand sind. Das Ungeheure jenes Lebens-
ganzen ist uns nicht mehr erfaßbar. Wir leben in der
Enge unseres Bewußtseins und unserer Kenntnisse,
wenn wir uns allein an die empirische Gewißheit
unserer Erfahrungen klammern. Während eines Jahr-
hunderts dieser Gewißheit hatten wir die Fähigkeit
des Glaubens und Ahnens verloren. Das Symbol, ein
Zeichen, das mehr sagt als wortreif ist, in dem sich
uns eine Pforte zum Lebensganzen auftat, ging unter.
Wenn es richtig ist, daß wir Deutschen das ahnungs-
reichste unter den Völkern sind, so wissen wir nun
auch, weshalb diese Zeit gerade für uns in einem be-
sonders fatalen Sinn verhängnisvoll wurde, weshalb
gerade wir nun am konsequentesten über einen nur
praktisch-empirischen Bedarf hinaus nach neuen
Ausdrucksformen für die Gesamtheit unseres heuti-
gen Lebens suchen konnten.
Alle Kunst hat den Sinn, den Dingen ihre empiri-
sche Realität zu nehmen. In der Tat ist es uns
selbstverständlich, die Bedeutung eines gotischen
Domes, eines Rembrandt-Bildes oder einer Bach-
schen Kantate als Kunstwerk nicht in ihrer nur sinn-
lich konstatierbaren Existenz zu suchen. Das Kunst-
werk hat seine eigentliche Wirklichkeit außerhalb
seiner Realität, es wirkt über sie hinaus. Aber noch
mehr; seine Wirkung reicht auch in uns über unser
eigenes ideelles Sein, über unsere Persönlichkeit,
die wir als unsere Gewißheit besitzen, hinaus, es
dehnt uns aus.
Jede Stellungnahme zum Kunstwerk, jedes Urteil,
welches das Kunstwerk in seiner Realität sucht, wel-
ches unsere Aufmerksamkeit unentrinnbar am Äuße-
ren festhält, welches uns nicht erlaubt, uns durch
das Kunstwerk über die Grenzen unserer Bewußtheit
und unserer Erkenntnis hinaus zu führen, welches
uns nicht gestattet, unser Ahnen gelten zu lassen,
engt uns ein. Es stehen sich zwei Lebensanschau-
ungen gegenüber. Die eine bannt uns in die indivi-
duelle Realität, sie vereinzelt uns und macht die
Menschen zur Menschenmasse. Die andere lockert
die Grenzen des Ich, sie führt ins Unbewußte, durch
das wir als ein in uns lebendiges Erbe den vor uns
lebenden Generationen verbunden sind, verbunden
durch diese mit aller Menschheit. Wir können ahnen,
auch weil unsere Ahnen noch in uns leben.
Von unserer Anschauungsweise, von unserer
Fähigkeit, in den Dingen mehr als nur ihre empiri-
sche Realität zu sehen, wird es in hohem Maße ab-
hängen, ob wir geneigt sind, einem Gegenstand die
Eigenschaften eines Kunstwerkes zuzuerkennen
oder nicht. Wir wissen seit den Forschungen Levy-
Brühls, daß wir einem Menschentum entstammen, in
dessen Seelenleben scharfe Grenzen zwischen Sub-
jekt und Objekt nicht existierten. Wir wissen aus
unseren Kinderjahren, ehe die zarten un- und halb-
bewußten Heimlichkeiten im Dunkeln unseres Innern
von der wachen Kritik überblendet wurden, wie
außerordentlich viel von diesem Menschentum in uns
noch lebendig ist. Wir wissen, daß auch noch heute
nicht nur Kunstwerke, sondern auch alle anderen
Dinge eine Wirklichkeit haben, auch jenseits der
Grenzen ihrer Realität, daß sie in einem ähnlichen
Sinne leben wie wir selbst. Je nach der Fähigkeit,
dieses Leben der Dinge wahrzunehmen, wird es uns
leichter oder schwerer fallen, die Gegenstände, die
643
ZUR DEUTUNG DER FORMEN
Die größten Gegensätze der Formgebung, der
Formgesinnung im Erlebnis der noch gegenwärtigen
Menschheit sind Superlativ charakterisiert durch
zwei Ausstellungen, durch die Kunstgewerbeschau
„Unsrer Väter Werk" in München 1886 einerseits und
durch die geplante Ausstellung „Die Neue Zeit" 1932
andererseits.
Das dazwischen liegende halbe Jahrhundert wird
sich aus der Distanz historischer Betrachtung als
eine der interessantesten Spannen der Geistesge-
schichte erweisen, denn in ihr erwachte die Mensch-
heit zu einer bisher noch unerreichten Bewußtheit
der Selbsterkenntnis, indem sie lernte ihr Leben
statt als Erbe der Väter nun in der Bezugnahme auf
sich selbst zu deuten. Wenn bisher das Neue jeder
Gegenwart als etwas Selbstverständliches gegen-
über allem Vergangenen galt, wird das Neusein
gerade unserer Gegenwart nunmehr als etwas
Außerordentliches, gerade unserer Zeit in besonde-
rem Maße Eigenes und Bedeutsames betont.
Das Anderssein der Zeit, der außerordentliche
Wandel der Formen, in denen wir den Zeitcharakter
erkennen, ist wesentlich die Auswirkung einer ande-
ren Deutung des Lebens, einer Bezogenheit auf
andere Werte. Die Deutung ist eine der schöpfe-
rischsten Handlungen, vielleicht die verantwortungs-
vollste Aufgabe des menschlichen Geistes.
Ich meine daher, daß den Lesern der „Form" die
Nachdenklichkeit der hier folgenden Äußerungen zur
Deutung der Formen nicht etwas Fernliegendes sein
wird. Daß diese Nachdenklichkeit schließlich auch
zur Formulierung eines Vorschlages für 1932 führt,
entspricht dem Umstand, daß bei der Planung dieser
Ausstellung der Akzent weniger auf den Objekten
als solchen als auf ihrer Deutung im Sinne einer
vorgefaßten Idee liegt.
Bei jedem Zweifel über den Wert einer Handlung,
über ihre Geltung auch jenseits des nur persönlichen
Lebens, bei der Beurteilung der Formen, welche wir
unserem Leben und den ihm dienenden Dingen
geben, bietet allein das Leben selbst in seiner Ge-
samtheit gültige Maßstäbe, das Leben in Vergangen-
heit und Zukunft, das Leben innerhalb und außer-
halb unseres Bewußtseins und unserer Vernunft. —
So sehr dies auch eine selbstverständliche Tat-
sache ist, so wenig hat sie doch im allgemeinen
heute praktische Geltung, weil diese aus der Ge-
samtheit zu gewinnenden Maßstäbe nicht ohne wei-
teres zur Hand sind. Das Ungeheure jenes Lebens-
ganzen ist uns nicht mehr erfaßbar. Wir leben in der
Enge unseres Bewußtseins und unserer Kenntnisse,
wenn wir uns allein an die empirische Gewißheit
unserer Erfahrungen klammern. Während eines Jahr-
hunderts dieser Gewißheit hatten wir die Fähigkeit
des Glaubens und Ahnens verloren. Das Symbol, ein
Zeichen, das mehr sagt als wortreif ist, in dem sich
uns eine Pforte zum Lebensganzen auftat, ging unter.
Wenn es richtig ist, daß wir Deutschen das ahnungs-
reichste unter den Völkern sind, so wissen wir nun
auch, weshalb diese Zeit gerade für uns in einem be-
sonders fatalen Sinn verhängnisvoll wurde, weshalb
gerade wir nun am konsequentesten über einen nur
praktisch-empirischen Bedarf hinaus nach neuen
Ausdrucksformen für die Gesamtheit unseres heuti-
gen Lebens suchen konnten.
Alle Kunst hat den Sinn, den Dingen ihre empiri-
sche Realität zu nehmen. In der Tat ist es uns
selbstverständlich, die Bedeutung eines gotischen
Domes, eines Rembrandt-Bildes oder einer Bach-
schen Kantate als Kunstwerk nicht in ihrer nur sinn-
lich konstatierbaren Existenz zu suchen. Das Kunst-
werk hat seine eigentliche Wirklichkeit außerhalb
seiner Realität, es wirkt über sie hinaus. Aber noch
mehr; seine Wirkung reicht auch in uns über unser
eigenes ideelles Sein, über unsere Persönlichkeit,
die wir als unsere Gewißheit besitzen, hinaus, es
dehnt uns aus.
Jede Stellungnahme zum Kunstwerk, jedes Urteil,
welches das Kunstwerk in seiner Realität sucht, wel-
ches unsere Aufmerksamkeit unentrinnbar am Äuße-
ren festhält, welches uns nicht erlaubt, uns durch
das Kunstwerk über die Grenzen unserer Bewußtheit
und unserer Erkenntnis hinaus zu führen, welches
uns nicht gestattet, unser Ahnen gelten zu lassen,
engt uns ein. Es stehen sich zwei Lebensanschau-
ungen gegenüber. Die eine bannt uns in die indivi-
duelle Realität, sie vereinzelt uns und macht die
Menschen zur Menschenmasse. Die andere lockert
die Grenzen des Ich, sie führt ins Unbewußte, durch
das wir als ein in uns lebendiges Erbe den vor uns
lebenden Generationen verbunden sind, verbunden
durch diese mit aller Menschheit. Wir können ahnen,
auch weil unsere Ahnen noch in uns leben.
Von unserer Anschauungsweise, von unserer
Fähigkeit, in den Dingen mehr als nur ihre empiri-
sche Realität zu sehen, wird es in hohem Maße ab-
hängen, ob wir geneigt sind, einem Gegenstand die
Eigenschaften eines Kunstwerkes zuzuerkennen
oder nicht. Wir wissen seit den Forschungen Levy-
Brühls, daß wir einem Menschentum entstammen, in
dessen Seelenleben scharfe Grenzen zwischen Sub-
jekt und Objekt nicht existierten. Wir wissen aus
unseren Kinderjahren, ehe die zarten un- und halb-
bewußten Heimlichkeiten im Dunkeln unseres Innern
von der wachen Kritik überblendet wurden, wie
außerordentlich viel von diesem Menschentum in uns
noch lebendig ist. Wir wissen, daß auch noch heute
nicht nur Kunstwerke, sondern auch alle anderen
Dinge eine Wirklichkeit haben, auch jenseits der
Grenzen ihrer Realität, daß sie in einem ähnlichen
Sinne leben wie wir selbst. Je nach der Fähigkeit,
dieses Leben der Dinge wahrzunehmen, wird es uns
leichter oder schwerer fallen, die Gegenstände, die
643