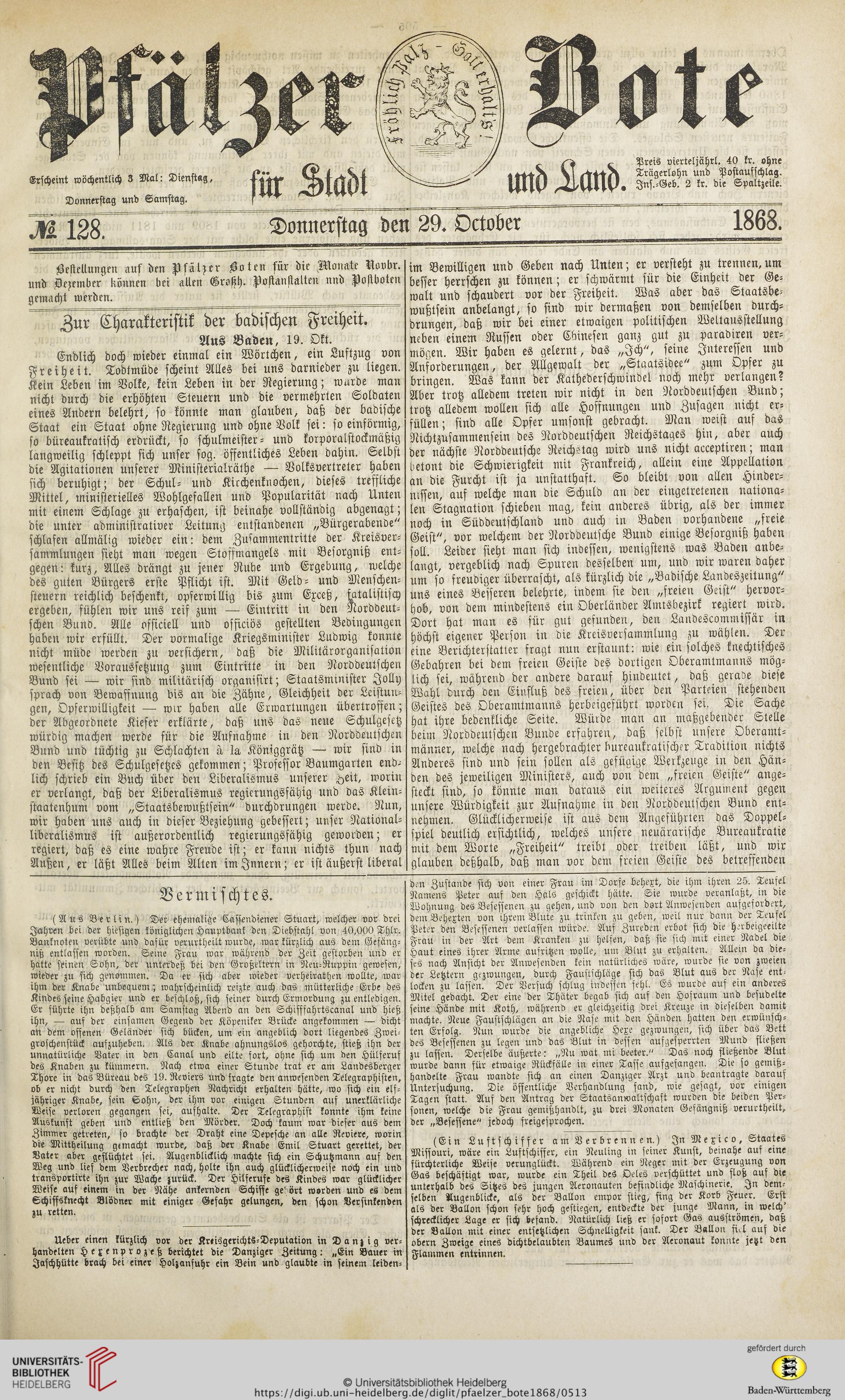128. Donnerstag den 29. October 1868.
Bestellungen auf den Pfälzer Boten für die Monate Novbr.
und Dezember können bei allen Grosth. Postanstalten nnd Postboten
gemacht werden.
Zur Charakteristik der badischen Freiheit.
Aus Baden, 19. Okt.
Endlich doch wieder einmal ein Wörtchen, ein Luftzug von
Freiheit. Todtmüde scheint Alles bei uns darnieder zu liegen.
Kein Leben im Volke, kein Leben in der Negierung; wurde man
nicht durch die erhöhten Steuern und die vermehrten Soldaten
eines Andern belehrt, so könnte man glauben, daß der badische
Staat ein Staat ohne Negierung und ohne Volk sei: so einförmig,
so büreaukratisch erdrückt, so schulmeister- und korporalstockmäßig
langweilig schleppt sich unser sog. öffentliches Leben dahin. Selbst
die Agitationen unserer Ministerialräthe — Volksvertreter haben
sich beruhigt; der Schul- und Kicchenknochen, dieses treffliche
Mittel, ministerielles Wohlgefallen und Popularität nach Unten
mit einem Schlage zu erhaschen, ist beinahe vollständig abgenagt;
die unter administrativer Leitung entstandenen „Bürgerabenve"
schlafen allmälig wieder ein: dem Zusammentritte der Kreisver-
sammlungen sieht man wegen Stoffmangels mit Besorgniß ent-
gegen: kurz, Alles drängt zu jener Ruhe und Ergebung, welche
des guten Bürgers erste Pflicht ist. Mit Geld- und Menschen-
steuern reichlich beschenkt, opferwillig bis zum Exceß, fatalistisch
ergeben, fühlen wir uns reif zum — Eintritt in den Norddeut-
schen Bund. Alle ofsiciell und ofsiciös gestellten Bedingungen
haben wir erfüllt. Der vormalige Kriegsminister Ludwig konnte
nicht müde werden zu versichern, daß die Militärorganisation
wesentliche Voraussetzung zum Eintritte in den Norddeutschen
Bund sei — wir sind militärisch organisirt; Staatsmtnister Jollp
sprach von Bewaffnung bis an die Zähne, Gleichheit der Leistun-
gen, Opferwilligkeit — nur haben alle Erwartungen übertroffen;
der Abgeordnete Kiefer erklärte, daß uns das neue Schulgesetz
würdig machen werde für die Aufnahme in den Norddeutschen
Bund und tüchtig zu Schlachten L lu Königgrätz — wir sind in
den Besitz des Schulgesetzes gekommen; Professor Baumgarten end-
lich schrieb ein Buch über den Liberalismus unserer Z»eit, worin
er verlangt, daß der Liberalismus regierungsfähig und das Klein-
staatenhum vom „Staatsbewußtsein" durchdrungen werde. Nun,
wir haben uns auch in dieser Beziehung gebessert; unser National-
liberalismus ist außerordentlich regierungsfähig geworden; er
regiert, daß es eine wahre Freude ist; er kann nichts thun nach
Außen, er läßt Alles beim Alten im Innern; er ist äußerst liberal
im Bewilligen und Geben nach Unten; er versteht zu trennen, um
besser herrschen zu können; er schwärmt für die Einheit der Ge-
walt und schaudert vor der Freiheit. Was aber das Staatsbe-
wußtsein anbelangt, so sind wir dermaßen von demselben durch-
drungen, daß wir bei einer etwaigen politischen Weltausstellung
neben einem Russen oder Chinesen ganz gut zu paradiren ver-
mögen. Wir haben es gelernt, das „Ich", seine Interessen und
Anforderungen, der Allgewalt der „Staatsidee" zum Opfer zu
bringen. Was kann der Kathederschwindel noch mehr verlangen?
Aber trotz alledem treten wir nicht in den Norddeutschen Bund;
trotz alledem wollen sich alle Hoffnungen und Zusagen nicht er-
füllen; sind alle Opfer umsonst gebracht. Man weist auf das
Nichtzusammensein des Norddeutschen Reichstages hin, aber auch
der nächste Norddeutsche Reichstag wird uns nicht acceptiren; man
betont die Schwierigkeit mit Frankreich, allein eine Appellation
an die Furcht ist ja unstatthaft. So bleibt von allen Hinder-
nissen, auf welche man die Schuld an der eingetretenen nationa-
len Stagnation schieben mag, kein anderes übrig, als der immer
noch in Süddeutschland und auch in Baden vorhandene „freie
Geist", vor welchem der Norddeutsche Bund einige Besorgniß haben
soll. Leider sieht man sich indessen, wenigstens was Baden anbe-
langt, vergeblich nach Spuren desselben um, und wir waren daher
um so freudiger überrascht, als kürzlich die „Badische Landcszeitung"
uns eines Besseren belehrte, indem sie den „freien Geist" hervor-
hob, von dem mindestens ein Oberländer Amtsbezirk regiert wird.
Dort hat man es für gut gefunden, den Landescommissär in
höchst eigener Person in die Kreisversammlung zu wählen. Ver-
eine Berichterstatter fragt nun erstaunt: wie ein solches knechtisches
Gebühren bei dem freien Geiste des dortigen Oberamtmanns mög-
lich sei, während der andere daraus hindeutet, daß gerade diese
Wahl durch den Einfluß des freien, über den Parteien stehenden
Geistes des Oberamtmanns herbeigeführt worden sei. Die Sache
hat ihre bedenkliche Seite. Würde man an maßgebender Stelle
beim Norddeutschen Bunde erfahren, daß selbst unsere Oberamt-
männer, welche nach hergebrachter bureaukratischer Tradition nichts
Anderes sind und sein sollen als gefügige Werkzeuge in den Hän-
den des jeweiligen Ministers, auch von dem „freien Geiste" ange-
steckt sind, so könnte man daraus ein weiteres Argument gegen
unsere Würdigkeit zur Aufnahme in den Norddeutschen Bund ent-
nehmen. Glücklicherweise ist aus dem Angeführten das Doppel-
spiel deutlich ersichtlich, welches unsere neuärarische Bureaukratie
mit dem Worte „Freiheit" treibt oder treiben läßt, und wir
glauben deßhalb, daß man vor dem freien Geiste des betreffenden
Vermischtes.
(Aus Berlin.) Der ehemalige Cassendiener Stuart, welcher vor drei
Jahren bei der hiesigen königlichen Hauptbank den Diebstahl von 40,000 Thlr.
Banknoten verübte und dafür verurtheilt wurde, war kürzlich aus dem Gesäng-
niß entlassen worden. Seine Frau war während der Zeit gestorben und er
hatte seinen Sohn, der unterdeß bei den Großeltern in Neu-Ruppin gewesen,
wieder zu sich genommen. Da er sich aber wieder verheirathen wollte, war
ihm der Knabe unbequem; wahrscheinlich reizte auch das mütterliche Erbe des
Kindes seine Habgier und er beschloß, sich seiner durch Ermordung zu entledigen.
Er führte ihn deßhalb am Samstag Abend an den Schifffahrtscanal und hieß
ihn, — auf der einsamen Gegend der Köpeniker Brücke angekommen — dicht
an dem offenen Geländer sich bücken, um ein angeblich dort liegendes Zwei-
groschenstück aufzuheben. Als der Knabe ahnungslos gehorchte, stieß ihn der
unnatürliche Vater in den Canal und eilte fort, ohne sich um den Hülferuf
des Knaben zu kümmern. Nach etwa einer Stunde trat er am Landesberger
Thore in das Büreau des 19. Reviers und fragte den anwesenden Telegraphisten,
ob er nicht durch den Telegraphen Nachricht erhalten hätte, wo sich ein elf-
jähriger Knabe, sein Sohn, der ihm vor einigen Stunden auf unerklärliche
Weise verloren gegangen sei, aushalte. Der Telegraphist konnte ihm keine
Auskunft geben und entließ den Mörder. Doch kaum war dieser aus dem
Zimmer getreten, so brachte der Draht eine Depesche an alle Reviere, worin
die Mütheilung gemacht wurde, daß der Knabe Emil Stuart gerettet, der
Vater aber geflüchtet sei. Augenblicklich machte sich ein Schutzmann auf den
Weg und lief dem Verbrecher nach, holte ihn auch glücklicherweise noch ein und
transportirte ihn zur Wache zurück. Der Hilferufe des Kindes war glücklicher
Weise auf einem in der Nähe ankernden Schiffe ge'ört worden und es dem
Echiffsknecht Blödner mit einiger Gefahr gelungen, den schon Versinkenden
zu retten.
Ueber einen kürzlich vor der Kreisgerichts-Deputation in Danzig ver-
handelten Hexenprozeß berichtet die Danziger Zeitung: „Ein Bauer in
Jaschhütte brach bei einer Holzanfuhr ein Bein und glaubte in seinem leiden¬
den Zustande sich von einer Frau im Dorfe behext, die ihm ihren 25. Teufel
Namens Peter auf den Hals geschickt hätte. Sie wurde veranlaßt, in die
Wohnung des Besessenen zu gehen, und von den dort Anwesenden aufgefordert,
dem Behexten von ihrem Blute zu trinken zu geben, weil nur dann der Teufel
Peter den Besessenen verlassen würde. Auf Zureden erbot sich die herbeigeeilte
Frau in der Art dem Kranken zu helfen, daß sie sich mit einer Nadel die
Haut eines ihrer Arme aufritzen wolle, um Blut zu erhalten. Allein da die-
ses nach Ansicht der Anwesenden kein natürliches wäre, wurde sie von zweien
der Letztern gezwungen, durch Faustschläge sich das Blut aus der Nase ent-
locken zu lassen. Der Versuch schlug indessen fehl. Es wurde auf ein anderes
Mitel gedacht. Der eine der Thäter begab sich auf den Hofraum und besudelte
seine Hände mit Koth, während er gleichzeitig drei Kreuze in dieselben damit
machte. Neue Faustschlägen an die Nase mit den Händen hatten den erwünsch-
ten Erfolg. Nun wurde die angebliche Hexe gezwungen, sich über das Bett
des Besessenen zu legen und das Blut in dessen aufgesperrten Mund fließen
zu lassen. Derselbe äußerte: „Nu wat mi beeter." Das noch fließende Blut
wurde dann für etwaige Rückfälle in einer Taffe aufgefangen. Die so gemiß-
handelte Frau wandte sich an einen Danziger Arzt und beantragte darauf
Untersuchung. Die öffentliche Verhandlung fand, wie gesagt, vor einigen
Tagen statt. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Per-
sonen, welche die Frau gemißhandlt, zu drei Monaten Gefängniß verurtheilt,
der „Besessene" jedoch sreigesprochen.
(Ein Luftschiffer am Verbrennen.) In Mexico, Staates
Misfouri, wäre ein Luftschiffer, ein Neuling in seiner Kunst, beinahe auf eine
fürchterliche Weise verunglückt. Während ein Neger mit der Erzeugung von
Gas beschäftigt war, wurde ein Theil des Oeles verschüttet und floß auf die
unterhalb des Sitzes des jungen Aeronauten befindliche Maschinerie, In dem-
selben Augenblicke, als der Ballon empor stieg, fing der Korb Feuer. Erst
als der Ballon schon sehr hoch gestiegen, entdeckte der junge Mann, in welch'
schrecklicher Lage er sich befand. Natürlich ließ er sofort Gas ausströmen, daß
der Ballon mit einer entsetzlichen Schnelligkeit sank. Der Ballon fül auf die
obern Zweige eines dichtbelaubten Baumes und der Aeronaut konnte jetzt den
Flammen entrinnen.
Bestellungen auf den Pfälzer Boten für die Monate Novbr.
und Dezember können bei allen Grosth. Postanstalten nnd Postboten
gemacht werden.
Zur Charakteristik der badischen Freiheit.
Aus Baden, 19. Okt.
Endlich doch wieder einmal ein Wörtchen, ein Luftzug von
Freiheit. Todtmüde scheint Alles bei uns darnieder zu liegen.
Kein Leben im Volke, kein Leben in der Negierung; wurde man
nicht durch die erhöhten Steuern und die vermehrten Soldaten
eines Andern belehrt, so könnte man glauben, daß der badische
Staat ein Staat ohne Negierung und ohne Volk sei: so einförmig,
so büreaukratisch erdrückt, so schulmeister- und korporalstockmäßig
langweilig schleppt sich unser sog. öffentliches Leben dahin. Selbst
die Agitationen unserer Ministerialräthe — Volksvertreter haben
sich beruhigt; der Schul- und Kicchenknochen, dieses treffliche
Mittel, ministerielles Wohlgefallen und Popularität nach Unten
mit einem Schlage zu erhaschen, ist beinahe vollständig abgenagt;
die unter administrativer Leitung entstandenen „Bürgerabenve"
schlafen allmälig wieder ein: dem Zusammentritte der Kreisver-
sammlungen sieht man wegen Stoffmangels mit Besorgniß ent-
gegen: kurz, Alles drängt zu jener Ruhe und Ergebung, welche
des guten Bürgers erste Pflicht ist. Mit Geld- und Menschen-
steuern reichlich beschenkt, opferwillig bis zum Exceß, fatalistisch
ergeben, fühlen wir uns reif zum — Eintritt in den Norddeut-
schen Bund. Alle ofsiciell und ofsiciös gestellten Bedingungen
haben wir erfüllt. Der vormalige Kriegsminister Ludwig konnte
nicht müde werden zu versichern, daß die Militärorganisation
wesentliche Voraussetzung zum Eintritte in den Norddeutschen
Bund sei — wir sind militärisch organisirt; Staatsmtnister Jollp
sprach von Bewaffnung bis an die Zähne, Gleichheit der Leistun-
gen, Opferwilligkeit — nur haben alle Erwartungen übertroffen;
der Abgeordnete Kiefer erklärte, daß uns das neue Schulgesetz
würdig machen werde für die Aufnahme in den Norddeutschen
Bund und tüchtig zu Schlachten L lu Königgrätz — wir sind in
den Besitz des Schulgesetzes gekommen; Professor Baumgarten end-
lich schrieb ein Buch über den Liberalismus unserer Z»eit, worin
er verlangt, daß der Liberalismus regierungsfähig und das Klein-
staatenhum vom „Staatsbewußtsein" durchdrungen werde. Nun,
wir haben uns auch in dieser Beziehung gebessert; unser National-
liberalismus ist außerordentlich regierungsfähig geworden; er
regiert, daß es eine wahre Freude ist; er kann nichts thun nach
Außen, er läßt Alles beim Alten im Innern; er ist äußerst liberal
im Bewilligen und Geben nach Unten; er versteht zu trennen, um
besser herrschen zu können; er schwärmt für die Einheit der Ge-
walt und schaudert vor der Freiheit. Was aber das Staatsbe-
wußtsein anbelangt, so sind wir dermaßen von demselben durch-
drungen, daß wir bei einer etwaigen politischen Weltausstellung
neben einem Russen oder Chinesen ganz gut zu paradiren ver-
mögen. Wir haben es gelernt, das „Ich", seine Interessen und
Anforderungen, der Allgewalt der „Staatsidee" zum Opfer zu
bringen. Was kann der Kathederschwindel noch mehr verlangen?
Aber trotz alledem treten wir nicht in den Norddeutschen Bund;
trotz alledem wollen sich alle Hoffnungen und Zusagen nicht er-
füllen; sind alle Opfer umsonst gebracht. Man weist auf das
Nichtzusammensein des Norddeutschen Reichstages hin, aber auch
der nächste Norddeutsche Reichstag wird uns nicht acceptiren; man
betont die Schwierigkeit mit Frankreich, allein eine Appellation
an die Furcht ist ja unstatthaft. So bleibt von allen Hinder-
nissen, auf welche man die Schuld an der eingetretenen nationa-
len Stagnation schieben mag, kein anderes übrig, als der immer
noch in Süddeutschland und auch in Baden vorhandene „freie
Geist", vor welchem der Norddeutsche Bund einige Besorgniß haben
soll. Leider sieht man sich indessen, wenigstens was Baden anbe-
langt, vergeblich nach Spuren desselben um, und wir waren daher
um so freudiger überrascht, als kürzlich die „Badische Landcszeitung"
uns eines Besseren belehrte, indem sie den „freien Geist" hervor-
hob, von dem mindestens ein Oberländer Amtsbezirk regiert wird.
Dort hat man es für gut gefunden, den Landescommissär in
höchst eigener Person in die Kreisversammlung zu wählen. Ver-
eine Berichterstatter fragt nun erstaunt: wie ein solches knechtisches
Gebühren bei dem freien Geiste des dortigen Oberamtmanns mög-
lich sei, während der andere daraus hindeutet, daß gerade diese
Wahl durch den Einfluß des freien, über den Parteien stehenden
Geistes des Oberamtmanns herbeigeführt worden sei. Die Sache
hat ihre bedenkliche Seite. Würde man an maßgebender Stelle
beim Norddeutschen Bunde erfahren, daß selbst unsere Oberamt-
männer, welche nach hergebrachter bureaukratischer Tradition nichts
Anderes sind und sein sollen als gefügige Werkzeuge in den Hän-
den des jeweiligen Ministers, auch von dem „freien Geiste" ange-
steckt sind, so könnte man daraus ein weiteres Argument gegen
unsere Würdigkeit zur Aufnahme in den Norddeutschen Bund ent-
nehmen. Glücklicherweise ist aus dem Angeführten das Doppel-
spiel deutlich ersichtlich, welches unsere neuärarische Bureaukratie
mit dem Worte „Freiheit" treibt oder treiben läßt, und wir
glauben deßhalb, daß man vor dem freien Geiste des betreffenden
Vermischtes.
(Aus Berlin.) Der ehemalige Cassendiener Stuart, welcher vor drei
Jahren bei der hiesigen königlichen Hauptbank den Diebstahl von 40,000 Thlr.
Banknoten verübte und dafür verurtheilt wurde, war kürzlich aus dem Gesäng-
niß entlassen worden. Seine Frau war während der Zeit gestorben und er
hatte seinen Sohn, der unterdeß bei den Großeltern in Neu-Ruppin gewesen,
wieder zu sich genommen. Da er sich aber wieder verheirathen wollte, war
ihm der Knabe unbequem; wahrscheinlich reizte auch das mütterliche Erbe des
Kindes seine Habgier und er beschloß, sich seiner durch Ermordung zu entledigen.
Er führte ihn deßhalb am Samstag Abend an den Schifffahrtscanal und hieß
ihn, — auf der einsamen Gegend der Köpeniker Brücke angekommen — dicht
an dem offenen Geländer sich bücken, um ein angeblich dort liegendes Zwei-
groschenstück aufzuheben. Als der Knabe ahnungslos gehorchte, stieß ihn der
unnatürliche Vater in den Canal und eilte fort, ohne sich um den Hülferuf
des Knaben zu kümmern. Nach etwa einer Stunde trat er am Landesberger
Thore in das Büreau des 19. Reviers und fragte den anwesenden Telegraphisten,
ob er nicht durch den Telegraphen Nachricht erhalten hätte, wo sich ein elf-
jähriger Knabe, sein Sohn, der ihm vor einigen Stunden auf unerklärliche
Weise verloren gegangen sei, aushalte. Der Telegraphist konnte ihm keine
Auskunft geben und entließ den Mörder. Doch kaum war dieser aus dem
Zimmer getreten, so brachte der Draht eine Depesche an alle Reviere, worin
die Mütheilung gemacht wurde, daß der Knabe Emil Stuart gerettet, der
Vater aber geflüchtet sei. Augenblicklich machte sich ein Schutzmann auf den
Weg und lief dem Verbrecher nach, holte ihn auch glücklicherweise noch ein und
transportirte ihn zur Wache zurück. Der Hilferufe des Kindes war glücklicher
Weise auf einem in der Nähe ankernden Schiffe ge'ört worden und es dem
Echiffsknecht Blödner mit einiger Gefahr gelungen, den schon Versinkenden
zu retten.
Ueber einen kürzlich vor der Kreisgerichts-Deputation in Danzig ver-
handelten Hexenprozeß berichtet die Danziger Zeitung: „Ein Bauer in
Jaschhütte brach bei einer Holzanfuhr ein Bein und glaubte in seinem leiden¬
den Zustande sich von einer Frau im Dorfe behext, die ihm ihren 25. Teufel
Namens Peter auf den Hals geschickt hätte. Sie wurde veranlaßt, in die
Wohnung des Besessenen zu gehen, und von den dort Anwesenden aufgefordert,
dem Behexten von ihrem Blute zu trinken zu geben, weil nur dann der Teufel
Peter den Besessenen verlassen würde. Auf Zureden erbot sich die herbeigeeilte
Frau in der Art dem Kranken zu helfen, daß sie sich mit einer Nadel die
Haut eines ihrer Arme aufritzen wolle, um Blut zu erhalten. Allein da die-
ses nach Ansicht der Anwesenden kein natürliches wäre, wurde sie von zweien
der Letztern gezwungen, durch Faustschläge sich das Blut aus der Nase ent-
locken zu lassen. Der Versuch schlug indessen fehl. Es wurde auf ein anderes
Mitel gedacht. Der eine der Thäter begab sich auf den Hofraum und besudelte
seine Hände mit Koth, während er gleichzeitig drei Kreuze in dieselben damit
machte. Neue Faustschlägen an die Nase mit den Händen hatten den erwünsch-
ten Erfolg. Nun wurde die angebliche Hexe gezwungen, sich über das Bett
des Besessenen zu legen und das Blut in dessen aufgesperrten Mund fließen
zu lassen. Derselbe äußerte: „Nu wat mi beeter." Das noch fließende Blut
wurde dann für etwaige Rückfälle in einer Taffe aufgefangen. Die so gemiß-
handelte Frau wandte sich an einen Danziger Arzt und beantragte darauf
Untersuchung. Die öffentliche Verhandlung fand, wie gesagt, vor einigen
Tagen statt. Auf den Antrag der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Per-
sonen, welche die Frau gemißhandlt, zu drei Monaten Gefängniß verurtheilt,
der „Besessene" jedoch sreigesprochen.
(Ein Luftschiffer am Verbrennen.) In Mexico, Staates
Misfouri, wäre ein Luftschiffer, ein Neuling in seiner Kunst, beinahe auf eine
fürchterliche Weise verunglückt. Während ein Neger mit der Erzeugung von
Gas beschäftigt war, wurde ein Theil des Oeles verschüttet und floß auf die
unterhalb des Sitzes des jungen Aeronauten befindliche Maschinerie, In dem-
selben Augenblicke, als der Ballon empor stieg, fing der Korb Feuer. Erst
als der Ballon schon sehr hoch gestiegen, entdeckte der junge Mann, in welch'
schrecklicher Lage er sich befand. Natürlich ließ er sofort Gas ausströmen, daß
der Ballon mit einer entsetzlichen Schnelligkeit sank. Der Ballon fül auf die
obern Zweige eines dichtbelaubten Baumes und der Aeronaut konnte jetzt den
Flammen entrinnen.