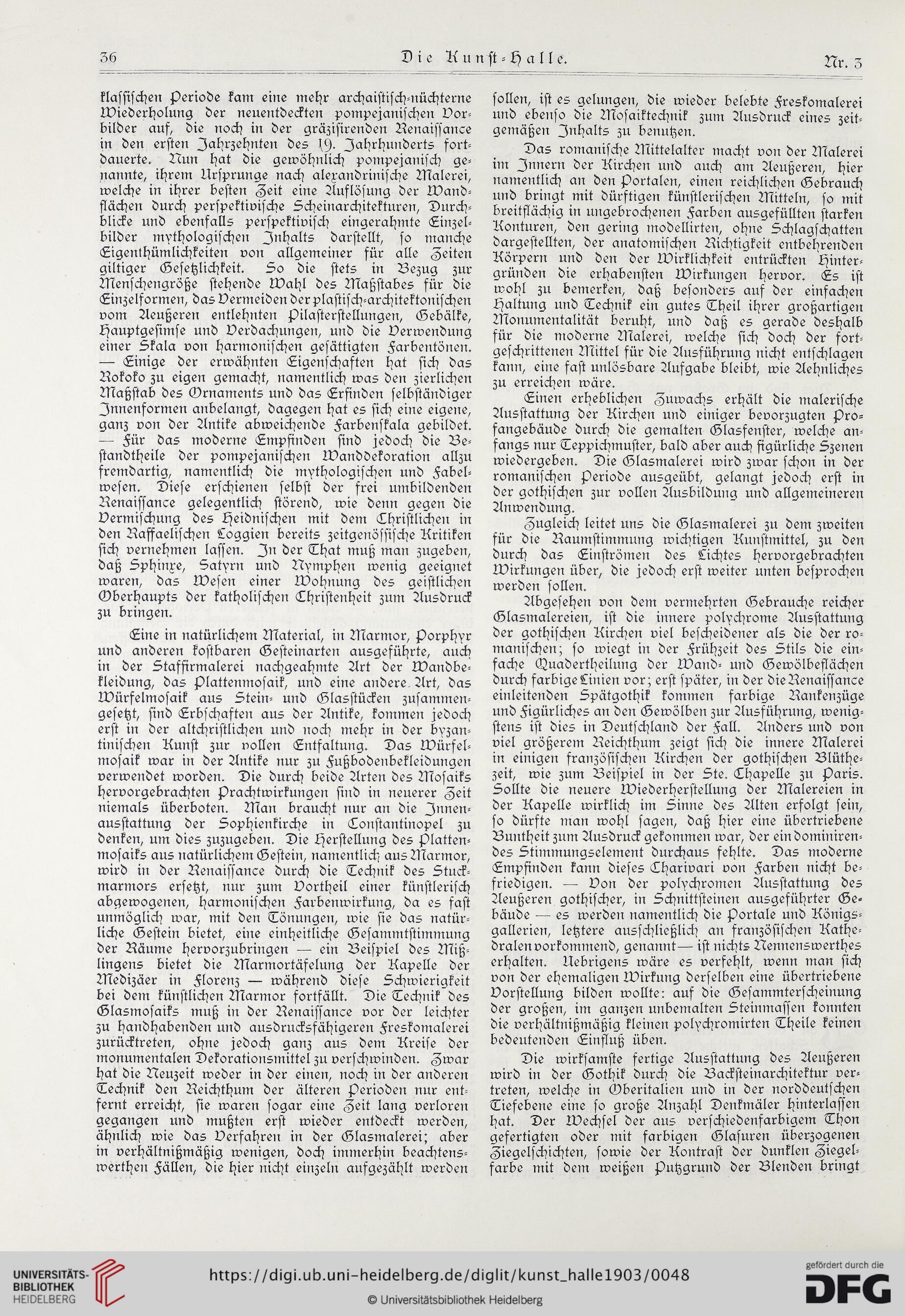36
Die Kunst-Halle.
Nr. 3
klassischen Periode kam eine mehr archaistisch-nüchterne
Wiederholung der neuentdeckten pompejanischen Vor-
bilder auf, die noch in der gräzisirenden Renaissance
in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts fort-
dauerte. Nun hat die gewöhnlich xompejanisch ge-
nannte, ihrem Ursprünge nach alexandrinische Malerei,
welche in ihrer besten Zeit eine Auflösung der Wand-
flächen durch perspektivische Scheinarchitekturen, Durch-
blicke und ebenfalls perspektivisch eingerahmte Einzel-
bilder mythologischen Inhalts darstellt, so manche
Ligenthümlichkeiten von allgemeiner für alle Zeiten
giltiger Gesetzlichkeit. So die stets in Bezug zur
Menschengröße stehende Wahl des Maßstabes für die
Linzelformen, das vermeiden der plastisch-architektonischen
vom Aeußeren entlehnten Pilasterstellungen, Gebälke,
Hauptgesimse und Verdachungen, und die Verwendung
einer Skala von harmonischen gesättigten Farbentönen.
— Einige der erwähnten Eigenschaften hat sich das
Rokoko zu eigen gemacht, namentlich was den zierlichen
Maßstab des Ornaments und das Erfinden selbständiger
Innenformen anbelangt, dagegen hat es sich eine eigene,
ganz von der Antike abweichende Farbenskala gebildet.
— Für das moderne Empfinden sind jedoch die Be-
standtheile der pompejanischen Wanddekoration allzu
fremdartig, namentlich die mythologischen und Fabel-
wesen. Diese erschienen selbst der frei umbildenden
Renaissance gelegentlich störend, wie denn gegen die
Vermischung des Heidnischen mit dem Christlichen in
den Naffaelischen Loggien bereits zeitgenössische Kritiken
sich vernehmen lassen. In der That muß man zugeben,
daß Sphinxe, Satyrn und Nymphen wenig geeignet
waren, das Wesen einer Wohnung des geistlichen
Oberhaupts der katholischen Christenheit zum Ausdruck
zu bringen.
Line in natürlichem Material, in Marmor, Porphyr
und anderen kostbaren Gesteinarten ausgeführte, auch
in der Staffirmalerei nachgeahmte Art der Wandbe-
kleidung, das Plattenmosaik, und eine andere Art, das
Würfelmosaik aus Stein- und Glasstücken zusammen-
gesetzt, sind Erbschaften aus der Antike, kommen jedoch
erst in der altchristlichen und noch mehr in der byzan-
tinischen Kunst zur vollen Entfaltung. Das Würfel-
mosaik war in der Antike nur zu Fußbodenbekleidungen
verwendet worden. Die durch beide Arten des Mosaiks
hervorgebrachten Prachtwirkungen sind in neuerer Zeit
niemals Überboten. Man braucht nur an die Innen-
ausstattung der Sophienkirche in Constantinopel zu
denken, um dies zuzugeben. Die Herstellung des platten-
mosaiks aus natürlichem Gestein, namentlich aus Marmor,
wird in der Renaissance durch die Technik des Stuck-
marmors ersetzt, nur zum vortheil einer künstlerisch
abgewogenen, harmonischen Farbenwirkung, da es fast
unmöglich war, mit den Tönungen, wie sie das natür-
liche Gestein bietet, eine einheitliche Gesammtstimmung
der Räume hervorzubringen — ein Beispiel des Miß-
lingens bietet die Marmortäfelung der Kapelle der
Medizäer in Florenz — während diese Schwierigkeit
bei dem künstlichen Marmor fortfällt. Die Technik des
Glasmosaiks muß in der Renaissance vor der leichter
zu handhabenden und ausdruckssähigeren Freskomalerei
zurücktreten, ohne jedoch ganz aus dem Kreise der
monumentalen Dekorationsmittel zu verschwinden. Zwar
hat die Neuzeit weder in der einen, noch in der anderen
Technik den Reichthum der älteren Perioden nur ent-
fernt erreicht, sie waren sogar eine Zeit lang verloren
gegangen und mußten erst wieder entdeckt werden,
ähnlich wie das Verfahren in der Glasmalerei; aber
in verhältnißmäßig wenigen, doch immerhin beachtens-
werthen Fällen, die hier nicht einzeln aufgezählt werden
sollen, ist es gelungen, die wieder belebte Freskomalerei
und ebenso die Mosaiktechnik zum Ausdruck eines zeit-
gemäßen Inhalts zu benutzen.
Das romanische Mittelalter macht von der Malerei
im Innern der Kirchen und auch am Aeußeren, hier
namentlich an den Portalen, einen reichlichen Gebrauch
und bringt mit dürftigen künstlerischen Mitteln, so mit
breitflächig in ungebrochenen Farben ausgefüllten starken
Konturen, den gering modellirten, ohne Schlagschatten
dargestellten, der anatomischen Richtigkeit entbehrenden
Körpern und den der Wirklichkeit entrückten Hinter-
gründen die erhabensten Wirkungen hervor. Ls ist
wohl zu bemerken, daß besonders auf der einfachen
Haltung und Technik ein gutes Theil ihrer großartigen
Monumentalität beruht, und daß es gerade deshalb
für die moderne Malerei, welche sich doch der fort-
geschrittenen Mittel für die Ausführung nicht entschlagen
kann, eine fast unlösbare Aufgabe bleibt, wie Aehnliches
zu erreichen wäre.
Linen erheblichen Zuwachs erhält die malerische
Ausstattung der Kirchen und einiger bevorzugten Pro-
fangebäude durch die gemalten Glasfenster, welche an-
fangs nur Teppichmuster, bald aber auch figürliche Szenen
wiedergeben. Die Glasmalerei wird zwar schon in der
romanischen Periode ausgeübt, gelangt jedoch erst in
der gothischen zur vollen Ausbildung und allgemeineren
Anwendung.
Zugleich leitet uns die Glasmalerei zu dem zweiten
für die Raumstimmung wichtigen Kunstmittel, zu den
durch das Linströmen des Lichtes hervorgebrachten
Wirkungen über, die jedoch erst weiter unten besprochen
werden sollen.
Abgesehen von dem vermehrten Gebrauche reicher
Glasmalereien, ist die innere polychrome Ausstattung
der gothischen Kirchen viel bescheidener als die der ro-
manischen; so wiegt in der Frühzeit des Stils die ein-
fache Ouadertheilung der wand- und Gewölbeflächen
durch farbige Linien vor; erst später, in der dieRenaissance
einleitenden Spätgothik kommen farbige Rankenzüge
und Figürliches an den Gewölben zur Ausführung, wenig-
stens ist dies in Deutschland der Fall. Anders und von
viel größerem Reichthum zeigt sich die innere Malerei
in einigen französischen Kirchen der gothischen Blüthe-
zeit, wie zum Beispiel in der Ste. Chapelle zu Paris.
Sollte die neuere Wiederherstellung der Malereien in
der Kapelle wirklich im Sinne des Alten erfolgt sein,
so dürfte man wohl sagen, daß hier eine übertriebene
Buntheit zum Ausdruck gekommen war, der eindominiren-
des Stimmungselement durchaus fehlte. Das moderne
Empfinden kann dieses Charivari von Farben nicht be-
friedigen. — von der polychromer: Ausstattung des
Aeußeren gothischer, in Schnittsteinen ausgeführter Ge-
bäude — es werden namentlich die Portale und Königs-
gallerien, letztere ausschließlich an französischen Kathe-
dralenvorkommend, genannt— ist nichts Nennenswerthes
erhalten. Uebrigens wäre es verfehlt, wenn man sich
von der ehemaligen Wirkung derselben eine übertriebene
Vorstellung bilden wollte: auf die Gesammterscheinung
der großen, im ganzen unbemalten Steinmassen konnten
die verhältnißmäßig kleinen polychromirten Theile keinen
bedeutenden Einfluß üben.
Die wirksamste fertige Ausstattung des Aeußeren
wird in der Gothik durch die Backsteinarchitektur ver-
treten, welche in Gberitalien und in der norddeutschen
Tiefebene eine so große Anzahl Denkmäler hinterlassen
hat. Der Wechsel der aus verschiedenfarbigem Thon
gefertigten oder mit farbigen Glasuren überzogenen
Ziegelschichten, sowie der Kontrast der dunklen Ziegel-
farbe mit dem weißen Putzgrund der Blenden bringt
Die Kunst-Halle.
Nr. 3
klassischen Periode kam eine mehr archaistisch-nüchterne
Wiederholung der neuentdeckten pompejanischen Vor-
bilder auf, die noch in der gräzisirenden Renaissance
in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts fort-
dauerte. Nun hat die gewöhnlich xompejanisch ge-
nannte, ihrem Ursprünge nach alexandrinische Malerei,
welche in ihrer besten Zeit eine Auflösung der Wand-
flächen durch perspektivische Scheinarchitekturen, Durch-
blicke und ebenfalls perspektivisch eingerahmte Einzel-
bilder mythologischen Inhalts darstellt, so manche
Ligenthümlichkeiten von allgemeiner für alle Zeiten
giltiger Gesetzlichkeit. So die stets in Bezug zur
Menschengröße stehende Wahl des Maßstabes für die
Linzelformen, das vermeiden der plastisch-architektonischen
vom Aeußeren entlehnten Pilasterstellungen, Gebälke,
Hauptgesimse und Verdachungen, und die Verwendung
einer Skala von harmonischen gesättigten Farbentönen.
— Einige der erwähnten Eigenschaften hat sich das
Rokoko zu eigen gemacht, namentlich was den zierlichen
Maßstab des Ornaments und das Erfinden selbständiger
Innenformen anbelangt, dagegen hat es sich eine eigene,
ganz von der Antike abweichende Farbenskala gebildet.
— Für das moderne Empfinden sind jedoch die Be-
standtheile der pompejanischen Wanddekoration allzu
fremdartig, namentlich die mythologischen und Fabel-
wesen. Diese erschienen selbst der frei umbildenden
Renaissance gelegentlich störend, wie denn gegen die
Vermischung des Heidnischen mit dem Christlichen in
den Naffaelischen Loggien bereits zeitgenössische Kritiken
sich vernehmen lassen. In der That muß man zugeben,
daß Sphinxe, Satyrn und Nymphen wenig geeignet
waren, das Wesen einer Wohnung des geistlichen
Oberhaupts der katholischen Christenheit zum Ausdruck
zu bringen.
Line in natürlichem Material, in Marmor, Porphyr
und anderen kostbaren Gesteinarten ausgeführte, auch
in der Staffirmalerei nachgeahmte Art der Wandbe-
kleidung, das Plattenmosaik, und eine andere Art, das
Würfelmosaik aus Stein- und Glasstücken zusammen-
gesetzt, sind Erbschaften aus der Antike, kommen jedoch
erst in der altchristlichen und noch mehr in der byzan-
tinischen Kunst zur vollen Entfaltung. Das Würfel-
mosaik war in der Antike nur zu Fußbodenbekleidungen
verwendet worden. Die durch beide Arten des Mosaiks
hervorgebrachten Prachtwirkungen sind in neuerer Zeit
niemals Überboten. Man braucht nur an die Innen-
ausstattung der Sophienkirche in Constantinopel zu
denken, um dies zuzugeben. Die Herstellung des platten-
mosaiks aus natürlichem Gestein, namentlich aus Marmor,
wird in der Renaissance durch die Technik des Stuck-
marmors ersetzt, nur zum vortheil einer künstlerisch
abgewogenen, harmonischen Farbenwirkung, da es fast
unmöglich war, mit den Tönungen, wie sie das natür-
liche Gestein bietet, eine einheitliche Gesammtstimmung
der Räume hervorzubringen — ein Beispiel des Miß-
lingens bietet die Marmortäfelung der Kapelle der
Medizäer in Florenz — während diese Schwierigkeit
bei dem künstlichen Marmor fortfällt. Die Technik des
Glasmosaiks muß in der Renaissance vor der leichter
zu handhabenden und ausdruckssähigeren Freskomalerei
zurücktreten, ohne jedoch ganz aus dem Kreise der
monumentalen Dekorationsmittel zu verschwinden. Zwar
hat die Neuzeit weder in der einen, noch in der anderen
Technik den Reichthum der älteren Perioden nur ent-
fernt erreicht, sie waren sogar eine Zeit lang verloren
gegangen und mußten erst wieder entdeckt werden,
ähnlich wie das Verfahren in der Glasmalerei; aber
in verhältnißmäßig wenigen, doch immerhin beachtens-
werthen Fällen, die hier nicht einzeln aufgezählt werden
sollen, ist es gelungen, die wieder belebte Freskomalerei
und ebenso die Mosaiktechnik zum Ausdruck eines zeit-
gemäßen Inhalts zu benutzen.
Das romanische Mittelalter macht von der Malerei
im Innern der Kirchen und auch am Aeußeren, hier
namentlich an den Portalen, einen reichlichen Gebrauch
und bringt mit dürftigen künstlerischen Mitteln, so mit
breitflächig in ungebrochenen Farben ausgefüllten starken
Konturen, den gering modellirten, ohne Schlagschatten
dargestellten, der anatomischen Richtigkeit entbehrenden
Körpern und den der Wirklichkeit entrückten Hinter-
gründen die erhabensten Wirkungen hervor. Ls ist
wohl zu bemerken, daß besonders auf der einfachen
Haltung und Technik ein gutes Theil ihrer großartigen
Monumentalität beruht, und daß es gerade deshalb
für die moderne Malerei, welche sich doch der fort-
geschrittenen Mittel für die Ausführung nicht entschlagen
kann, eine fast unlösbare Aufgabe bleibt, wie Aehnliches
zu erreichen wäre.
Linen erheblichen Zuwachs erhält die malerische
Ausstattung der Kirchen und einiger bevorzugten Pro-
fangebäude durch die gemalten Glasfenster, welche an-
fangs nur Teppichmuster, bald aber auch figürliche Szenen
wiedergeben. Die Glasmalerei wird zwar schon in der
romanischen Periode ausgeübt, gelangt jedoch erst in
der gothischen zur vollen Ausbildung und allgemeineren
Anwendung.
Zugleich leitet uns die Glasmalerei zu dem zweiten
für die Raumstimmung wichtigen Kunstmittel, zu den
durch das Linströmen des Lichtes hervorgebrachten
Wirkungen über, die jedoch erst weiter unten besprochen
werden sollen.
Abgesehen von dem vermehrten Gebrauche reicher
Glasmalereien, ist die innere polychrome Ausstattung
der gothischen Kirchen viel bescheidener als die der ro-
manischen; so wiegt in der Frühzeit des Stils die ein-
fache Ouadertheilung der wand- und Gewölbeflächen
durch farbige Linien vor; erst später, in der dieRenaissance
einleitenden Spätgothik kommen farbige Rankenzüge
und Figürliches an den Gewölben zur Ausführung, wenig-
stens ist dies in Deutschland der Fall. Anders und von
viel größerem Reichthum zeigt sich die innere Malerei
in einigen französischen Kirchen der gothischen Blüthe-
zeit, wie zum Beispiel in der Ste. Chapelle zu Paris.
Sollte die neuere Wiederherstellung der Malereien in
der Kapelle wirklich im Sinne des Alten erfolgt sein,
so dürfte man wohl sagen, daß hier eine übertriebene
Buntheit zum Ausdruck gekommen war, der eindominiren-
des Stimmungselement durchaus fehlte. Das moderne
Empfinden kann dieses Charivari von Farben nicht be-
friedigen. — von der polychromer: Ausstattung des
Aeußeren gothischer, in Schnittsteinen ausgeführter Ge-
bäude — es werden namentlich die Portale und Königs-
gallerien, letztere ausschließlich an französischen Kathe-
dralenvorkommend, genannt— ist nichts Nennenswerthes
erhalten. Uebrigens wäre es verfehlt, wenn man sich
von der ehemaligen Wirkung derselben eine übertriebene
Vorstellung bilden wollte: auf die Gesammterscheinung
der großen, im ganzen unbemalten Steinmassen konnten
die verhältnißmäßig kleinen polychromirten Theile keinen
bedeutenden Einfluß üben.
Die wirksamste fertige Ausstattung des Aeußeren
wird in der Gothik durch die Backsteinarchitektur ver-
treten, welche in Gberitalien und in der norddeutschen
Tiefebene eine so große Anzahl Denkmäler hinterlassen
hat. Der Wechsel der aus verschiedenfarbigem Thon
gefertigten oder mit farbigen Glasuren überzogenen
Ziegelschichten, sowie der Kontrast der dunklen Ziegel-
farbe mit dem weißen Putzgrund der Blenden bringt