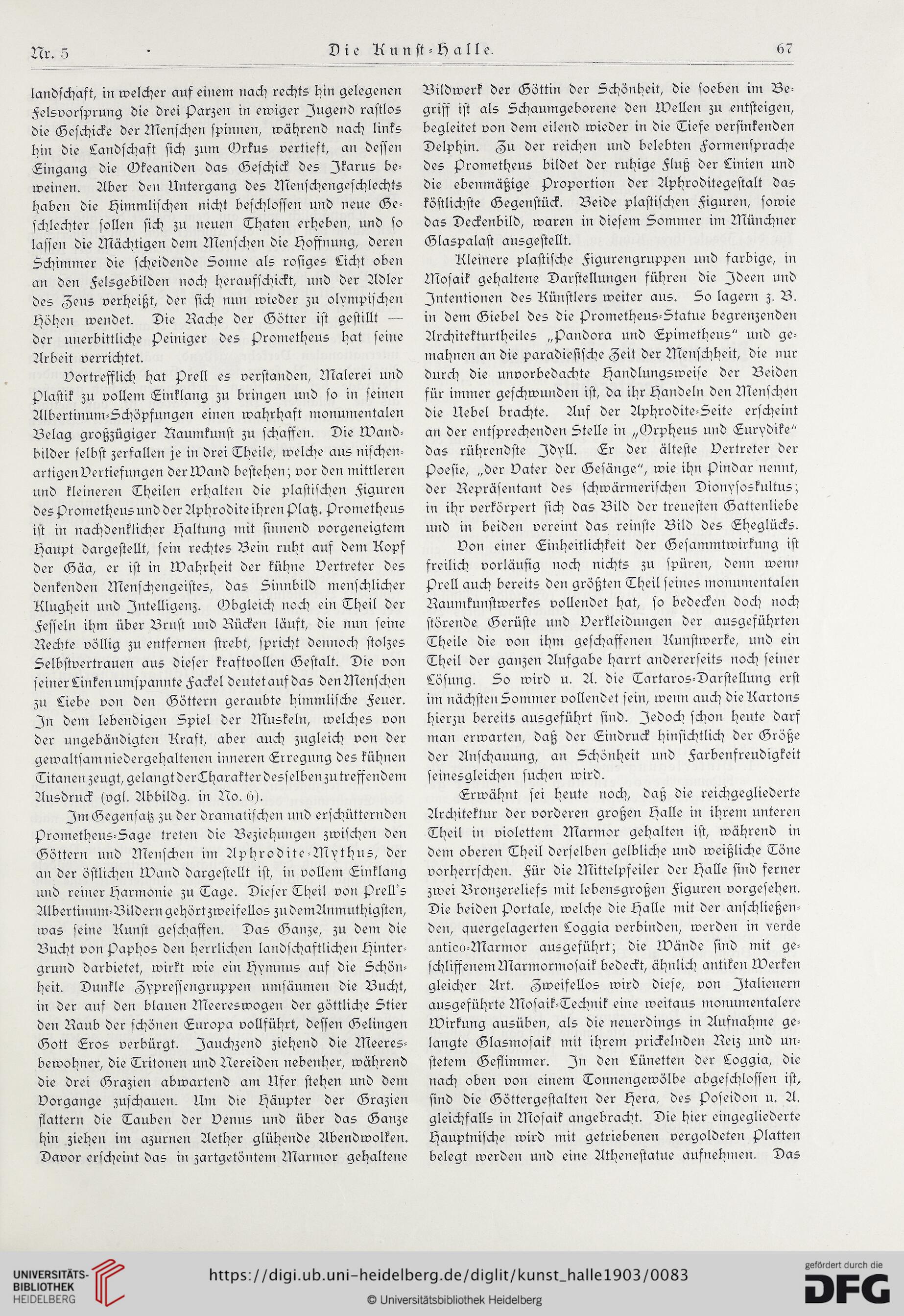Die Aun st-Halle.
Nr. 5
67
landschast, in welcher auf einem nach rechts hin gelegenen
Felsvorsprung die drei Parzen in ewiger Jugend rastlos
die Geschicke der Menschen spinnen, während nach links
hin die Landschast sich zum Orkus vertieft, an dessen
Eingang die Gkeaniden das Geschick des Ikarus be-
weinen. Aber den Untergang des Menschengeschlechts
haben die Himmlischen nicht beschlossen und neue Ge-
schlechter sollen sich zu neuen Thaten erheben, und so
lassen die Mächtigen dem Menschen die Hoffnung, deren
Schimmer die scheidende Sonne als rosiges Licht oben
an den Felsgebilden noch heraufschickt, und der Adler
des Zeus verheißt, der sich nun wieder zu olympischen
Höhen wendet. Die Nache der Götler ist gestillt —
der unerbittliche Peiniger des Prometheus hat seine
Arbeit verrichtet.
Vortrefflich hat prell es verstanden, Malerei und
Plastik zu vollem Einklang zu bringen und so in seinen
Albertinum-Schöpfungen einen wahrhaft monumentalen
Belag großzügiger Raumkunst zu schaffen. Die Wand-
bilder selbst zerfallen fe in drei Theile, welche aus nischen-
artigen Vertiefungen derMand bestehen; vor den mittleren
und kleineren Theilen erhalten die plastischen Figuren
des Prometheus und der Aphrodite ihren Platz. Prometheus
ist in nachdenklicher Haltung mit sinnend vorgeneigtem
Haupt dargestellt, sein rechtes Bein ruht auf dem Kopf
der Gäa, er ist in Wahrheit der kühne Vertreter des
denkenden Menschengeistes, das Sinnbild menschlicher
Klugheit und Intelligenz. Obgleich noch ein Theil der
Fesseln ihm über Brust und Rücken läuft, die nun seine
Rechte völlig zu entfernen strebt, spricht dennoch stolzes
Selbstvertrauen aus dieser kraftvollen Gestalt. Die von
seiner Linken umspannte Fackel deutet auf das den Menschen
zu Liebe von den Göttern geraubte himmliscbe Feuer.
In dem lebendigen Spiel der Muskeln, welches von
der ungebändigten Kraft, aber auch zugleich von der
gewaltsam niedergehaltenen inneren Erregung des kühnen
Titanen zeugt, gelangt derTharakter desselben zu treffendem
Ausdruck (vgl. Abbildg. in No. 6).
Im Gegensatz zu der dramatischen und erschütternden
Prometheus-Sage treten die Beziehungen zwischen den
Göttern und Menschen im Aphrodite-Mythus, der
an der östlichen Wand dargestellt ist, in vollem Einklang
und reiner Harmonie zu Tage. Dieser Theil von prell's
Albertinum-Bildern gehörtzweifellos zudemAnmuthigsten,
was seine Kunst geschaffen. Das Ganze, zu dem die
Bucht von Paphos den herrlichen landschaftlichen Hinter-
grund darbietet, wirkt wie ein Hymnus auf die Schön-
heit. Dunkle Zypressengruppen umsäumen die Bucht,
in der auf den blauen Meereswogen der göttliche Stier
den Raub der schönen Europa vollführt, dessen Gelingen
Gott Eros verbürgt. Jauchzend ziehend die Meeres-
bewohner, die Tritonen und Nereiden nebenher, während
die drei Grazien abwartend am Ufer stehen und dem
Vorgänge zuschauen. Um die Häupter der Grazien
flattern die Tauben der Venus und über das Ganze
hin ziehen im azurnen Aether glühende Abendwolken.
Davor erscheint das in zartgetöntem Marmor gehaltene
Bildwerk der Göttin der Schönheit, die soeben im Be-
griff ist als Schaumgeborene den Wellen zu entsteigen,
begleitet von dem eilend wieder in die Tiefe versinkenden
Delphin. Zu der reichen und belebten Formensprache
des Prometheus bildet der ruhige Fluß der Linien und
die ebenmäßige Proportion der Aphroditegestalt das
köstlichste Gegenstück. Beide plastischen Figuren, sowie
das Deckenbild, waren in diesem Sommer im Münchner
Glaspalast ausgestellt.
Kleinere plastische Figurengruppen und farbige, in
Mosaik gehaltene Darstellungen führen die Ideen und
Intentionen des Künstlers weiter aus. So lagern z. B.
in dem Giebel des die Prometheus-Statue begrenzenden
Architekturtheiles „Pandora und Lpimetheus" und ge-
mahnen an die paradiesische Zeit der Menschheit, die nur
durch die unvorbedachte Handlungsweise der Beiden
für immer geschwunden ist, da ihr Handeln den Menschen
die Nebel brachte. Auf der Aphrodite-Seite erscheint
an der entsprechenden Stelle in „Orpheus und Eurydike"
das rührendste Idyll. Er der älteste Vertreter der
Poesie, „der Vater der Gesänge", wie ihn pindar nennt,
der Repräsentant des schwärmerischen Dionysoskultus;
in ihr verkörpert sich das Bild der treuesten Gattenliebe
und in beiden vereint das reinste Bild des Eheglücks.
von einer Einheitlichkeit der Gesammtwirkung ist
freilich vorläufig noch nichts zu spüren, denn wenn
prell auch bereits den größter! Theil seines monumentalen
Raumkunstwerkes vollendet hat, so bedecken doch noch
störende Gerüste und Verkleidungen der ausgeführten
Theile die von ihm geschaffenen Kunstwerke, und ein
Theil der ganzen Aufgabe harrt andererseits noch seiner
Lösung. So wird u. A. die Tartaros-Darstellung erst
im nächsten Sommer vollendet sein, wenn auch die Kartons
hierzu bereits ausgeführt sind. Jedoch schon heute darf
man erwarten, daß der Eindruck hinsichtlich der Größe
der Anschauung, an Schönheit und Farbenfreudigkeit
seinesgleichen suchen wird.
Erwähnt sei heute noch, daß die reichgegliederte
Architektur der vorderen großen Halle in ihrem unteren
Theil in violettem Marmor gehalten ist, während in
dem oberen Theil derselben gelbliche und weißliche Töne
vorherrschen. Für die Mittelpfeiler der Halle sind ferner
zwei Bronzereliefs mit lebensgroßen Figuren vorgesehen.
Die beiden Portale, welche die Halle mit der anschließen-
den, quergelagerten Loggia verbinden, werden in vsräs
antieo-Marmor ausgeführt; die Wände sind mit ge-
schliffenem Marmormosaik bedeckt, ähnlich antiken Werken
gleicher Art. Zweifellos wird diese, von Italienern
ausgeführte Mosaik-Technik eine weitaus monumentalere
Wirkung ausüben, als die neuerdings in Aufnahme ge-
langte Glasmosaik mit ihrem prickelnden Reiz und un-
stetem Geflimmer. In den Lünetten der Loggia, die
nach oben von einem Tonnengewölbe abgeschlossen ist,
sind die Göttergestalten der Hera, des Poseidon u. A.
gleichfalls in Mosaik angebracht. Die hier eingegliederte
Hauptnische wird mit getriebenen vergoldeten Platten
belegt werden und eine Athenestatue aufnehmen. Das
Nr. 5
67
landschast, in welcher auf einem nach rechts hin gelegenen
Felsvorsprung die drei Parzen in ewiger Jugend rastlos
die Geschicke der Menschen spinnen, während nach links
hin die Landschast sich zum Orkus vertieft, an dessen
Eingang die Gkeaniden das Geschick des Ikarus be-
weinen. Aber den Untergang des Menschengeschlechts
haben die Himmlischen nicht beschlossen und neue Ge-
schlechter sollen sich zu neuen Thaten erheben, und so
lassen die Mächtigen dem Menschen die Hoffnung, deren
Schimmer die scheidende Sonne als rosiges Licht oben
an den Felsgebilden noch heraufschickt, und der Adler
des Zeus verheißt, der sich nun wieder zu olympischen
Höhen wendet. Die Nache der Götler ist gestillt —
der unerbittliche Peiniger des Prometheus hat seine
Arbeit verrichtet.
Vortrefflich hat prell es verstanden, Malerei und
Plastik zu vollem Einklang zu bringen und so in seinen
Albertinum-Schöpfungen einen wahrhaft monumentalen
Belag großzügiger Raumkunst zu schaffen. Die Wand-
bilder selbst zerfallen fe in drei Theile, welche aus nischen-
artigen Vertiefungen derMand bestehen; vor den mittleren
und kleineren Theilen erhalten die plastischen Figuren
des Prometheus und der Aphrodite ihren Platz. Prometheus
ist in nachdenklicher Haltung mit sinnend vorgeneigtem
Haupt dargestellt, sein rechtes Bein ruht auf dem Kopf
der Gäa, er ist in Wahrheit der kühne Vertreter des
denkenden Menschengeistes, das Sinnbild menschlicher
Klugheit und Intelligenz. Obgleich noch ein Theil der
Fesseln ihm über Brust und Rücken läuft, die nun seine
Rechte völlig zu entfernen strebt, spricht dennoch stolzes
Selbstvertrauen aus dieser kraftvollen Gestalt. Die von
seiner Linken umspannte Fackel deutet auf das den Menschen
zu Liebe von den Göttern geraubte himmliscbe Feuer.
In dem lebendigen Spiel der Muskeln, welches von
der ungebändigten Kraft, aber auch zugleich von der
gewaltsam niedergehaltenen inneren Erregung des kühnen
Titanen zeugt, gelangt derTharakter desselben zu treffendem
Ausdruck (vgl. Abbildg. in No. 6).
Im Gegensatz zu der dramatischen und erschütternden
Prometheus-Sage treten die Beziehungen zwischen den
Göttern und Menschen im Aphrodite-Mythus, der
an der östlichen Wand dargestellt ist, in vollem Einklang
und reiner Harmonie zu Tage. Dieser Theil von prell's
Albertinum-Bildern gehörtzweifellos zudemAnmuthigsten,
was seine Kunst geschaffen. Das Ganze, zu dem die
Bucht von Paphos den herrlichen landschaftlichen Hinter-
grund darbietet, wirkt wie ein Hymnus auf die Schön-
heit. Dunkle Zypressengruppen umsäumen die Bucht,
in der auf den blauen Meereswogen der göttliche Stier
den Raub der schönen Europa vollführt, dessen Gelingen
Gott Eros verbürgt. Jauchzend ziehend die Meeres-
bewohner, die Tritonen und Nereiden nebenher, während
die drei Grazien abwartend am Ufer stehen und dem
Vorgänge zuschauen. Um die Häupter der Grazien
flattern die Tauben der Venus und über das Ganze
hin ziehen im azurnen Aether glühende Abendwolken.
Davor erscheint das in zartgetöntem Marmor gehaltene
Bildwerk der Göttin der Schönheit, die soeben im Be-
griff ist als Schaumgeborene den Wellen zu entsteigen,
begleitet von dem eilend wieder in die Tiefe versinkenden
Delphin. Zu der reichen und belebten Formensprache
des Prometheus bildet der ruhige Fluß der Linien und
die ebenmäßige Proportion der Aphroditegestalt das
köstlichste Gegenstück. Beide plastischen Figuren, sowie
das Deckenbild, waren in diesem Sommer im Münchner
Glaspalast ausgestellt.
Kleinere plastische Figurengruppen und farbige, in
Mosaik gehaltene Darstellungen führen die Ideen und
Intentionen des Künstlers weiter aus. So lagern z. B.
in dem Giebel des die Prometheus-Statue begrenzenden
Architekturtheiles „Pandora und Lpimetheus" und ge-
mahnen an die paradiesische Zeit der Menschheit, die nur
durch die unvorbedachte Handlungsweise der Beiden
für immer geschwunden ist, da ihr Handeln den Menschen
die Nebel brachte. Auf der Aphrodite-Seite erscheint
an der entsprechenden Stelle in „Orpheus und Eurydike"
das rührendste Idyll. Er der älteste Vertreter der
Poesie, „der Vater der Gesänge", wie ihn pindar nennt,
der Repräsentant des schwärmerischen Dionysoskultus;
in ihr verkörpert sich das Bild der treuesten Gattenliebe
und in beiden vereint das reinste Bild des Eheglücks.
von einer Einheitlichkeit der Gesammtwirkung ist
freilich vorläufig noch nichts zu spüren, denn wenn
prell auch bereits den größter! Theil seines monumentalen
Raumkunstwerkes vollendet hat, so bedecken doch noch
störende Gerüste und Verkleidungen der ausgeführten
Theile die von ihm geschaffenen Kunstwerke, und ein
Theil der ganzen Aufgabe harrt andererseits noch seiner
Lösung. So wird u. A. die Tartaros-Darstellung erst
im nächsten Sommer vollendet sein, wenn auch die Kartons
hierzu bereits ausgeführt sind. Jedoch schon heute darf
man erwarten, daß der Eindruck hinsichtlich der Größe
der Anschauung, an Schönheit und Farbenfreudigkeit
seinesgleichen suchen wird.
Erwähnt sei heute noch, daß die reichgegliederte
Architektur der vorderen großen Halle in ihrem unteren
Theil in violettem Marmor gehalten ist, während in
dem oberen Theil derselben gelbliche und weißliche Töne
vorherrschen. Für die Mittelpfeiler der Halle sind ferner
zwei Bronzereliefs mit lebensgroßen Figuren vorgesehen.
Die beiden Portale, welche die Halle mit der anschließen-
den, quergelagerten Loggia verbinden, werden in vsräs
antieo-Marmor ausgeführt; die Wände sind mit ge-
schliffenem Marmormosaik bedeckt, ähnlich antiken Werken
gleicher Art. Zweifellos wird diese, von Italienern
ausgeführte Mosaik-Technik eine weitaus monumentalere
Wirkung ausüben, als die neuerdings in Aufnahme ge-
langte Glasmosaik mit ihrem prickelnden Reiz und un-
stetem Geflimmer. In den Lünetten der Loggia, die
nach oben von einem Tonnengewölbe abgeschlossen ist,
sind die Göttergestalten der Hera, des Poseidon u. A.
gleichfalls in Mosaik angebracht. Die hier eingegliederte
Hauptnische wird mit getriebenen vergoldeten Platten
belegt werden und eine Athenestatue aufnehmen. Das