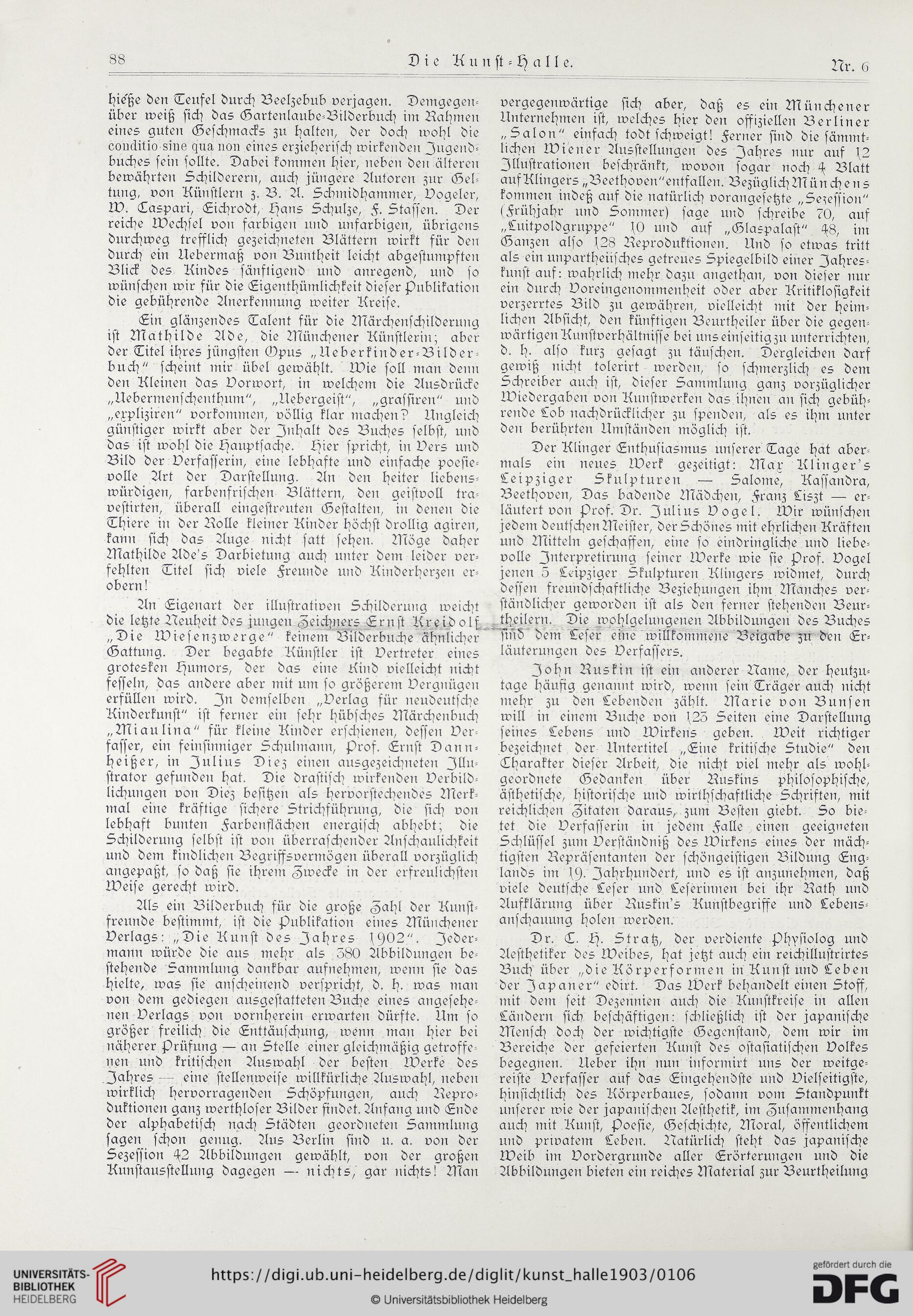Die Kunst-Halle.
88
Nr. 6
hieße den Teufel durch Beelzebub verjagen. Demgegen-
über weiß sich das Gartenlaube-Bilderbuch im Rahmen
eines guten Geschmacks zu halten, der doch wohl die
oonäitio sine MÄ non eines erzieherisch wirkenden Jugend-
buches sein sollte. Dabei kommen hier, neben den älteren
bewährten Schilderern, auch jüngere Autoren zur Gel-
tung, von Künstlern z. B. A. Schmidhammer, Vogeler,
W. Tasxari, Eichrodt, Hans Schulze, F. Stassen. Der
reiche wechsel von sarbigen und unsarbigen, übrigens
durchweg trefflich gezeichneten Blättern wirkt für den
durch ein Uehermaß von Buntheit leicht abgestumpften
Blick des Kindes sänftigend und anregend, und so
wünschen wir für die Eigentümlichkeit dieser Publikation
die gebührende Anerkennung weiter Kreise.
Lin glänzendes Talent für die Märchenschilderung
ist Mathilde Ade, die Münchener Künstlerin; aber
der Titel ihres jüngsten Opus „Ueberkinder-Bilder-
buch" scheint mir übel gewählt, wie soll man denn
den Kleinen das Vorwort, in welchem die Ausdrücke
„Uebermenschenthum", „Rebergeist", „grassiren" und
„expliziren" vorkommen, völlig klar machen? Ungleich
günstiger wirkt aber der Inhalt des Buches selbst, und
das ist wohl die Hauptsache. Hier spricht, in Vers und
Bild der Verfasserin, eine lebhafte und einfache poesie-
volle Art der Darstellung. An den heiter liebens-
würdigen, farbenfrischen Blättern, den geistvoll tra-
vestirten, überall eingestreuten Gestalten, in denen die
Thiere in der Rolle kleiner Kinder höchst drollig agiren,
kann sich das Auge nicht satt sehen. Möge daher
Mathilde Ade's Darbietung auch unter dein leider ver-
fehlten Titel sich viele Freunde und Kinderherzen er-
obern!
An Ligenart der illustrativen Schilderung weicht
die letzte Neuheit des jungen Zeichners Lrnst Kreid olf
„Die Wiesenzwerge" keinem Bilderbuchs ähnlicher
Gattung. Der begabte Künstler ist Vertreter eines
grotesken Humors, der das eine Kind vielleicht nicht
fesseln, das andere aber mit um so größerem Vergnügen
erfüllen wird. In demselben „Verlag für neudeutsche
Kinderkunst" ist ferner ein sehr hübsches Märchenbuch
„Miaulina" für kleine Kinder erschienen, dessen Ver-
fasser, ein feinsinniger Schulmann, Hros. Lrnst Dann-
heißer, in Julius Diez einen ausgezeichneten Illu-
strator gefunden hat. Die drastisch wirkenden Verbild-
lichungen von Diez besitzen als hervorstechendes Merk-
mal eine kräftige sichere Strichführung, die sich von
lebhaft bunten Farbenflächen energisch abhebt; die
Schilderung selbst ist von überraschender Anschaulichkeit
und dem kindlichen Begriffsvermögen überall vorzüglich
angepaßt, so daß sie ihrem Zwecke in der erfreulichsten
weise gerecht wird.
Als ein Bilderbuch sür die große Zahl der Kunst-
freunde bestimmt, ist die Publikation eines Münchener
Verlags: „Die Kunst des Jahres (s)02". Jeder-
mann würde die aus mehr als 380 Abbildungen be-
stehende Sammlung dankbar aufnehmen, wenn sie das
hielte, was sie anscheinend verspricht, d. h. was man
von dem gediegen ausgestatteten Buche eines angesehe-
nen Verlags von vornherein erwarten dürfte. Um so
größer freilich die Enttäuschung, wenn man hier bei
näherer Prüfung — an Stelle einer gleichmäßig getroffe-
nen und kritischen Auswahl der besten Werke des
Jahres — eine stellenweise willkürliche Auswahl, neben
wirklich hervorragenden Schöpfungen, auch Repro-
duktionen ganz werthloser Bilder findet. Anfang und Lnde
der alphabetisch nach Städten geordneten Sammlung
sagen schon genug. Aus Berlin sind u. a. von der
Sezession Abbildungen gewählt, von der großen
Kunstausstellung dagegen — nichts, gar nichts! Man
vergegenwärtige sich aber, daß es ein Münchener
Unternehmen ist, welches hier den offiziellen Berliner
„Salon" einfach todt schweigt! Ferner sind die sämmt-
lichen wiener Ausstellungen des Jahres nur auf (2
Illustrationen beschränk, wovon sogar noch Blatt
aufKlingers „Beethoven"entfallen. Bezüglich Münchens
kommen indeß auf die natürlich vorangesetzte „Sezession"
(Frühjahr und Sommer) sage und schreibe 70, auf
„Luitpoldgruppe" (0 und auf „Glasxalast" fl8, im
Ganzen also (28 Reproduktionen. Und so etwas tritt
als ein unpartheiisches getreues Spiegelbild einer Jahres-
kunst auf: wahrlich mehr dazu angethan, von dieser nur
ein durch Voreingenommenheit oder aber Kritiklosigkeit
verzerrtes Bild zu gewähren, vielleicht mit der heim-
lichen Absicht, den künftigen Beurtheiler über die gegen-
wärtigen Kunstverhältnisse bei uns einseitig zu unterrichten,
d. h. also kurz gesagt zu täuschen. Dergleichen darf
gewiß nicht tolerirt werden, so schmerzlich es dem
Schreiber auch ist, dieser Sammlung ganz vorzüglicher
Wiedergaben von Kunstwerken das ihnen an sich gebüh-
rende Lob nachdrücklicher zu spenden, als es ihm unter
den berührten Umständen möglich ist.
Der Klinger Enthusiasmus unserer Tage hat aber-
mals ein neues Werk gezeitigt: Max Klinger's
Leipziger Skulpturen — Salome, Kassandra,
Beethoven, Das badende Mädchen, Franz Liszt — er-
läutert von Hrof. Dr. Julius Vogel, wir wünschen
jedem deutschen Meister, der Schönes mit ehrlichen Kräften
und Mitteln geschaffen, eine so eindringliche und liebe-
volle Interpretirung seiner Werke wie sie Hrof. Vogel
jenen 5 Leipziger Skulpturen Klingers widmet, durch
dessen freundschaftliche Beziehungen ihm Manches ver-
ständlicher geworden ist als den ferner stehenden Beur-
theilern. Die wohlgelungenen Abbildungen des Buches
find dem Leser eine willkommene Beigabe zu den Er-
läuterungen des Verfassers.
John Ruskin ist ein anderer Name, der heutzu-
tage häufig genannt wird, wenn sein Träger auch nicht
mehr zu den Lebenden zählt. Marie von Bunsen
will in einem Buche von (23 Seiten eine Darstellung
seines Lebens und Wirkens geben, weit richtiger
bezeichnet der Untertitel „Line kritische Studie" den
Charakter dieser Arbeit, die nicht viel mehr als wohl-
geordnete Gedanken über Ruskins philosophische,
ästhetische, historische und wirthschaftliche Schriften, mit
reichlichen Zitaten daraus, zum Besten giebt. So bie-
tet die Verfasserin in jedem Falle einen geeigneten
Schlüssel zum verständniß des wirkens eines der mäch-
tigsten Repräsentanten der schöngeistigen Bildung Eng-
lands im (s). Jahrhundert, und es ist anzunehmen, daß
viele deutsche Leser und Leserinnen bei ihr Rath und
Aufklärung über Ruskin's Kunstbegriffe und Lebens-
anschauung holen werden.
Dr. T. H. Stratz, der verdiente Hhxsiolog und
Aesthetiker des Weibes, hat jetzt auch ein reichillustrirtes
Buch über „die Körperformen in Kunst und Leben
der Japaner" edirt. Das Werk behandelt einen Stoff,
mit dein seit Dezennien auch die Kunstkreise in allen
Ländern sich beschäftigen: schließlich ist der japanische
Mensch doch der wichtigste Gegenstand, dem wir im
Bereiche der gefeierten Kunst des ostasiatischen Volkes
begegnen, bleber ihn nun informirt uns der weitge-
reiste Verfasser auf das Eingehendste und vielseitigste,
hinsichtlich des Körperbaues, sodann vom Standpunkt
unserer wie der japanischen Aesthetik, im Zusammenhang
auch mit Kunst, Hoesie, Geschichte, Moral, öffentlichem
und privatem Leben. Natürlich steht das japanische
Weib im Vordergründe aller Erörterungen und die
Abbildungen bieten ein reiches Material zur Beurtheilung
88
Nr. 6
hieße den Teufel durch Beelzebub verjagen. Demgegen-
über weiß sich das Gartenlaube-Bilderbuch im Rahmen
eines guten Geschmacks zu halten, der doch wohl die
oonäitio sine MÄ non eines erzieherisch wirkenden Jugend-
buches sein sollte. Dabei kommen hier, neben den älteren
bewährten Schilderern, auch jüngere Autoren zur Gel-
tung, von Künstlern z. B. A. Schmidhammer, Vogeler,
W. Tasxari, Eichrodt, Hans Schulze, F. Stassen. Der
reiche wechsel von sarbigen und unsarbigen, übrigens
durchweg trefflich gezeichneten Blättern wirkt für den
durch ein Uehermaß von Buntheit leicht abgestumpften
Blick des Kindes sänftigend und anregend, und so
wünschen wir für die Eigentümlichkeit dieser Publikation
die gebührende Anerkennung weiter Kreise.
Lin glänzendes Talent für die Märchenschilderung
ist Mathilde Ade, die Münchener Künstlerin; aber
der Titel ihres jüngsten Opus „Ueberkinder-Bilder-
buch" scheint mir übel gewählt, wie soll man denn
den Kleinen das Vorwort, in welchem die Ausdrücke
„Uebermenschenthum", „Rebergeist", „grassiren" und
„expliziren" vorkommen, völlig klar machen? Ungleich
günstiger wirkt aber der Inhalt des Buches selbst, und
das ist wohl die Hauptsache. Hier spricht, in Vers und
Bild der Verfasserin, eine lebhafte und einfache poesie-
volle Art der Darstellung. An den heiter liebens-
würdigen, farbenfrischen Blättern, den geistvoll tra-
vestirten, überall eingestreuten Gestalten, in denen die
Thiere in der Rolle kleiner Kinder höchst drollig agiren,
kann sich das Auge nicht satt sehen. Möge daher
Mathilde Ade's Darbietung auch unter dein leider ver-
fehlten Titel sich viele Freunde und Kinderherzen er-
obern!
An Ligenart der illustrativen Schilderung weicht
die letzte Neuheit des jungen Zeichners Lrnst Kreid olf
„Die Wiesenzwerge" keinem Bilderbuchs ähnlicher
Gattung. Der begabte Künstler ist Vertreter eines
grotesken Humors, der das eine Kind vielleicht nicht
fesseln, das andere aber mit um so größerem Vergnügen
erfüllen wird. In demselben „Verlag für neudeutsche
Kinderkunst" ist ferner ein sehr hübsches Märchenbuch
„Miaulina" für kleine Kinder erschienen, dessen Ver-
fasser, ein feinsinniger Schulmann, Hros. Lrnst Dann-
heißer, in Julius Diez einen ausgezeichneten Illu-
strator gefunden hat. Die drastisch wirkenden Verbild-
lichungen von Diez besitzen als hervorstechendes Merk-
mal eine kräftige sichere Strichführung, die sich von
lebhaft bunten Farbenflächen energisch abhebt; die
Schilderung selbst ist von überraschender Anschaulichkeit
und dem kindlichen Begriffsvermögen überall vorzüglich
angepaßt, so daß sie ihrem Zwecke in der erfreulichsten
weise gerecht wird.
Als ein Bilderbuch sür die große Zahl der Kunst-
freunde bestimmt, ist die Publikation eines Münchener
Verlags: „Die Kunst des Jahres (s)02". Jeder-
mann würde die aus mehr als 380 Abbildungen be-
stehende Sammlung dankbar aufnehmen, wenn sie das
hielte, was sie anscheinend verspricht, d. h. was man
von dem gediegen ausgestatteten Buche eines angesehe-
nen Verlags von vornherein erwarten dürfte. Um so
größer freilich die Enttäuschung, wenn man hier bei
näherer Prüfung — an Stelle einer gleichmäßig getroffe-
nen und kritischen Auswahl der besten Werke des
Jahres — eine stellenweise willkürliche Auswahl, neben
wirklich hervorragenden Schöpfungen, auch Repro-
duktionen ganz werthloser Bilder findet. Anfang und Lnde
der alphabetisch nach Städten geordneten Sammlung
sagen schon genug. Aus Berlin sind u. a. von der
Sezession Abbildungen gewählt, von der großen
Kunstausstellung dagegen — nichts, gar nichts! Man
vergegenwärtige sich aber, daß es ein Münchener
Unternehmen ist, welches hier den offiziellen Berliner
„Salon" einfach todt schweigt! Ferner sind die sämmt-
lichen wiener Ausstellungen des Jahres nur auf (2
Illustrationen beschränk, wovon sogar noch Blatt
aufKlingers „Beethoven"entfallen. Bezüglich Münchens
kommen indeß auf die natürlich vorangesetzte „Sezession"
(Frühjahr und Sommer) sage und schreibe 70, auf
„Luitpoldgruppe" (0 und auf „Glasxalast" fl8, im
Ganzen also (28 Reproduktionen. Und so etwas tritt
als ein unpartheiisches getreues Spiegelbild einer Jahres-
kunst auf: wahrlich mehr dazu angethan, von dieser nur
ein durch Voreingenommenheit oder aber Kritiklosigkeit
verzerrtes Bild zu gewähren, vielleicht mit der heim-
lichen Absicht, den künftigen Beurtheiler über die gegen-
wärtigen Kunstverhältnisse bei uns einseitig zu unterrichten,
d. h. also kurz gesagt zu täuschen. Dergleichen darf
gewiß nicht tolerirt werden, so schmerzlich es dem
Schreiber auch ist, dieser Sammlung ganz vorzüglicher
Wiedergaben von Kunstwerken das ihnen an sich gebüh-
rende Lob nachdrücklicher zu spenden, als es ihm unter
den berührten Umständen möglich ist.
Der Klinger Enthusiasmus unserer Tage hat aber-
mals ein neues Werk gezeitigt: Max Klinger's
Leipziger Skulpturen — Salome, Kassandra,
Beethoven, Das badende Mädchen, Franz Liszt — er-
läutert von Hrof. Dr. Julius Vogel, wir wünschen
jedem deutschen Meister, der Schönes mit ehrlichen Kräften
und Mitteln geschaffen, eine so eindringliche und liebe-
volle Interpretirung seiner Werke wie sie Hrof. Vogel
jenen 5 Leipziger Skulpturen Klingers widmet, durch
dessen freundschaftliche Beziehungen ihm Manches ver-
ständlicher geworden ist als den ferner stehenden Beur-
theilern. Die wohlgelungenen Abbildungen des Buches
find dem Leser eine willkommene Beigabe zu den Er-
läuterungen des Verfassers.
John Ruskin ist ein anderer Name, der heutzu-
tage häufig genannt wird, wenn sein Träger auch nicht
mehr zu den Lebenden zählt. Marie von Bunsen
will in einem Buche von (23 Seiten eine Darstellung
seines Lebens und Wirkens geben, weit richtiger
bezeichnet der Untertitel „Line kritische Studie" den
Charakter dieser Arbeit, die nicht viel mehr als wohl-
geordnete Gedanken über Ruskins philosophische,
ästhetische, historische und wirthschaftliche Schriften, mit
reichlichen Zitaten daraus, zum Besten giebt. So bie-
tet die Verfasserin in jedem Falle einen geeigneten
Schlüssel zum verständniß des wirkens eines der mäch-
tigsten Repräsentanten der schöngeistigen Bildung Eng-
lands im (s). Jahrhundert, und es ist anzunehmen, daß
viele deutsche Leser und Leserinnen bei ihr Rath und
Aufklärung über Ruskin's Kunstbegriffe und Lebens-
anschauung holen werden.
Dr. T. H. Stratz, der verdiente Hhxsiolog und
Aesthetiker des Weibes, hat jetzt auch ein reichillustrirtes
Buch über „die Körperformen in Kunst und Leben
der Japaner" edirt. Das Werk behandelt einen Stoff,
mit dein seit Dezennien auch die Kunstkreise in allen
Ländern sich beschäftigen: schließlich ist der japanische
Mensch doch der wichtigste Gegenstand, dem wir im
Bereiche der gefeierten Kunst des ostasiatischen Volkes
begegnen, bleber ihn nun informirt uns der weitge-
reiste Verfasser auf das Eingehendste und vielseitigste,
hinsichtlich des Körperbaues, sodann vom Standpunkt
unserer wie der japanischen Aesthetik, im Zusammenhang
auch mit Kunst, Hoesie, Geschichte, Moral, öffentlichem
und privatem Leben. Natürlich steht das japanische
Weib im Vordergründe aller Erörterungen und die
Abbildungen bieten ein reiches Material zur Beurtheilung