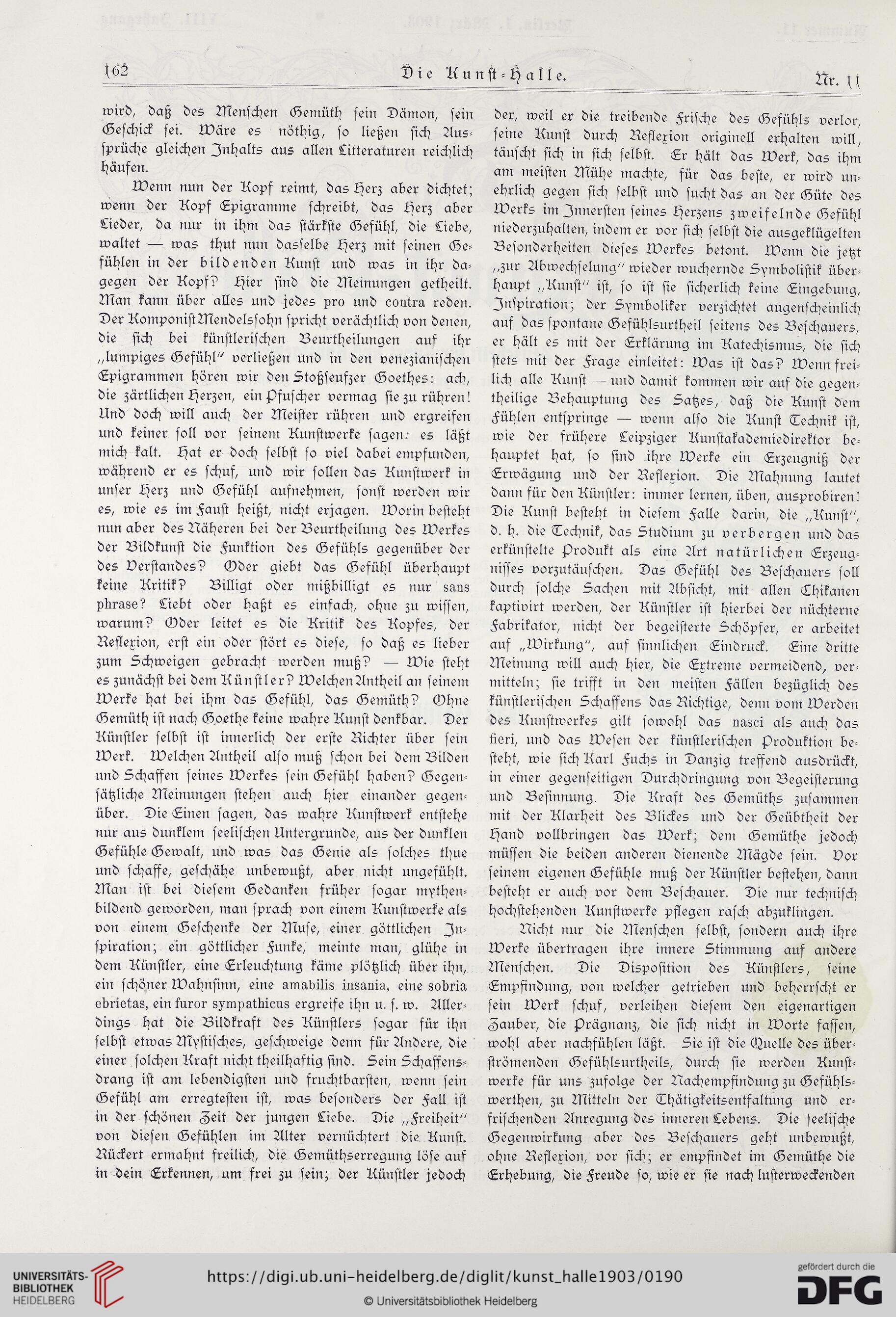^62 Die Aunst - Halle.
wird, daß des Menschen Gemüth sein Dämon, sein
Geschick sei. wäre es nöthig, so ließen sich Aus-
sprüche gleichen Inhalts aus allen Litteraturen reichlich
häufen.
Wenn nun der Kopf reimt, das Herz aber dichtet;
wenn der Kopf Epigramme schreibt, das Herz aber
Lieder, da nur in ihm das stärkste Gefühl, die Liebe,
waltet — was thut nun dasselbe Herz mit seinen Ge-
fühlen in der bildenden Kunst und was in ihr da-
gegen der Kopf? Hier ^d die Meinungen getheilt.
Man kann über alles und jedes pro und eontra reden.
Der KomponistMendelssohn spricht verächtlich von denen,
die sich bei künstlerischen Beurtheilungen auf ihr
„lumpiges Gefühl" verließen und in den venezianischen
Epigrammen hören wir den Stoßseufzer Goethes: ach,
die zärtlichen L^rzen, ein Pfuscher vermag sie zu rühren!
Und doch will auch der Meister rühren und ergreifen
und keiner soll vor seinem Kunstwerke sagen.- es läßt
mich kalt. Hat er doch selbst so viel dabei empfunden,
während er es schuf, und wir sollen das Kunstwerk in
unser Herz und Gefühl aufnehmen, sonst werden wir
es, wie es im Laust heißt, nicht erjagen. Worin besteht
nun aber des Näheren bei der Beurtheilung des Werkes
der Bildkunst die Funktion des Gefühls gegenüber der
des Verstandes? Oder giebt das Gefühl überhaupt
keine Kritik? Billigt oder mißbilligt es nur 8LN8
pllrg,86? Liebt oder haßt es einfach, ohne zu wissen,
warum? Oder leitet es die Kritik des Kopfes, der
Reflexion, erst ein oder stört es diese, so daß es lieber
zum Schweigen gebracht werden muß? — Wie steht
es zunächst bei dem Künstler? welchenAntheil an seinem
Werke hat bei ihm das Gefühl, das Gemüth? Ohne
Gemüth ist nach Goethe keine wahre Kunst denkbar. Der
Künstler selbst ist innerlich der erste Richter über sein
Werk. Welchen Antheil also muß schon bei dem Bilden
und Schaffen seines Werkes sein Gefühl haben? Gegen-
sätzliche Meinungen stehen auch hier einander gegen-
über. Die Einen sagen, das wahre Kunstwerk entstehe
nur aus dunklem seelischen Untergründe, aus der dunklen
Gefühle Gewalt, und was das Genie als solches thue
und schaffe, geschähe unbewußt, aber nicht ungefühlt.
Man ist bei diesem Gedanken früher sogar mythen-
bildend geworden, man sprach von einem Kunstwerke als
von einem Geschenke der Muse, einer göttlichen In-
spiration; ein göttlicher Funke, meinte man, glühe in
dem Künstler, eine Erleuchtung käme plötzlich über ihn,
ein schöner Wahnsinn, eine anmblli8 in8Lmm, eine 8obriL
odriotLZ, ein kuror 8ympatlncm8 ergreife ihn u. s. w. Aller-
dings hat die Bildkraft des Künstlers sogar für ihn
selbst etwas Mystisches, geschweige denn für Andere, die
einer solchen Kraft nicht theilhaftig sind. Sein Schaffens-
drang ist am lebendigsten und fruchtbarsten, wenn sein
Gefühl am erregtesten ist, was besonders der Fall ist
in der schönen Zeit der jungen Liebe. Die „Freiheit"
von diesen Gefühlen im Alter »ernüchtert die Kunst.
Rückert ermahnt freilich, die Gemüthserregung läse auf
in dein Erkennen, um frei zu sein; der Künstler jedoch
der, weil er die treibende Frische des Gefühls verlor,
seine Kunst durch Reflexion originell erhalten will,
täuscht sich in sich selbst. Er hält das Werk, das ihm
am meisten Mühe machte, für das beste, er wird un-
ehrlich gegen sich selbst und sucht das an der Güte des
Werks im Innersten seines Herzens zweifelnde Gefühl
niederzuhalten, indem er vor sich selbst die ausgeklügelten
Besonderheiten dieses Werkes betont, wenn die jetzt
„zur Abwechselung" wieder wuchernde Symbolistik über-
haupt „Kunst" ist, so ist sie sicherlich keine Eingebung,
Inspiration; der Symboliker verzichtet augenscheinlich
auf das spontane Gefühlsurtheil seitens des Beschauers,
er hält es mit der Erklärung im Katechismus, die sich
stets mit der Frage einleitet: was ist das? wenn frei-
lich alle Kunst — und damit kommen wir auf die gegen-
teilige Behauptung des Satzes, daß die Kunst dem
Fühlen entspringe — wenn also die Kunst Technik ist,
wie der frühere Leipziger Kunstakademiedirektor be-
hauptet hat, so sind ihre Werke ein Lrzeugniß der
Erwägung und der Reflexion. Die Mahnung lautet
dann für den Künstler: immer lernen, üben, ausprobiren!
Die Kunst besteht in diesem Falle darin, die „Kunst",
d. h. die Technik, das Studium zu verbergen und das
erkünstelte Produkt als eine Art natürlichen Erzeug-
nisses vorzutäuschen. Das Gefühl des Beschauers soll
durch solche Sachen mit Absicht, mit allen Thikanen
kaptivirt werden, der Künstler ist hierbei der nüchterne
Fabrikator, nicht der begeisterte Schöpser, er arbeitet
auf „Wirkung", auf sinnlichen Eindruck. Line dritte
Meinung will auch hier, die Extreme vermeidend, ver-
mitteln; sie trifft in den meisten Fällen bezüglich des
künstlerischen Schaffens das Richtige, denn vom werden
des Kunstwerkes gilt sowohl das nL86l als auch das
tiorl, und das Wesen der künstlerischen Produktion be-
steht, wie sich Karl Fuchs in Danzig treffend ausdrückt,
in einer gegenseitigen Durchdringung von Begeisterung
und Besinnung. Die Kraft des Gemüths zusammen
mit der Klarheit des Blickes und der Geübtheit der
Hand vollbringen das Werk; dem Gemüthe jedoch
müssen die beiden anderen dienende Mägde sein. Vor
seinem eigenen Gefühle muß der Künstler bestehen, dann
besteht er auch vor dem Beschauer. Die nur technisch
hochstehenden Kunstwerke pflegen rasch abzuklingen.
Nicht nur die Menschen selbst, sondern auch ihre
Werke übertragen ihre innere Stimmung auf andere
Menschen. Die Disposition des Künstlers, seine
Empfindung, von welcher getrieben und beherrscht er
sein Werk schuf, verleihen diesem den eigenartigen
Zauber, die Prägnanz, die sich nicht in Worte fassen,
wohl aber nachfühlen läßt. Sie ist die (Quelle des über-
strömenden Gefühlsurtheils, durch sie werden Kunst-
werke für uns zufolge der Nachempfindung zu Gefühls-
werthen, zu Mitteln der Thätigkeitsentfaltung und er-
frischenden Anregung des inneren Lebens. Die seelische
Gegenwirkung aber des Beschauers geht unbewußt,
ohne Reflexion, vor sich; er empfindet im Gemüthe die
Erhebung, die Freude so, wie er sie nach lusterweckenden
wird, daß des Menschen Gemüth sein Dämon, sein
Geschick sei. wäre es nöthig, so ließen sich Aus-
sprüche gleichen Inhalts aus allen Litteraturen reichlich
häufen.
Wenn nun der Kopf reimt, das Herz aber dichtet;
wenn der Kopf Epigramme schreibt, das Herz aber
Lieder, da nur in ihm das stärkste Gefühl, die Liebe,
waltet — was thut nun dasselbe Herz mit seinen Ge-
fühlen in der bildenden Kunst und was in ihr da-
gegen der Kopf? Hier ^d die Meinungen getheilt.
Man kann über alles und jedes pro und eontra reden.
Der KomponistMendelssohn spricht verächtlich von denen,
die sich bei künstlerischen Beurtheilungen auf ihr
„lumpiges Gefühl" verließen und in den venezianischen
Epigrammen hören wir den Stoßseufzer Goethes: ach,
die zärtlichen L^rzen, ein Pfuscher vermag sie zu rühren!
Und doch will auch der Meister rühren und ergreifen
und keiner soll vor seinem Kunstwerke sagen.- es läßt
mich kalt. Hat er doch selbst so viel dabei empfunden,
während er es schuf, und wir sollen das Kunstwerk in
unser Herz und Gefühl aufnehmen, sonst werden wir
es, wie es im Laust heißt, nicht erjagen. Worin besteht
nun aber des Näheren bei der Beurtheilung des Werkes
der Bildkunst die Funktion des Gefühls gegenüber der
des Verstandes? Oder giebt das Gefühl überhaupt
keine Kritik? Billigt oder mißbilligt es nur 8LN8
pllrg,86? Liebt oder haßt es einfach, ohne zu wissen,
warum? Oder leitet es die Kritik des Kopfes, der
Reflexion, erst ein oder stört es diese, so daß es lieber
zum Schweigen gebracht werden muß? — Wie steht
es zunächst bei dem Künstler? welchenAntheil an seinem
Werke hat bei ihm das Gefühl, das Gemüth? Ohne
Gemüth ist nach Goethe keine wahre Kunst denkbar. Der
Künstler selbst ist innerlich der erste Richter über sein
Werk. Welchen Antheil also muß schon bei dem Bilden
und Schaffen seines Werkes sein Gefühl haben? Gegen-
sätzliche Meinungen stehen auch hier einander gegen-
über. Die Einen sagen, das wahre Kunstwerk entstehe
nur aus dunklem seelischen Untergründe, aus der dunklen
Gefühle Gewalt, und was das Genie als solches thue
und schaffe, geschähe unbewußt, aber nicht ungefühlt.
Man ist bei diesem Gedanken früher sogar mythen-
bildend geworden, man sprach von einem Kunstwerke als
von einem Geschenke der Muse, einer göttlichen In-
spiration; ein göttlicher Funke, meinte man, glühe in
dem Künstler, eine Erleuchtung käme plötzlich über ihn,
ein schöner Wahnsinn, eine anmblli8 in8Lmm, eine 8obriL
odriotLZ, ein kuror 8ympatlncm8 ergreife ihn u. s. w. Aller-
dings hat die Bildkraft des Künstlers sogar für ihn
selbst etwas Mystisches, geschweige denn für Andere, die
einer solchen Kraft nicht theilhaftig sind. Sein Schaffens-
drang ist am lebendigsten und fruchtbarsten, wenn sein
Gefühl am erregtesten ist, was besonders der Fall ist
in der schönen Zeit der jungen Liebe. Die „Freiheit"
von diesen Gefühlen im Alter »ernüchtert die Kunst.
Rückert ermahnt freilich, die Gemüthserregung läse auf
in dein Erkennen, um frei zu sein; der Künstler jedoch
der, weil er die treibende Frische des Gefühls verlor,
seine Kunst durch Reflexion originell erhalten will,
täuscht sich in sich selbst. Er hält das Werk, das ihm
am meisten Mühe machte, für das beste, er wird un-
ehrlich gegen sich selbst und sucht das an der Güte des
Werks im Innersten seines Herzens zweifelnde Gefühl
niederzuhalten, indem er vor sich selbst die ausgeklügelten
Besonderheiten dieses Werkes betont, wenn die jetzt
„zur Abwechselung" wieder wuchernde Symbolistik über-
haupt „Kunst" ist, so ist sie sicherlich keine Eingebung,
Inspiration; der Symboliker verzichtet augenscheinlich
auf das spontane Gefühlsurtheil seitens des Beschauers,
er hält es mit der Erklärung im Katechismus, die sich
stets mit der Frage einleitet: was ist das? wenn frei-
lich alle Kunst — und damit kommen wir auf die gegen-
teilige Behauptung des Satzes, daß die Kunst dem
Fühlen entspringe — wenn also die Kunst Technik ist,
wie der frühere Leipziger Kunstakademiedirektor be-
hauptet hat, so sind ihre Werke ein Lrzeugniß der
Erwägung und der Reflexion. Die Mahnung lautet
dann für den Künstler: immer lernen, üben, ausprobiren!
Die Kunst besteht in diesem Falle darin, die „Kunst",
d. h. die Technik, das Studium zu verbergen und das
erkünstelte Produkt als eine Art natürlichen Erzeug-
nisses vorzutäuschen. Das Gefühl des Beschauers soll
durch solche Sachen mit Absicht, mit allen Thikanen
kaptivirt werden, der Künstler ist hierbei der nüchterne
Fabrikator, nicht der begeisterte Schöpser, er arbeitet
auf „Wirkung", auf sinnlichen Eindruck. Line dritte
Meinung will auch hier, die Extreme vermeidend, ver-
mitteln; sie trifft in den meisten Fällen bezüglich des
künstlerischen Schaffens das Richtige, denn vom werden
des Kunstwerkes gilt sowohl das nL86l als auch das
tiorl, und das Wesen der künstlerischen Produktion be-
steht, wie sich Karl Fuchs in Danzig treffend ausdrückt,
in einer gegenseitigen Durchdringung von Begeisterung
und Besinnung. Die Kraft des Gemüths zusammen
mit der Klarheit des Blickes und der Geübtheit der
Hand vollbringen das Werk; dem Gemüthe jedoch
müssen die beiden anderen dienende Mägde sein. Vor
seinem eigenen Gefühle muß der Künstler bestehen, dann
besteht er auch vor dem Beschauer. Die nur technisch
hochstehenden Kunstwerke pflegen rasch abzuklingen.
Nicht nur die Menschen selbst, sondern auch ihre
Werke übertragen ihre innere Stimmung auf andere
Menschen. Die Disposition des Künstlers, seine
Empfindung, von welcher getrieben und beherrscht er
sein Werk schuf, verleihen diesem den eigenartigen
Zauber, die Prägnanz, die sich nicht in Worte fassen,
wohl aber nachfühlen läßt. Sie ist die (Quelle des über-
strömenden Gefühlsurtheils, durch sie werden Kunst-
werke für uns zufolge der Nachempfindung zu Gefühls-
werthen, zu Mitteln der Thätigkeitsentfaltung und er-
frischenden Anregung des inneren Lebens. Die seelische
Gegenwirkung aber des Beschauers geht unbewußt,
ohne Reflexion, vor sich; er empfindet im Gemüthe die
Erhebung, die Freude so, wie er sie nach lusterweckenden