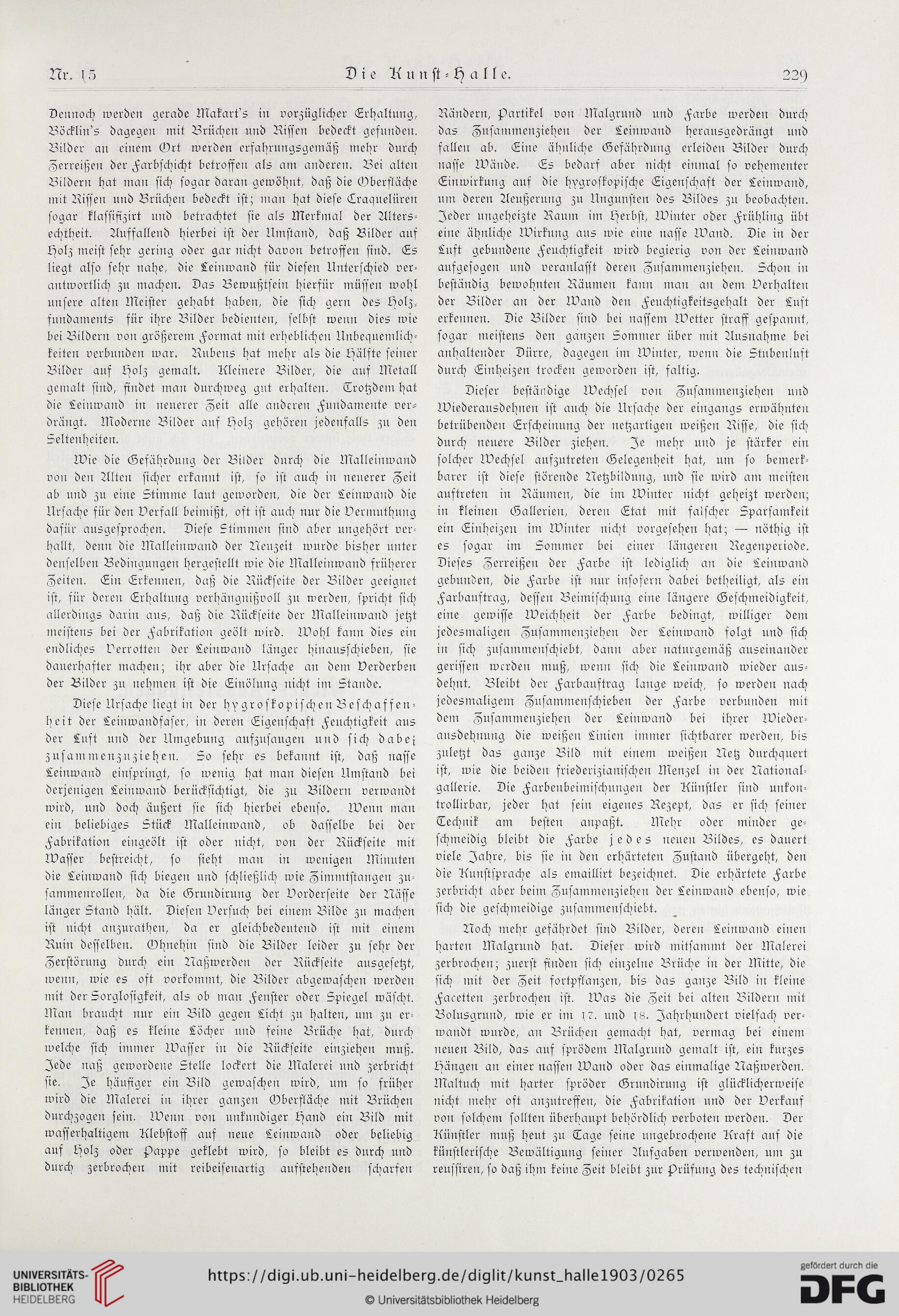Nr. so
Die A u n st - L) a l l e.
22s)
Dennoch werden gerade Makart's in vorzüglicher Erhaltung,
Böcklin's dagegen mit Brüchen und Rissen bedeckt gefunden.
Bilder an einem Grt werden erfahrungsgemäß mehr durch
Zerreißen der Farbschicht betroffen als am anderen. Bei alten
Bildern hat man sich sogar daran gewöhnt, daß die Oberfläche
mit Rissen und Brüchen bedeckt ist; man hat diese Lraquelüren
sogar klassifizirt und betrachtet sie als Merkmal der Alters-
echtheit. Auffallend hierbei ist der Umstand, daß Bilder auf
cholz meist sehr gering oder gar nicht davon betroffen sind. Ls
liegt also sehr nahe, die Leinwand für diesen Unterschied ver-
antwortlich zu machen. Das Bewußtsein hierfür müssen wohl
unsere alten Meister gehabt haben, die sich gern des 6olz-
fundaments für ihre Bilder bedienten, selbst wenn dies wie
bei Bildern von größerem Format mit erheblichen Unbequemlich-
keiten verbunden war. Rubens hat mehr als die chälfte seiner
Bilder auf cholz gemalt. Kleinere Bilder, die auf Metall
gemalt find, findet man durchweg gut erhalten. Trotzdem hat
die Leinwand in neuerer Zeit alle anderen Fundamente ver-
drängt. Moderne Bilder auf Volz gehören jedenfalls zu den
Seltenheiten.
Wie die Gefährdung der Bilder durch die Malleinwand
von den Alten sicher erkannt ist, so ist auch in neuerer Zeit
ab und zu eine Stimme laut geworden, die der Leinwand die
Ursache für den Verfall beimißt, oft ist auch nur die vermuthung
dafür ausgesprochen. Diese Stimmen sind aber ungehört ver-
hallt, denn die Malleinwand der Neuzeit wurde bisher unter
denselben Bedingungen hergestellt wie die Malleinwand früherer
Zeiten. Lin Lrkennen, daß die Rückseite der Bilder geeignet
ist, für deren Erhaltung verhängnißvoll zu werden, spricht sich
allerdings darin aus, daß die Rückseite der Malleinwand jetzt
meistens bei der Fabrikation geölt wird. Wohl kann dies ein
endliches Verrotten der Leinwand länger hinausschieben, sie
dauerhafter machen; ihr aber die Ursache an dem verderben
der Bilder zu nehmen ist die Linölung nicht im Stande.
Diese Ursache liegt in der hygroskopischen Beschaffen-
heit der Leinwandfaser, in derer: Ligenschaft Feuchtigkeit aus
der Luft und der Umgebung aufzusaugen und sich dabei
zusammenznziehen. So sehr es bekannt ist, daß nasse
Leinwand einsxringt, so wenig hat man diesen Umstand bei
derjenigen Leinwand berücksichtigt, die zu Bildern verwandt
wird, und doch äußert sie sich hierbei ebenso. Wenn man
ein beliebiges Stück Malleinwand, ob dasselbe bei der
Fabrikation eingeölt ist oder nicht, von der Rückseite mit
Wasser bestreicht, so sieht man in wenigen Minuten
die Leinwand sich biegen und schließlich wie Zimmtstangen zu-
sammenrollen, da die Grundirung der Vorderseite der Nässe
länger Stand hält. Diesen versuch bei einem Bilde zu machen
ist nicht anzurathen, da er gleichbedeutend ist mit einem
Ruin desselben. Ohnehin sind die Bilder leider zu sehr der
Zerstörung durch ein Naßwerden der Rückseite ausgesetzt,
wenn, wie es oft vorkommt, die Bilder abgewaschen werden
mit der Sorglosigkeit, als ob man Fenster oder Spiegel wäscht.
Man braucht nur ein Bild gegen Licht zu halten, um zu er-
kennen, daß es kleine Löcher und feine Brüche hat, durch
welche sich immer Wasser in die Rückseite einziehen muß.
Jede naß gewordene Stelle lockert die Malerei und zerbricht
sie. Ze häufiger ein Bild gewaschen wird, um so früher
wird die Malerei in ihrer ganzen Oberfläche mit Brüchen
durchzogen sein. Wenn von unkundiger chand ein Bild mit
wasserhaltigem Klebstoff auf neue Leinwand oder beliebig
auf kfolz oder Pappe geklebt wird, so bleibt es durch und
durch zerbrochen mit reibeisenartig aufstehenden scharfen
Rändern, Partikel von Malgrund und Farbe werden durch
das Zusammenziehen der Leinwand herausgedrängt und
fallen ab. Line ähnliche Gefährdung erleiden Bilder durch
nasse Wände. Ls bedarf aber nicht einmal so vehementer
Einwirkung auf die hygroskopische Ligenschaft der Leinwand,
um deren Aeußerung zu Ungunsten des Bildes zu beobachten.
Zeder ungeheizte Raum im perbst, Winter oder Frühling übt
eine ähnliche Wirkung aus wie eine nasse Wand. Die in der
Luft gebundene Feuchtigkeit wird begierig von der Leinwand
aufgesogen und veranlasst deren Zusammenziehen. Schon in
beständig bewohnten Räumen kann man an dem Verhalten
der Bilder an der Wand den Feuchtigkeitsgehalt der Luft
erkennen. Die Bilder sind bei nassem Wetter straff gespannt,
sogar meistens den ganzen Sommer über mit Ausnahme bei
anhaltender Dürre, dagegen im Winter, wenn die Stubenluft
durch Linheizen trocken geworden ist, faltig.
Dieser beständige Wechsel von Zusammengehen und
Wiederausdehnen ist auch die Ursache der eingangs erwähnten
betrübenden Erscheinung der netzartigen weißen Risse, die sich
durch neuere Bilder ziehen. Ze mehr und je stärker ein
solcher Wechsel aufzutreten Gelegenheit hat, um so bemerk-
barer ist diese störende Netzbildung, und sie wird am meisten
auftreten in Räumen, die im Winter nicht geheizt werden;
in kleinen Gallerien, deren Etat mit falscher Sparsamkeit
ein Linheizen im Winter nicht vorgesehen hat; — nöthig ist
es sogar im Sommer bei einer längeren Regenxeriode.
Dieses Zerreißen der Farbe ist lediglich an die Leinwand
gebunden, die Farbe ist nur insofern dabei betheiligt, als ein
Farbauftrag, dessen Beimischung eine längere Geschmeidigkeit,
eine gewisse Weichheit der Farbe bedingt, williger dein
jedesmaligen Zusammenziehen der Leinwand folgt und sich
in sich zusammenschiebt, dann aber naturgemäß auseinander
gerissen werden muß, wenn sich die Leinwand wieder aus-
dehnt. Bleibt der Farbauftrag lange weich, so werden nach
jedesmaligem Zusammenschieben der Farbe verbunden mit
dem Zusammenziehen der Leinwand bei ihrer Wieder-
ausdehnung die weißen Linien immer sichtbarer werden, bis
zuletzt das ganze Bild mit einem weißen Netz durchquert
ist, wie die beiden friederizianischen Menzel in der National-
gallerie. Die Farbenbeimischungen der Künstler sind unkon-
trollirbar, jeder hat sein eigenes Rezept, das er sich seiner
Technik am besten anpaßt. Mehr oder minder ge-
schmeidig bleibt die Farbe jedes neuen Bildes, es dauert
viele Zahre, bis sie in den erhärteten Zustand übergeht, den
die Kunstsprache als emaillirt bezeichnet. Die erhärtete Farbe
zerbricht aber beim Zusammenziehen der Leinwand ebenso, wie
sich die geschmeidige zusammenschiebt.
Noch mehr gefährdet sind Bilder, deren Leinwand einen
harten Malgrund hat. Dieser wird mitsammt der Malerei
zerbrochen; zuerst finden sich einzelne Brüche in der Mitte, die
sich init der Zeit fortpflanzen, bis das ganze Bild in kleine
Facetten zerbrochen ist. Was die Zeit bei alten Bildern mit
Bolusgrund, wie er im ^7. und ;8. Zahrhundert vielfach ver-
wandt wurde, an Brüchen gemacht hat, vermag bei einem
neuen Bild, das auf sprödem Malgrund gemalt ist, ein kurzes
pängen an einer nassen Wand oder das einmalige Naßwerden.
Maltuch mit harter spröder Grundirung ist glücklicherweise
nicht mehr oft anzutreffen, die Fabrikation und der Verkauf
von solchem sollten überhaupt behördlich verboten werden. Der
Künstler muß heut zu Tage seine ungebrochene Kraft auf die
künstlerische Bewältigung seiner Aufgaben verwenden, um zu
reussiren, so daß ihm keine Zeit bleibt zur Prüfung des technischen
Die A u n st - L) a l l e.
22s)
Dennoch werden gerade Makart's in vorzüglicher Erhaltung,
Böcklin's dagegen mit Brüchen und Rissen bedeckt gefunden.
Bilder an einem Grt werden erfahrungsgemäß mehr durch
Zerreißen der Farbschicht betroffen als am anderen. Bei alten
Bildern hat man sich sogar daran gewöhnt, daß die Oberfläche
mit Rissen und Brüchen bedeckt ist; man hat diese Lraquelüren
sogar klassifizirt und betrachtet sie als Merkmal der Alters-
echtheit. Auffallend hierbei ist der Umstand, daß Bilder auf
cholz meist sehr gering oder gar nicht davon betroffen sind. Ls
liegt also sehr nahe, die Leinwand für diesen Unterschied ver-
antwortlich zu machen. Das Bewußtsein hierfür müssen wohl
unsere alten Meister gehabt haben, die sich gern des 6olz-
fundaments für ihre Bilder bedienten, selbst wenn dies wie
bei Bildern von größerem Format mit erheblichen Unbequemlich-
keiten verbunden war. Rubens hat mehr als die chälfte seiner
Bilder auf cholz gemalt. Kleinere Bilder, die auf Metall
gemalt find, findet man durchweg gut erhalten. Trotzdem hat
die Leinwand in neuerer Zeit alle anderen Fundamente ver-
drängt. Moderne Bilder auf Volz gehören jedenfalls zu den
Seltenheiten.
Wie die Gefährdung der Bilder durch die Malleinwand
von den Alten sicher erkannt ist, so ist auch in neuerer Zeit
ab und zu eine Stimme laut geworden, die der Leinwand die
Ursache für den Verfall beimißt, oft ist auch nur die vermuthung
dafür ausgesprochen. Diese Stimmen sind aber ungehört ver-
hallt, denn die Malleinwand der Neuzeit wurde bisher unter
denselben Bedingungen hergestellt wie die Malleinwand früherer
Zeiten. Lin Lrkennen, daß die Rückseite der Bilder geeignet
ist, für deren Erhaltung verhängnißvoll zu werden, spricht sich
allerdings darin aus, daß die Rückseite der Malleinwand jetzt
meistens bei der Fabrikation geölt wird. Wohl kann dies ein
endliches Verrotten der Leinwand länger hinausschieben, sie
dauerhafter machen; ihr aber die Ursache an dem verderben
der Bilder zu nehmen ist die Linölung nicht im Stande.
Diese Ursache liegt in der hygroskopischen Beschaffen-
heit der Leinwandfaser, in derer: Ligenschaft Feuchtigkeit aus
der Luft und der Umgebung aufzusaugen und sich dabei
zusammenznziehen. So sehr es bekannt ist, daß nasse
Leinwand einsxringt, so wenig hat man diesen Umstand bei
derjenigen Leinwand berücksichtigt, die zu Bildern verwandt
wird, und doch äußert sie sich hierbei ebenso. Wenn man
ein beliebiges Stück Malleinwand, ob dasselbe bei der
Fabrikation eingeölt ist oder nicht, von der Rückseite mit
Wasser bestreicht, so sieht man in wenigen Minuten
die Leinwand sich biegen und schließlich wie Zimmtstangen zu-
sammenrollen, da die Grundirung der Vorderseite der Nässe
länger Stand hält. Diesen versuch bei einem Bilde zu machen
ist nicht anzurathen, da er gleichbedeutend ist mit einem
Ruin desselben. Ohnehin sind die Bilder leider zu sehr der
Zerstörung durch ein Naßwerden der Rückseite ausgesetzt,
wenn, wie es oft vorkommt, die Bilder abgewaschen werden
mit der Sorglosigkeit, als ob man Fenster oder Spiegel wäscht.
Man braucht nur ein Bild gegen Licht zu halten, um zu er-
kennen, daß es kleine Löcher und feine Brüche hat, durch
welche sich immer Wasser in die Rückseite einziehen muß.
Jede naß gewordene Stelle lockert die Malerei und zerbricht
sie. Ze häufiger ein Bild gewaschen wird, um so früher
wird die Malerei in ihrer ganzen Oberfläche mit Brüchen
durchzogen sein. Wenn von unkundiger chand ein Bild mit
wasserhaltigem Klebstoff auf neue Leinwand oder beliebig
auf kfolz oder Pappe geklebt wird, so bleibt es durch und
durch zerbrochen mit reibeisenartig aufstehenden scharfen
Rändern, Partikel von Malgrund und Farbe werden durch
das Zusammenziehen der Leinwand herausgedrängt und
fallen ab. Line ähnliche Gefährdung erleiden Bilder durch
nasse Wände. Ls bedarf aber nicht einmal so vehementer
Einwirkung auf die hygroskopische Ligenschaft der Leinwand,
um deren Aeußerung zu Ungunsten des Bildes zu beobachten.
Zeder ungeheizte Raum im perbst, Winter oder Frühling übt
eine ähnliche Wirkung aus wie eine nasse Wand. Die in der
Luft gebundene Feuchtigkeit wird begierig von der Leinwand
aufgesogen und veranlasst deren Zusammenziehen. Schon in
beständig bewohnten Räumen kann man an dem Verhalten
der Bilder an der Wand den Feuchtigkeitsgehalt der Luft
erkennen. Die Bilder sind bei nassem Wetter straff gespannt,
sogar meistens den ganzen Sommer über mit Ausnahme bei
anhaltender Dürre, dagegen im Winter, wenn die Stubenluft
durch Linheizen trocken geworden ist, faltig.
Dieser beständige Wechsel von Zusammengehen und
Wiederausdehnen ist auch die Ursache der eingangs erwähnten
betrübenden Erscheinung der netzartigen weißen Risse, die sich
durch neuere Bilder ziehen. Ze mehr und je stärker ein
solcher Wechsel aufzutreten Gelegenheit hat, um so bemerk-
barer ist diese störende Netzbildung, und sie wird am meisten
auftreten in Räumen, die im Winter nicht geheizt werden;
in kleinen Gallerien, deren Etat mit falscher Sparsamkeit
ein Linheizen im Winter nicht vorgesehen hat; — nöthig ist
es sogar im Sommer bei einer längeren Regenxeriode.
Dieses Zerreißen der Farbe ist lediglich an die Leinwand
gebunden, die Farbe ist nur insofern dabei betheiligt, als ein
Farbauftrag, dessen Beimischung eine längere Geschmeidigkeit,
eine gewisse Weichheit der Farbe bedingt, williger dein
jedesmaligen Zusammenziehen der Leinwand folgt und sich
in sich zusammenschiebt, dann aber naturgemäß auseinander
gerissen werden muß, wenn sich die Leinwand wieder aus-
dehnt. Bleibt der Farbauftrag lange weich, so werden nach
jedesmaligem Zusammenschieben der Farbe verbunden mit
dem Zusammenziehen der Leinwand bei ihrer Wieder-
ausdehnung die weißen Linien immer sichtbarer werden, bis
zuletzt das ganze Bild mit einem weißen Netz durchquert
ist, wie die beiden friederizianischen Menzel in der National-
gallerie. Die Farbenbeimischungen der Künstler sind unkon-
trollirbar, jeder hat sein eigenes Rezept, das er sich seiner
Technik am besten anpaßt. Mehr oder minder ge-
schmeidig bleibt die Farbe jedes neuen Bildes, es dauert
viele Zahre, bis sie in den erhärteten Zustand übergeht, den
die Kunstsprache als emaillirt bezeichnet. Die erhärtete Farbe
zerbricht aber beim Zusammenziehen der Leinwand ebenso, wie
sich die geschmeidige zusammenschiebt.
Noch mehr gefährdet sind Bilder, deren Leinwand einen
harten Malgrund hat. Dieser wird mitsammt der Malerei
zerbrochen; zuerst finden sich einzelne Brüche in der Mitte, die
sich init der Zeit fortpflanzen, bis das ganze Bild in kleine
Facetten zerbrochen ist. Was die Zeit bei alten Bildern mit
Bolusgrund, wie er im ^7. und ;8. Zahrhundert vielfach ver-
wandt wurde, an Brüchen gemacht hat, vermag bei einem
neuen Bild, das auf sprödem Malgrund gemalt ist, ein kurzes
pängen an einer nassen Wand oder das einmalige Naßwerden.
Maltuch mit harter spröder Grundirung ist glücklicherweise
nicht mehr oft anzutreffen, die Fabrikation und der Verkauf
von solchem sollten überhaupt behördlich verboten werden. Der
Künstler muß heut zu Tage seine ungebrochene Kraft auf die
künstlerische Bewältigung seiner Aufgaben verwenden, um zu
reussiren, so daß ihm keine Zeit bleibt zur Prüfung des technischen