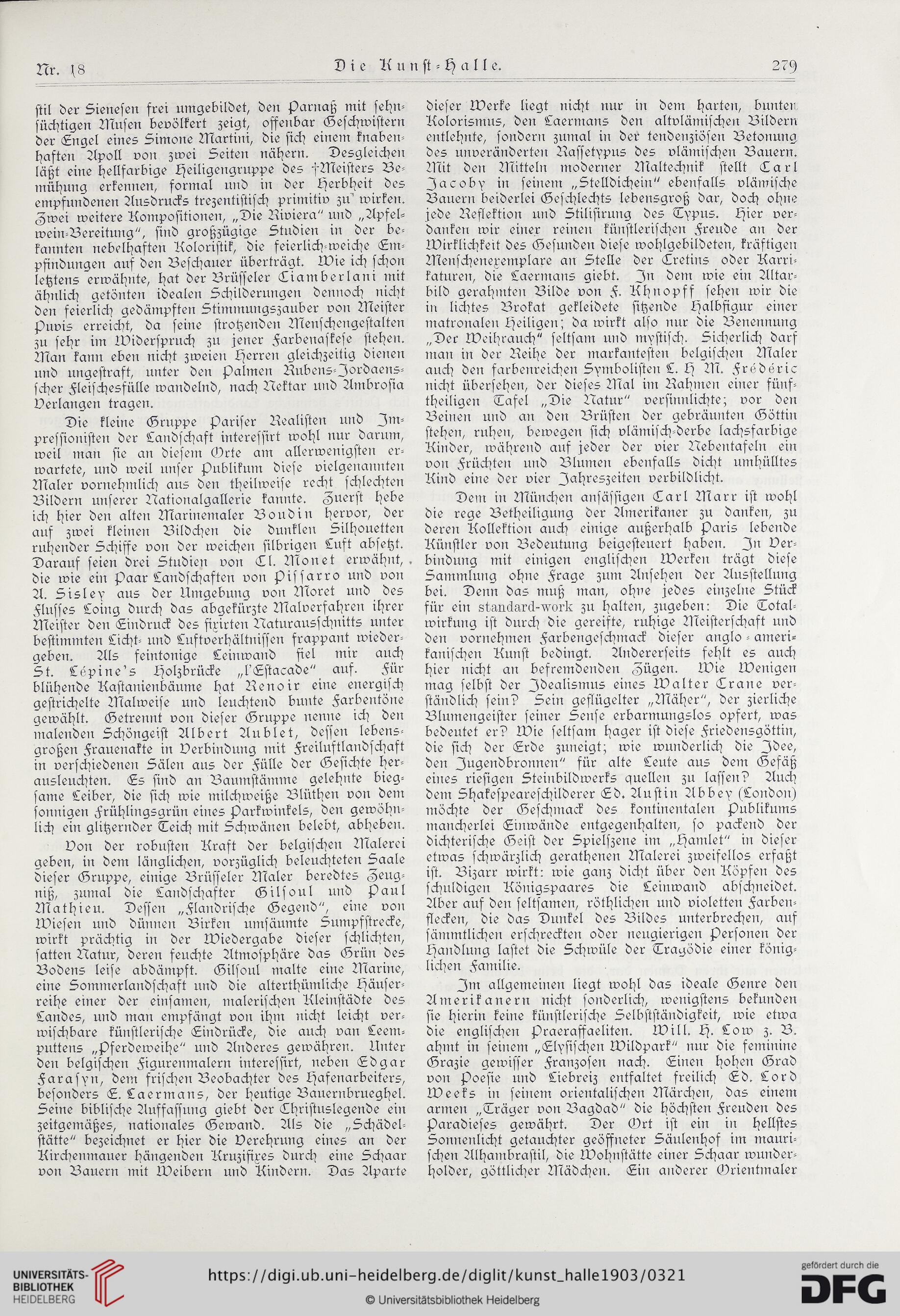Nr. (8
stil der Sienesen frei umgebildet, den Parnaß mit sehn-
süchtigen Musen bevölkert zeigt, offenbar Geschwistern
der Engel eines Simone Martini, die sich einem knaben-
haften Apoll von zwei Seiten nähern. Desgleichen
läßt eine hellfarbige Heiligengruppe des -(Meisters Be-
mühung erkennen, formal und in der Herbheit des
empfundenen Ausdrucks trezentiftisch primitiv zu" wirken.
Zwei weitere Kompositionen, „Die Riviera" und „Apfel-
wein-Bereitung", sind großzügige Studien in der be-
kannten nebelhaften Koloristik, die feierlich-weiche Em-
pfindungen auf den Beschauer überträgt, wie ich schon
letztens erwähnte, hat der Brüsseler Liamberlani mit
ähnlich getönten idealen Schilderungen dennoch nicht
den feierlich gedämpften Stimmungszauber von Meister
puvis erreicht, da seine strotzenden Menschengestalten
zu sehr im Widerspruch zu jener Farbenaskese stehen.
Man kann eben nicht zweien Herren gleichzeitig dienen
und ungestraft, unter den Halmen Rubens-Iordaens-
scher Fleischesfülle wandelnd, nach Nektar und Ambrosia
Verlangeri tragen.
Die kleine Gruppe pariser Realisten und Im-
pressionisten der Landschaft interessirt wohl nur darum,
weil man sie an diesem Orte am allerwenigsten er-
wartete, und weil unser Publikum diese vielgenannten
Maler vornehmlich aus den theilweise recht schlechten
Bildern unserer Nationalgallerie kannte. Zuerst hebe
ich hier den alten Marinemaler Boudin hervor, der
auf zwei kleinen Bildchen die dunklen Silhouetten
ruhender Schiffe von der weichen silbrigen Luft absetzt.
Darauf seien drei Studien von Gl. Monet erwähnt,
die wie ein paar Landschaften von Pissarro und von
A. Sisley aus der Umgebung von Moret und des
Flusses Loing durch das abgekürzte Maloerfahren ihrer
Meister den Eindruck des sixirten Naturausschnitts unter
bestimmten Licht- und Luftoerhältnissen frappant wieder-
geben. Als feintonige Leinwand fiel mir auch
St. Löpine's Holzbrücke „l'Estacade" auf. Für
blühende Kastanienbäume hat Renoir eine energisch
gestrichelte Malweise und leuchtend bunte Farbentöne
gewählt. Getrennt von dieser Gruppe nenne ich den
malenden Schöngeist Albert Aublet, dessen lebens-
großen Frauenakte in Verbindung mit Freiluftlandschaft
in verschiedenen Sälen aus der Fülle der Gesichte her-
ausleuchten. Es sind an Baumstämme gelehnte bieg-
same Leiber, die sich wie milchweiße Blüthen von dem
sonnigen Frühlingsgrün eines Parkwinkels, den gewöhn-
lich ein glitzernder Teich mit Schwänen belebt, abheben.
Von der robusten Kraft der belgischen Malerei
geben, in dem länglichen, vorzüglich beleuchteten Saale
dieser Gruppe, einige Brüsseler Maler beredtes Zeug-
niß, zumal die Landschafter Gilsoul und Paul
Mathieu. Dessen „Flandrische Gegend", eine von
Wiesen und dünnen Birken umsäumte Sumpfstrecke,
wirkt prächtig in der Wiedergabe dieser schlichten,
satten Natur, deren feuchte Atmosphäre das Grün des
Bodens leise abdämpft. Gilsoul malte eine Marine,
eine Sommerlandschaft und die alterthümliche Häuser-
reihe einer der einsamen, malerischen Kleinstädte des
Landes, und man empfängt von ihm nicht leicht ver-
wischbare künstlerische Eindrücke, die auch van Leem-
puttens „Pferdeweihe" und Anderes gewähren. Unter
den belgischen Figurenmalern interessirt, neben Edgar
Farasyn, dein frischen Beobachter des Hafenarbeiters,
besonders L. Laermans, der heutige Bauernbrueghel.
Seine biblische Auffassung giebt der Ghristuslegende ein
zeitgemäßes, nationales Gewand. Als die „Schädel-
stätte" bezeichnet er hier die Verehrung eines an der
Kirchenmauer hängenden Kruzifixes durch eine Schaar
von Bauern mit Weibern und Kindern. Das Aparte
279
dieser Werke liegt nicht nur in dem harten, bunten.
Kolorismus, den Laermans den altvlämischen Bildern
entlehnte, sondern zumal in der tendenziösen Betonung
des unveränderten Rassetypus des vlämischen Bauern.
Mit den Mitteln moderner Maltechnik stellt Garl
Jacoby in seinen: „Stelldichein" ebenfalls vlämische
Bauern beiderlei Geschlechts lebensgroß dar, doch ohne
jede Reflektion und Stilisirung des Typus. Hier ver-
danken wir einer reinen künstlerischen Freude an der
Wirklichkeit des Gesunden diese wohlgebildeten, kräftigen
Menschenexemplare an Stelle der Gretins oder Karri-
katuren, die Laermans giebt. In dem wie ein Altar-
bild gerahmten Bilde von F. Khnopff sehen wir die
in lichtes Brokat gekleidete sitzende Halbfigur einer
matronalen Heiligen; da wirkt also nur die Benennung
„Dec Weihrauch" seltsam und mystisch. Sicherlich darf
man in der Reihe der markantesten belgischen Maler
auch den farbenreichen Symbolisten L. H M. Frödsric
nicht übersehen, der dieses Mal im Rahmen einer fünf-
theiligen Tafel „Die Natur" versinnlichte; vor den
Beinen und an den Brüsten der gebräunten Göttin
stehen, ruhen, bewegen sich vlämisch-derbe lachsfarbige
Kinder, während auf jeder der vier Nebentafeln ein
voi: Früchten und Blumen ebenfalls dicht umhülltes
Kind eine der vier Jahreszeiten verbildlicht.
Den: in München ansässigen Garl Marr ist wohl
die rege Betheiligung der Amerikaner zu danken, zu
deren Kollektion auch einige außerhalb Paris lebende
Künstler von Bedeutung beigesteuert haben. In Ver-
bindung mit einigen englischen Werken trägt diese
Sammlung ohne Frage zum Ansehen der Ausstellung
bei. Denn das muß man, ohne jedes einzelne Stück
für ein 8t,AuäÄrä-rvorll zu halten, zugeben: Die Total-
wirkung ist durch die gereifte, ruhige Meisterschaft und
den vornehmen Farbengeschmack dieser anglo - ameri-
kanischen Kunst bedingt. Andererseits fehlt es auch
hier nicht an befremdenden Zügen, wie wenigen
mag selbst der Idealismus eines Walter Grane ver-
ständlich sein? Sein geflügelter „Mäher", der zierliche
Blumengeifter seiner Sense erbarmungslos opfert, was
bedeutet er? wie seltsam hager ist diese Friedensgöttin,
die sich der Erde zuneigt; wie wunderlich die Idee,
den Iugendbronnen" für alte Leute aus dem Gefäß
eines riesigen Steinbildwerks quellen zu lassen? Auch
dem Shakespeareschilderer Ed. Austin Abbey (London)
möchte der Geschmack des kontinentalen Publikums
mancherlei Einwände entgegenhalten, so packend der
dichterische Geist der Spielszene im „Hamlet" in dieser
etwas schwärzlich gerathenen Malerei zweifellos erfaßt
ist. Bizarr wirkt: wie ganz dicht über dei: Köpfen des
schuldigen Königsxaares die Leinwand abschneidet.
Aber auf den seltsamen, röthlichen und violetten Farben-
flecken, die das Dunkel des Bildes unterbrechen, auf
sämmtlichen erschreckten oder neugierigen Personen der
Handlung lastet die Schwüle der Tragödie einer könig-
lichen Familie.
Im allgemeinen liegt wohl das ideale Genre den
Amerikanern nicht sonderlich, wenigstens bekunden
sie hierin keine künstlerische Selbstständigkeit, wie etwa
die englischen praeraffaeliten. will. H. Low z. B.
ahmt in seinem „Elysischen Wildpark" nur die feminine
Grazie gewisser Franzosen nach. Linen hohen Grad
von Poesie und Liebreiz entfaltet freilich Ed. Lord
weeks in seinem orientalischen Märchen, das einem
armen „Träger von Bagdad" die höchsten Freuden des
Paradieses gewährt. Der Ort ist ein in hellstes
Sonnenlicht getauchter geöffneter Säulenhof im mauri-
schen Alhambrastil, die Wohnstätte einer Schaar wunder-
holder, göttlicher Mädchen. Ein anderer Orientmaler
Die A u n st - H a l l e.
stil der Sienesen frei umgebildet, den Parnaß mit sehn-
süchtigen Musen bevölkert zeigt, offenbar Geschwistern
der Engel eines Simone Martini, die sich einem knaben-
haften Apoll von zwei Seiten nähern. Desgleichen
läßt eine hellfarbige Heiligengruppe des -(Meisters Be-
mühung erkennen, formal und in der Herbheit des
empfundenen Ausdrucks trezentiftisch primitiv zu" wirken.
Zwei weitere Kompositionen, „Die Riviera" und „Apfel-
wein-Bereitung", sind großzügige Studien in der be-
kannten nebelhaften Koloristik, die feierlich-weiche Em-
pfindungen auf den Beschauer überträgt, wie ich schon
letztens erwähnte, hat der Brüsseler Liamberlani mit
ähnlich getönten idealen Schilderungen dennoch nicht
den feierlich gedämpften Stimmungszauber von Meister
puvis erreicht, da seine strotzenden Menschengestalten
zu sehr im Widerspruch zu jener Farbenaskese stehen.
Man kann eben nicht zweien Herren gleichzeitig dienen
und ungestraft, unter den Halmen Rubens-Iordaens-
scher Fleischesfülle wandelnd, nach Nektar und Ambrosia
Verlangeri tragen.
Die kleine Gruppe pariser Realisten und Im-
pressionisten der Landschaft interessirt wohl nur darum,
weil man sie an diesem Orte am allerwenigsten er-
wartete, und weil unser Publikum diese vielgenannten
Maler vornehmlich aus den theilweise recht schlechten
Bildern unserer Nationalgallerie kannte. Zuerst hebe
ich hier den alten Marinemaler Boudin hervor, der
auf zwei kleinen Bildchen die dunklen Silhouetten
ruhender Schiffe von der weichen silbrigen Luft absetzt.
Darauf seien drei Studien von Gl. Monet erwähnt,
die wie ein paar Landschaften von Pissarro und von
A. Sisley aus der Umgebung von Moret und des
Flusses Loing durch das abgekürzte Maloerfahren ihrer
Meister den Eindruck des sixirten Naturausschnitts unter
bestimmten Licht- und Luftoerhältnissen frappant wieder-
geben. Als feintonige Leinwand fiel mir auch
St. Löpine's Holzbrücke „l'Estacade" auf. Für
blühende Kastanienbäume hat Renoir eine energisch
gestrichelte Malweise und leuchtend bunte Farbentöne
gewählt. Getrennt von dieser Gruppe nenne ich den
malenden Schöngeist Albert Aublet, dessen lebens-
großen Frauenakte in Verbindung mit Freiluftlandschaft
in verschiedenen Sälen aus der Fülle der Gesichte her-
ausleuchten. Es sind an Baumstämme gelehnte bieg-
same Leiber, die sich wie milchweiße Blüthen von dem
sonnigen Frühlingsgrün eines Parkwinkels, den gewöhn-
lich ein glitzernder Teich mit Schwänen belebt, abheben.
Von der robusten Kraft der belgischen Malerei
geben, in dem länglichen, vorzüglich beleuchteten Saale
dieser Gruppe, einige Brüsseler Maler beredtes Zeug-
niß, zumal die Landschafter Gilsoul und Paul
Mathieu. Dessen „Flandrische Gegend", eine von
Wiesen und dünnen Birken umsäumte Sumpfstrecke,
wirkt prächtig in der Wiedergabe dieser schlichten,
satten Natur, deren feuchte Atmosphäre das Grün des
Bodens leise abdämpft. Gilsoul malte eine Marine,
eine Sommerlandschaft und die alterthümliche Häuser-
reihe einer der einsamen, malerischen Kleinstädte des
Landes, und man empfängt von ihm nicht leicht ver-
wischbare künstlerische Eindrücke, die auch van Leem-
puttens „Pferdeweihe" und Anderes gewähren. Unter
den belgischen Figurenmalern interessirt, neben Edgar
Farasyn, dein frischen Beobachter des Hafenarbeiters,
besonders L. Laermans, der heutige Bauernbrueghel.
Seine biblische Auffassung giebt der Ghristuslegende ein
zeitgemäßes, nationales Gewand. Als die „Schädel-
stätte" bezeichnet er hier die Verehrung eines an der
Kirchenmauer hängenden Kruzifixes durch eine Schaar
von Bauern mit Weibern und Kindern. Das Aparte
279
dieser Werke liegt nicht nur in dem harten, bunten.
Kolorismus, den Laermans den altvlämischen Bildern
entlehnte, sondern zumal in der tendenziösen Betonung
des unveränderten Rassetypus des vlämischen Bauern.
Mit den Mitteln moderner Maltechnik stellt Garl
Jacoby in seinen: „Stelldichein" ebenfalls vlämische
Bauern beiderlei Geschlechts lebensgroß dar, doch ohne
jede Reflektion und Stilisirung des Typus. Hier ver-
danken wir einer reinen künstlerischen Freude an der
Wirklichkeit des Gesunden diese wohlgebildeten, kräftigen
Menschenexemplare an Stelle der Gretins oder Karri-
katuren, die Laermans giebt. In dem wie ein Altar-
bild gerahmten Bilde von F. Khnopff sehen wir die
in lichtes Brokat gekleidete sitzende Halbfigur einer
matronalen Heiligen; da wirkt also nur die Benennung
„Dec Weihrauch" seltsam und mystisch. Sicherlich darf
man in der Reihe der markantesten belgischen Maler
auch den farbenreichen Symbolisten L. H M. Frödsric
nicht übersehen, der dieses Mal im Rahmen einer fünf-
theiligen Tafel „Die Natur" versinnlichte; vor den
Beinen und an den Brüsten der gebräunten Göttin
stehen, ruhen, bewegen sich vlämisch-derbe lachsfarbige
Kinder, während auf jeder der vier Nebentafeln ein
voi: Früchten und Blumen ebenfalls dicht umhülltes
Kind eine der vier Jahreszeiten verbildlicht.
Den: in München ansässigen Garl Marr ist wohl
die rege Betheiligung der Amerikaner zu danken, zu
deren Kollektion auch einige außerhalb Paris lebende
Künstler von Bedeutung beigesteuert haben. In Ver-
bindung mit einigen englischen Werken trägt diese
Sammlung ohne Frage zum Ansehen der Ausstellung
bei. Denn das muß man, ohne jedes einzelne Stück
für ein 8t,AuäÄrä-rvorll zu halten, zugeben: Die Total-
wirkung ist durch die gereifte, ruhige Meisterschaft und
den vornehmen Farbengeschmack dieser anglo - ameri-
kanischen Kunst bedingt. Andererseits fehlt es auch
hier nicht an befremdenden Zügen, wie wenigen
mag selbst der Idealismus eines Walter Grane ver-
ständlich sein? Sein geflügelter „Mäher", der zierliche
Blumengeifter seiner Sense erbarmungslos opfert, was
bedeutet er? wie seltsam hager ist diese Friedensgöttin,
die sich der Erde zuneigt; wie wunderlich die Idee,
den Iugendbronnen" für alte Leute aus dem Gefäß
eines riesigen Steinbildwerks quellen zu lassen? Auch
dem Shakespeareschilderer Ed. Austin Abbey (London)
möchte der Geschmack des kontinentalen Publikums
mancherlei Einwände entgegenhalten, so packend der
dichterische Geist der Spielszene im „Hamlet" in dieser
etwas schwärzlich gerathenen Malerei zweifellos erfaßt
ist. Bizarr wirkt: wie ganz dicht über dei: Köpfen des
schuldigen Königsxaares die Leinwand abschneidet.
Aber auf den seltsamen, röthlichen und violetten Farben-
flecken, die das Dunkel des Bildes unterbrechen, auf
sämmtlichen erschreckten oder neugierigen Personen der
Handlung lastet die Schwüle der Tragödie einer könig-
lichen Familie.
Im allgemeinen liegt wohl das ideale Genre den
Amerikanern nicht sonderlich, wenigstens bekunden
sie hierin keine künstlerische Selbstständigkeit, wie etwa
die englischen praeraffaeliten. will. H. Low z. B.
ahmt in seinem „Elysischen Wildpark" nur die feminine
Grazie gewisser Franzosen nach. Linen hohen Grad
von Poesie und Liebreiz entfaltet freilich Ed. Lord
weeks in seinem orientalischen Märchen, das einem
armen „Träger von Bagdad" die höchsten Freuden des
Paradieses gewährt. Der Ort ist ein in hellstes
Sonnenlicht getauchter geöffneter Säulenhof im mauri-
schen Alhambrastil, die Wohnstätte einer Schaar wunder-
holder, göttlicher Mädchen. Ein anderer Orientmaler
Die A u n st - H a l l e.