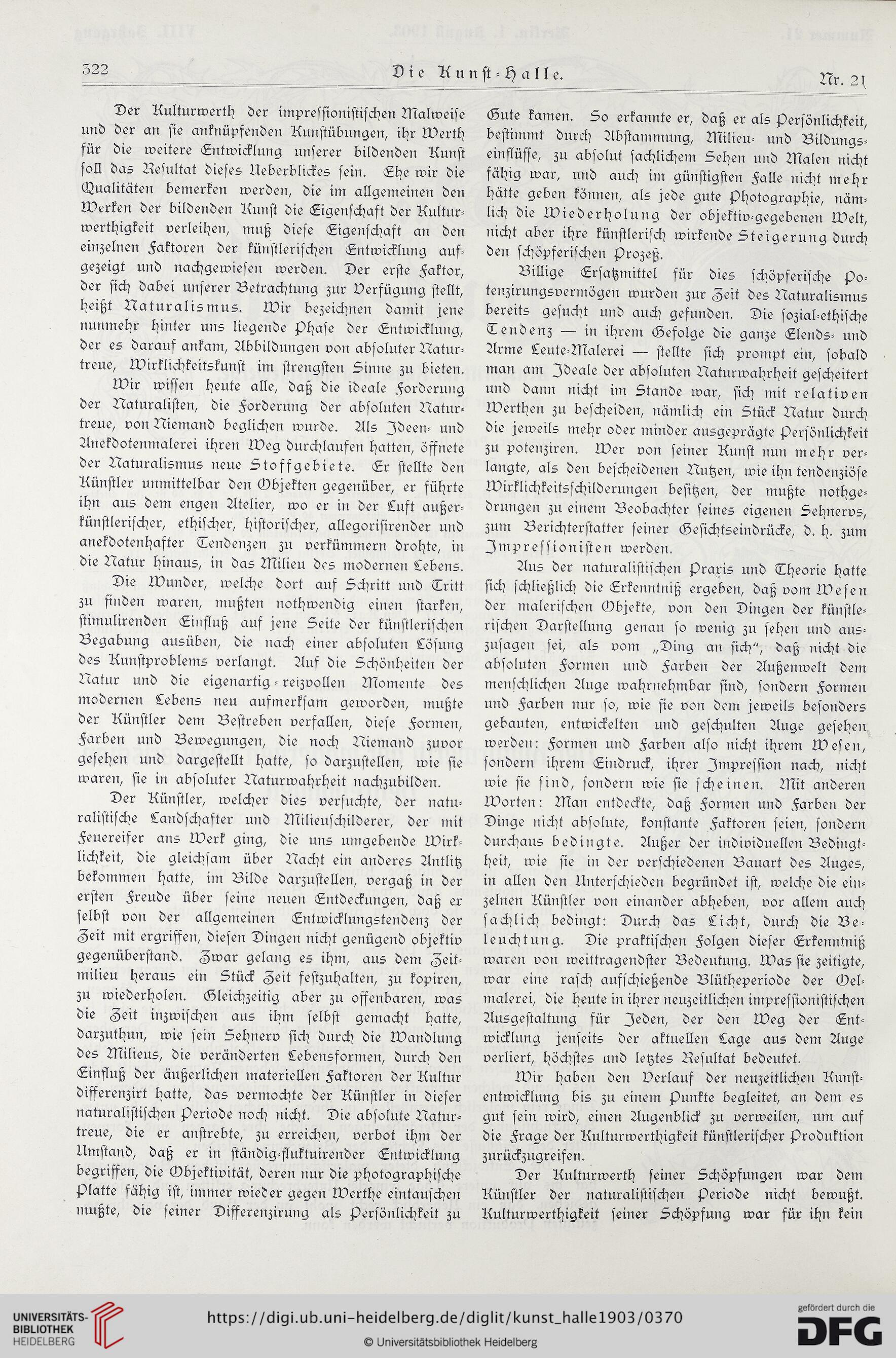322
Die Kunst-Halle.
Nr. 2f
Der Kulturwerth der impressionistischen Malweise
und der an sie anknüpfenden Kunstübungen, ihr Werth
für die weitere Entwicklung unserer bildenden Kunst
soll das Resultat dieses Ueberblickes sein. Ehe wir die
(Qualitäten bemerken werden, die im allgemeinen den
Werken der bildenden Kunst die Eigenschaft der Kultur-
werthigkeit verleihen, muß diese Eigenschaft an den
einzelnen Faktoren der künstlerischen Entwicklung auf-
gezeigt und nachgewiesen werden. Der erste Faktor,
der sich dabei unserer Betrachtung zur Verfügung stellt,
heißt Naturalismus. Wir bezeichnen damit jene
nunmehr hinter uns liegende Phase der Entwicklung,
der es darauf ankam, Abbildungen von absoluter Natur-
treue, Wirklichkeitskunst im strengsten Sinne zu bieten.
Wir wissen heute alle, daß die ideale Forderung
der Naturalisten, die Forderung der absoluten Natur-
treue, von Niemand beglichen wurde. Als Zdeen- und
Anekdotenmalerei ihren Weg durchlaufen hatten, öffnete
der Naturalismus neue Stoffgebiete. Er stellte den
Künstler unmittelbar den Objekten gegenüber, er führte
ihn aus dem engen Atelier, wo er in der Luft außer-
künstlerischer, ethischer, historischer, allegorisirender und
anekdotenhafter Tendenzen zu verkümmern drohte, in
die Natur hinaus, in das Milieu des modernen Lebens.
Die Wunder, welche dort auf Schritt und Tritt
zu finden waren, mußten nothwendig einen starken,
stimulirenden Einfluß auf jene Seite der künstlerischen
Begabung ausüben, die nach einer absoluten Lösung
des Kunstproblems verlangt. Auf die Schönheiten der
Natur und die eigenartig - reizvollen Momente des
modernen Lebens neu aufmerksam geworden, mußte
der Künstler dem Bestreben verfallen, diese Formen,
Farben und Bewegungen, die noch Niemand zuvor
gesehen und dargestellt hatte, so darzustellen, wie sie
waren, sie in absoluter Naturwahrheit nachzubilden.
Der Künstler, welcher dies versuchte, der natu-
ralistische Landschafter und Milieuschilderer, der mit
Feuereifer ans Werk ging, die uns umgebende Wirk-
lichkeit, die gleichsam über Nacht ein anderes Antlitz
bekommen hatte, im Bilde darzustellen, vergaß in der
ersten Freude über seine neuen Entdeckungen, daß er
selbst von der allgemeinen Entwicklungstendenz der
Zeit mit ergriffen, diesen Dingen nicht genügend objektiv
gegenüberstand. Zwar gelang es ihm, aus dem Zeit-
milieu heraus ein Stück Zeit festzuhalten, zu kopiren,
zu wiederholen. Gleichzeitig aber zu offenbaren, was
die Zeit inzwischen aus ihm selbst gemacht hatte,
darzuthun, wie sein Sehnerv sich durch die Wandlung
des Milieus, die veränderten Lebensformen, durch den
Einfluß der äußerlichen materiellen Faktoren der Kultur
differenzirt hatte, das vermochte der Künstler in dieser
naturalistischen Periode noch nicht. Die absolute Natur-
treue, die er anstrebte, zu erreichen, verbot ihm der
Umstand, daß er in ständig-fluktuirender Entwicklung
begriffen, die Objektivität, deren nur die photographische
Platte fähig ist, immer wieder gegen Werthe eintauschen
mußte, die seiner Differenzirung als Persönlichkeit zu
Gute kamen. So erkannte er, daß er als Persönlichkeit,
bestimmt durch Abstammung, Milieu- und Bildungs-
einflüsse, zu absolut sachlichem Sehen und Malen nicht
fähig war, und auch im günstigsten Falle nicht mehr
hätte geben können, als jede gute Photographie, näm-
lich die Wiederholung der objektiv-gegebenen Welt,
nicht aber ihre künstlerisch wirkende Steigerung durch
den schöpferischen Prozeß.
Billige Ersatzmittel für dies schöpferische po-
tenzirungsvermögen wurden zur Zeit des Naturalismus
bereits gesucht und auch gefunden. Die sozial-ethische
Tendenz — in ihrem Gefolge die ganze Elends- und
Arme Leute-Malerei — stellte sich prompt ein, sobald
man am Zdeale der absoluten Naturwahrheit gescheitert
und dann nicht im Stande war, sich mit relativen
werthen zu bescheiden, nämlich ein Stück Natur durch
die jeweils mehr oder minder ausgeprägte Persönlichkeit
zu potenziren. wer von seiner Kunst nun mehr ver-
langte, als den bescheidenen Nutzen, wie ihn tendenziöse
Wirklichkeitsschilderungen besitzen, der mußte nothge-
drungen zu einem Beobachter seines eigenen Sehnervs,
zum Berichterstatter seiner Gesichtseindrücke, d. h. zum
Impressionisten werden.
Aus der naturalistischen Praxis und Theorie hatte
sich schließlich die Erkenntniß ergeben, daß vom Wesen
der malerischen Objekte, von den Dingen der künstle-
rischen Darstellung genau so wenig zu sehen und aus-
zusagen sei, als vom „Ding an sich", daß nicht die
absoluten Formen und Farben der Außenwelt dem
menschlichen Auge wahrnehmbar sind, sondern Formen
und Farben nur so, wie sie von dem jeweils besonders
gebauten, entwickelten und geschulten Auge gesehen,
werden: Formen und Farben also nicht ihrem Wesen,
sondern ihrem Eindruck, ihrer Zmpression nach, nicht
wie sie sind, sondern wie sie scheinen. Mit anderen
Worten: Man entdeckte, daß Formen und Farben der
Dinge nicht absolute, konstante Faktoren seien, sondern
durchaus bedingte. Außer der individuellen Bedingt-
heit, wie sie in der verschiedenen Bauart des Auges,
in allen den Unterschieden begründet ist, welche die ein-
zelnen Künstler von einander abheben, vor allem auch
sachlich bedingt: Durch das Licht, durch die Be-
leuchtung. Die praktischen Folgen dieser Erkenntniß
waren von weittragendster Bedeutung. Was sie zeitigte,
war eine rasch aufschießende Blütheperiode der Oel-
malerei, die heute in ihrer neuzeitlichen impressionistischen
Ausgestaltung für Jeden, der den Weg der Ent-
wicklung jenseits der aktuellen Lage aus dem Auge
verliert, höchstes und letztes Resultat bedeutet.
wir haben den Verlauf der neuzeitlichen Kunst-
entwicklung bis zu einem Punkte begleitet, an dem es
gut sein wird, einen Augenblick zu verweilen, um auf
die Frage der Kulturwerthigkeit künstlerischer Produktion
zurückzugreifen.
Der Kulturwerth seiner Schöpfungen war dem
Künstler der naturalistischen Periode nicht bewußt.
Kulturwerthigkeit seiner Schöpfung war für ihn kein
Die Kunst-Halle.
Nr. 2f
Der Kulturwerth der impressionistischen Malweise
und der an sie anknüpfenden Kunstübungen, ihr Werth
für die weitere Entwicklung unserer bildenden Kunst
soll das Resultat dieses Ueberblickes sein. Ehe wir die
(Qualitäten bemerken werden, die im allgemeinen den
Werken der bildenden Kunst die Eigenschaft der Kultur-
werthigkeit verleihen, muß diese Eigenschaft an den
einzelnen Faktoren der künstlerischen Entwicklung auf-
gezeigt und nachgewiesen werden. Der erste Faktor,
der sich dabei unserer Betrachtung zur Verfügung stellt,
heißt Naturalismus. Wir bezeichnen damit jene
nunmehr hinter uns liegende Phase der Entwicklung,
der es darauf ankam, Abbildungen von absoluter Natur-
treue, Wirklichkeitskunst im strengsten Sinne zu bieten.
Wir wissen heute alle, daß die ideale Forderung
der Naturalisten, die Forderung der absoluten Natur-
treue, von Niemand beglichen wurde. Als Zdeen- und
Anekdotenmalerei ihren Weg durchlaufen hatten, öffnete
der Naturalismus neue Stoffgebiete. Er stellte den
Künstler unmittelbar den Objekten gegenüber, er führte
ihn aus dem engen Atelier, wo er in der Luft außer-
künstlerischer, ethischer, historischer, allegorisirender und
anekdotenhafter Tendenzen zu verkümmern drohte, in
die Natur hinaus, in das Milieu des modernen Lebens.
Die Wunder, welche dort auf Schritt und Tritt
zu finden waren, mußten nothwendig einen starken,
stimulirenden Einfluß auf jene Seite der künstlerischen
Begabung ausüben, die nach einer absoluten Lösung
des Kunstproblems verlangt. Auf die Schönheiten der
Natur und die eigenartig - reizvollen Momente des
modernen Lebens neu aufmerksam geworden, mußte
der Künstler dem Bestreben verfallen, diese Formen,
Farben und Bewegungen, die noch Niemand zuvor
gesehen und dargestellt hatte, so darzustellen, wie sie
waren, sie in absoluter Naturwahrheit nachzubilden.
Der Künstler, welcher dies versuchte, der natu-
ralistische Landschafter und Milieuschilderer, der mit
Feuereifer ans Werk ging, die uns umgebende Wirk-
lichkeit, die gleichsam über Nacht ein anderes Antlitz
bekommen hatte, im Bilde darzustellen, vergaß in der
ersten Freude über seine neuen Entdeckungen, daß er
selbst von der allgemeinen Entwicklungstendenz der
Zeit mit ergriffen, diesen Dingen nicht genügend objektiv
gegenüberstand. Zwar gelang es ihm, aus dem Zeit-
milieu heraus ein Stück Zeit festzuhalten, zu kopiren,
zu wiederholen. Gleichzeitig aber zu offenbaren, was
die Zeit inzwischen aus ihm selbst gemacht hatte,
darzuthun, wie sein Sehnerv sich durch die Wandlung
des Milieus, die veränderten Lebensformen, durch den
Einfluß der äußerlichen materiellen Faktoren der Kultur
differenzirt hatte, das vermochte der Künstler in dieser
naturalistischen Periode noch nicht. Die absolute Natur-
treue, die er anstrebte, zu erreichen, verbot ihm der
Umstand, daß er in ständig-fluktuirender Entwicklung
begriffen, die Objektivität, deren nur die photographische
Platte fähig ist, immer wieder gegen Werthe eintauschen
mußte, die seiner Differenzirung als Persönlichkeit zu
Gute kamen. So erkannte er, daß er als Persönlichkeit,
bestimmt durch Abstammung, Milieu- und Bildungs-
einflüsse, zu absolut sachlichem Sehen und Malen nicht
fähig war, und auch im günstigsten Falle nicht mehr
hätte geben können, als jede gute Photographie, näm-
lich die Wiederholung der objektiv-gegebenen Welt,
nicht aber ihre künstlerisch wirkende Steigerung durch
den schöpferischen Prozeß.
Billige Ersatzmittel für dies schöpferische po-
tenzirungsvermögen wurden zur Zeit des Naturalismus
bereits gesucht und auch gefunden. Die sozial-ethische
Tendenz — in ihrem Gefolge die ganze Elends- und
Arme Leute-Malerei — stellte sich prompt ein, sobald
man am Zdeale der absoluten Naturwahrheit gescheitert
und dann nicht im Stande war, sich mit relativen
werthen zu bescheiden, nämlich ein Stück Natur durch
die jeweils mehr oder minder ausgeprägte Persönlichkeit
zu potenziren. wer von seiner Kunst nun mehr ver-
langte, als den bescheidenen Nutzen, wie ihn tendenziöse
Wirklichkeitsschilderungen besitzen, der mußte nothge-
drungen zu einem Beobachter seines eigenen Sehnervs,
zum Berichterstatter seiner Gesichtseindrücke, d. h. zum
Impressionisten werden.
Aus der naturalistischen Praxis und Theorie hatte
sich schließlich die Erkenntniß ergeben, daß vom Wesen
der malerischen Objekte, von den Dingen der künstle-
rischen Darstellung genau so wenig zu sehen und aus-
zusagen sei, als vom „Ding an sich", daß nicht die
absoluten Formen und Farben der Außenwelt dem
menschlichen Auge wahrnehmbar sind, sondern Formen
und Farben nur so, wie sie von dem jeweils besonders
gebauten, entwickelten und geschulten Auge gesehen,
werden: Formen und Farben also nicht ihrem Wesen,
sondern ihrem Eindruck, ihrer Zmpression nach, nicht
wie sie sind, sondern wie sie scheinen. Mit anderen
Worten: Man entdeckte, daß Formen und Farben der
Dinge nicht absolute, konstante Faktoren seien, sondern
durchaus bedingte. Außer der individuellen Bedingt-
heit, wie sie in der verschiedenen Bauart des Auges,
in allen den Unterschieden begründet ist, welche die ein-
zelnen Künstler von einander abheben, vor allem auch
sachlich bedingt: Durch das Licht, durch die Be-
leuchtung. Die praktischen Folgen dieser Erkenntniß
waren von weittragendster Bedeutung. Was sie zeitigte,
war eine rasch aufschießende Blütheperiode der Oel-
malerei, die heute in ihrer neuzeitlichen impressionistischen
Ausgestaltung für Jeden, der den Weg der Ent-
wicklung jenseits der aktuellen Lage aus dem Auge
verliert, höchstes und letztes Resultat bedeutet.
wir haben den Verlauf der neuzeitlichen Kunst-
entwicklung bis zu einem Punkte begleitet, an dem es
gut sein wird, einen Augenblick zu verweilen, um auf
die Frage der Kulturwerthigkeit künstlerischer Produktion
zurückzugreifen.
Der Kulturwerth seiner Schöpfungen war dem
Künstler der naturalistischen Periode nicht bewußt.
Kulturwerthigkeit seiner Schöpfung war für ihn kein