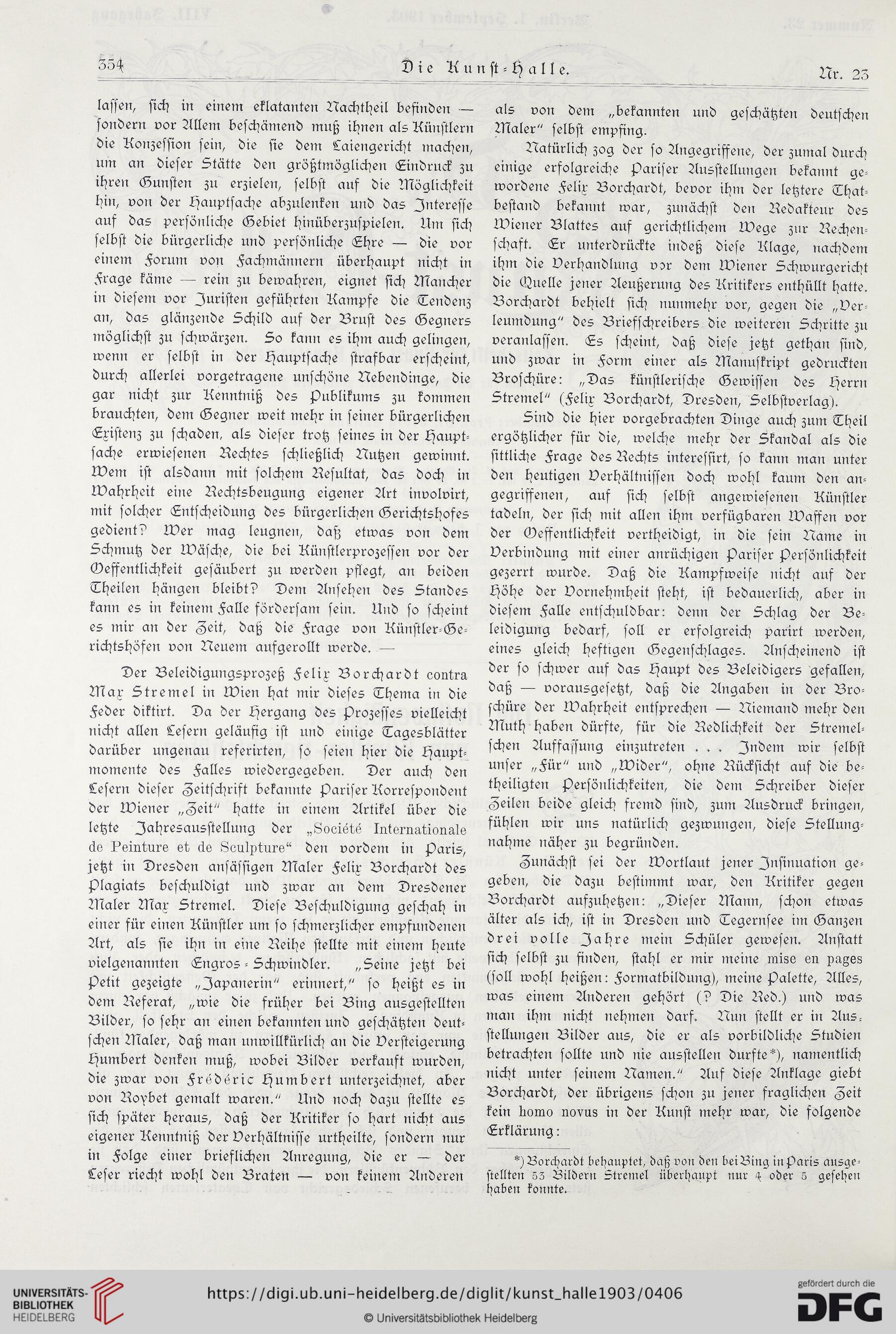35H Die A u n st - H a l l e. Nr. 23
lassen, sich in einem eklatanten Nachtheil befinden —
sondern vor Allem beschämend muß ihnen als Künstlern
die Konzession sein, die sie dem Laiengericht machen,
um an dieser Stätte den größtmöglichen Eindruck zu
ihren Gunsten zu erzielen, selbst aus die Möglichkeit
hin, von der Hauptsache abzulenken und das Interesse
auf das persönliche Gebiet hinüberzuspielen. Um sich
selbst die bürgerliche und persönliche Ehre — die vor
einem Forum von Fachmännern überhaupt nicht in
Frage käme — rein zu bewahren, eignet sich Mancher
in diesem vor Juristen geführten Kampfe die Tendenz
an, das glänzende Schild auf der Brust des Gegners
möglichst zu schwärzen. So kann es ihm auch gelingen,
wenn er selbst in der Hauptsache strafbar erscheint,
durch allerlei vorgetragene unschöne Nebendinge, die
gar nicht zur Kenntniß des Publikums zu kommen
brauchten, dem Gegner weit mehr in seiner bürgerlichen
Existenz zu schaden, als dieser trotz seines in der Haupt-
sache erwiesenen Rechtes schließlich Nutzen gewinnt,
wem ist alsdann mit solchem Resultat, das doch in
Wahrheit eine Rechtsbeugung eigener Art involvirt,
mit solcher Entscheidung des bürgerlichen Gerichtshofes
gedient? wer mag leugnen, daß etwas von dem
Schmutz der Wäsche, die bei Künstlerprozessen vor der
Geffentlichkeit gesäubert zu werden pflegt, an beiden
Theilen hängen bleibt? Dem Ansehen des Standes
kann es in keinem Falle fördersam sein. Und so scheint
es mir an der Zeit, daß die Frage von Künstler-Ge-
richtshöfen von Neuem aufgerollt werde. —
Der Beleidigungsprozeß Felix Borchardt soutra
Max Stremel in Wien hat mir dieses Thema in die
Feder diktirt. Da der Hergang des Prozesses vielleicht
nicht allen Lesern geläufig ist und einige Tagesblätter
darüber ungenau referirten, so seien hier die Haupt-
momente des Falles wiedergegeben. Der auch den
Lesern dieser Zeitschrift bekannte pariser Korrespondent
der Wiener „Zeit" hatte in einem Artikel über die
letzte Iahresausstellung der „Loeists lutsrimtiouals
äs Vsiuturs kk äs 8su1pturs" den vordem in Paris,
jetzt in Dresden ansässigen Maler Felix Borchardt des
Plagiats beschuldigt und zwar an dem Dresdener
Maler Max Stremel. Diese Beschuldigung geschah in
einer für einen Künstler um so schmerzlicher empfundenen
Art, als sie ihn in eine Reihe stellte mit einem heute
vielgenannten Lngros - Schwindler. „Seine jetzt bei
Petit gezeigte „Japanerin" erinnert," so heißt es in
dem Referat, „wie die früher bei Bing ausgestellten
Bilder, so sehr an einen bekannten und geschätzten deut-
schen Maler, daß man unwillkürlich Ml die Versteigerung
Humbert denken muß, wobei Bilder verkauft wurden,
die zwar von Frsdsric Humbert unterzeichnet, aber
von Roybet gemalt waren." Und noch dazu stellte es
sich später heraus, daß der Kritiker so hart nicht aus
eigener Kenntniß der Verhältnisse urtheilte, sondern nur
in Folge einer brieflichen Anregung, die er — der
Leser riecht wohl den Braten — von keinem Anderen
als von dem „bekannten und geschätzten deutschen
Maler" selbst empfing.
Natürlich zog der so Angegriffene, der zumal durch
einige erfolgreiche pariser Ausstellungen bekannt ge-
wordene Felix Borchardt, bevor ihm der letztere Tat-
bestand bekannt war, zunächst den Redakteur des
Wiener Blattes auf gerichtlichem Wege zur Rechen-
schaft. Er unterdrückte indeß diese Klage, nachdem
ihm die Verhandlung vor dem wiener Schwurgericht
die (Quelle jener Aeußerung des Kritikers enthüllt hatte.
Borchardt behielt sich nunmehr vor, gegen die „Ver-
leumdung" des Briefschreibers die weiteren Schritte zu
veranlassen. Ls scheint, daß diese jetzt gethan sind,
und zwar in Form einer als Manuskript gedruckten
Broschüre: „Das künstlerische Gewissen des Herrn
Stremel" (Felix Borchardt, Dresden, Selbstverlag).
Sind die hier vorgebrachten Dinge auch zum Theil
ergötzlicher für die, welche mehr der Skandal als die
sittliche Frage des Rechts interessirt, so kann man unter
den heutigen Verhältnissen doch wohl kaum den an-
gegriffenen, auf sich selbst angewieseneu Künstler
tadeln, der sich mit allen ihm verfügbaren Waffen vor
der Geffentlichkeit vertheidigt, in die sein Name in
Verbindung mit einer anrüchigen pariser Persönlichkeit
gezerrt wurde. Daß die Kampfweise nicht auf der
Höhe der Vornehmheit steht, ist bedauerlich, aber in
diesem Falle entschuldbar: denn der Schlag der Be-
leidigung bedarf, soll er erfolgreich xarirt werden,
eines gleich heftigen Gegenschlages. Anscheinend ist
der so schwer auf das Haupt des Beleidigers gefallen,
daß — vorausgesetzt, daß die Angaben in der Bro-
schüre der Wahrheit entsprechen — Niemand mehr den
Muth haben dürfte, für die Redlichkeit der Stremel-
schen Auffassung einzutreten . . . Indem wir selbst
unser „Für" und „wider", ohne Rücksicht auf die be-
theiligten Persönlichkeiten, die dem Schreiber dieser
Zeilen beide gleich fremd sind, zum Ausdruck bringen,
fühlen wir uns natürlich gezwungen, diese Stellung-
nahme näher zu begründen.
Zunächst sei der Wortlaut jener Insinuation ge-
geben, die dazu bestimmt war, den Kritiker gegen
Borchardt aufzuhetzen: „Dieser Mann, schon etwas
älter als ich, ist in Dresden und Tegernsee im Ganzen
drei volle Jahre mein Schüler gewesen. Anstatt
sich selbst zu finden, stahl er mir meine miss sn puZss
(soll wohl heißen: Formatbildung), meine Palette, Alles,
was einem Anderen gehört (? Die Red.) und was
man ihm nicht nehmen darf. Nun stellt er in Aus-
stellungen Bilder aus, die er als vorbildliche Studien
betrachten sollte und nie ausstellen durfte*), namentlich
nicht unter seinem Namen." Auf diese Anklage giebt
Borchardt, der übrigens schon zu jener fraglichen Zeit
kein llomo U0VU8 in der Kunst mehr war, die folgende
Erklärung:
*) Borchardt behauptet, daß von den bei Bing in Paris ausge-
stellten 53 Bildern Stremel überhaupt nur H oder 5 gesehen
haben konnte.
lassen, sich in einem eklatanten Nachtheil befinden —
sondern vor Allem beschämend muß ihnen als Künstlern
die Konzession sein, die sie dem Laiengericht machen,
um an dieser Stätte den größtmöglichen Eindruck zu
ihren Gunsten zu erzielen, selbst aus die Möglichkeit
hin, von der Hauptsache abzulenken und das Interesse
auf das persönliche Gebiet hinüberzuspielen. Um sich
selbst die bürgerliche und persönliche Ehre — die vor
einem Forum von Fachmännern überhaupt nicht in
Frage käme — rein zu bewahren, eignet sich Mancher
in diesem vor Juristen geführten Kampfe die Tendenz
an, das glänzende Schild auf der Brust des Gegners
möglichst zu schwärzen. So kann es ihm auch gelingen,
wenn er selbst in der Hauptsache strafbar erscheint,
durch allerlei vorgetragene unschöne Nebendinge, die
gar nicht zur Kenntniß des Publikums zu kommen
brauchten, dem Gegner weit mehr in seiner bürgerlichen
Existenz zu schaden, als dieser trotz seines in der Haupt-
sache erwiesenen Rechtes schließlich Nutzen gewinnt,
wem ist alsdann mit solchem Resultat, das doch in
Wahrheit eine Rechtsbeugung eigener Art involvirt,
mit solcher Entscheidung des bürgerlichen Gerichtshofes
gedient? wer mag leugnen, daß etwas von dem
Schmutz der Wäsche, die bei Künstlerprozessen vor der
Geffentlichkeit gesäubert zu werden pflegt, an beiden
Theilen hängen bleibt? Dem Ansehen des Standes
kann es in keinem Falle fördersam sein. Und so scheint
es mir an der Zeit, daß die Frage von Künstler-Ge-
richtshöfen von Neuem aufgerollt werde. —
Der Beleidigungsprozeß Felix Borchardt soutra
Max Stremel in Wien hat mir dieses Thema in die
Feder diktirt. Da der Hergang des Prozesses vielleicht
nicht allen Lesern geläufig ist und einige Tagesblätter
darüber ungenau referirten, so seien hier die Haupt-
momente des Falles wiedergegeben. Der auch den
Lesern dieser Zeitschrift bekannte pariser Korrespondent
der Wiener „Zeit" hatte in einem Artikel über die
letzte Iahresausstellung der „Loeists lutsrimtiouals
äs Vsiuturs kk äs 8su1pturs" den vordem in Paris,
jetzt in Dresden ansässigen Maler Felix Borchardt des
Plagiats beschuldigt und zwar an dem Dresdener
Maler Max Stremel. Diese Beschuldigung geschah in
einer für einen Künstler um so schmerzlicher empfundenen
Art, als sie ihn in eine Reihe stellte mit einem heute
vielgenannten Lngros - Schwindler. „Seine jetzt bei
Petit gezeigte „Japanerin" erinnert," so heißt es in
dem Referat, „wie die früher bei Bing ausgestellten
Bilder, so sehr an einen bekannten und geschätzten deut-
schen Maler, daß man unwillkürlich Ml die Versteigerung
Humbert denken muß, wobei Bilder verkauft wurden,
die zwar von Frsdsric Humbert unterzeichnet, aber
von Roybet gemalt waren." Und noch dazu stellte es
sich später heraus, daß der Kritiker so hart nicht aus
eigener Kenntniß der Verhältnisse urtheilte, sondern nur
in Folge einer brieflichen Anregung, die er — der
Leser riecht wohl den Braten — von keinem Anderen
als von dem „bekannten und geschätzten deutschen
Maler" selbst empfing.
Natürlich zog der so Angegriffene, der zumal durch
einige erfolgreiche pariser Ausstellungen bekannt ge-
wordene Felix Borchardt, bevor ihm der letztere Tat-
bestand bekannt war, zunächst den Redakteur des
Wiener Blattes auf gerichtlichem Wege zur Rechen-
schaft. Er unterdrückte indeß diese Klage, nachdem
ihm die Verhandlung vor dem wiener Schwurgericht
die (Quelle jener Aeußerung des Kritikers enthüllt hatte.
Borchardt behielt sich nunmehr vor, gegen die „Ver-
leumdung" des Briefschreibers die weiteren Schritte zu
veranlassen. Ls scheint, daß diese jetzt gethan sind,
und zwar in Form einer als Manuskript gedruckten
Broschüre: „Das künstlerische Gewissen des Herrn
Stremel" (Felix Borchardt, Dresden, Selbstverlag).
Sind die hier vorgebrachten Dinge auch zum Theil
ergötzlicher für die, welche mehr der Skandal als die
sittliche Frage des Rechts interessirt, so kann man unter
den heutigen Verhältnissen doch wohl kaum den an-
gegriffenen, auf sich selbst angewieseneu Künstler
tadeln, der sich mit allen ihm verfügbaren Waffen vor
der Geffentlichkeit vertheidigt, in die sein Name in
Verbindung mit einer anrüchigen pariser Persönlichkeit
gezerrt wurde. Daß die Kampfweise nicht auf der
Höhe der Vornehmheit steht, ist bedauerlich, aber in
diesem Falle entschuldbar: denn der Schlag der Be-
leidigung bedarf, soll er erfolgreich xarirt werden,
eines gleich heftigen Gegenschlages. Anscheinend ist
der so schwer auf das Haupt des Beleidigers gefallen,
daß — vorausgesetzt, daß die Angaben in der Bro-
schüre der Wahrheit entsprechen — Niemand mehr den
Muth haben dürfte, für die Redlichkeit der Stremel-
schen Auffassung einzutreten . . . Indem wir selbst
unser „Für" und „wider", ohne Rücksicht auf die be-
theiligten Persönlichkeiten, die dem Schreiber dieser
Zeilen beide gleich fremd sind, zum Ausdruck bringen,
fühlen wir uns natürlich gezwungen, diese Stellung-
nahme näher zu begründen.
Zunächst sei der Wortlaut jener Insinuation ge-
geben, die dazu bestimmt war, den Kritiker gegen
Borchardt aufzuhetzen: „Dieser Mann, schon etwas
älter als ich, ist in Dresden und Tegernsee im Ganzen
drei volle Jahre mein Schüler gewesen. Anstatt
sich selbst zu finden, stahl er mir meine miss sn puZss
(soll wohl heißen: Formatbildung), meine Palette, Alles,
was einem Anderen gehört (? Die Red.) und was
man ihm nicht nehmen darf. Nun stellt er in Aus-
stellungen Bilder aus, die er als vorbildliche Studien
betrachten sollte und nie ausstellen durfte*), namentlich
nicht unter seinem Namen." Auf diese Anklage giebt
Borchardt, der übrigens schon zu jener fraglichen Zeit
kein llomo U0VU8 in der Kunst mehr war, die folgende
Erklärung:
*) Borchardt behauptet, daß von den bei Bing in Paris ausge-
stellten 53 Bildern Stremel überhaupt nur H oder 5 gesehen
haben konnte.