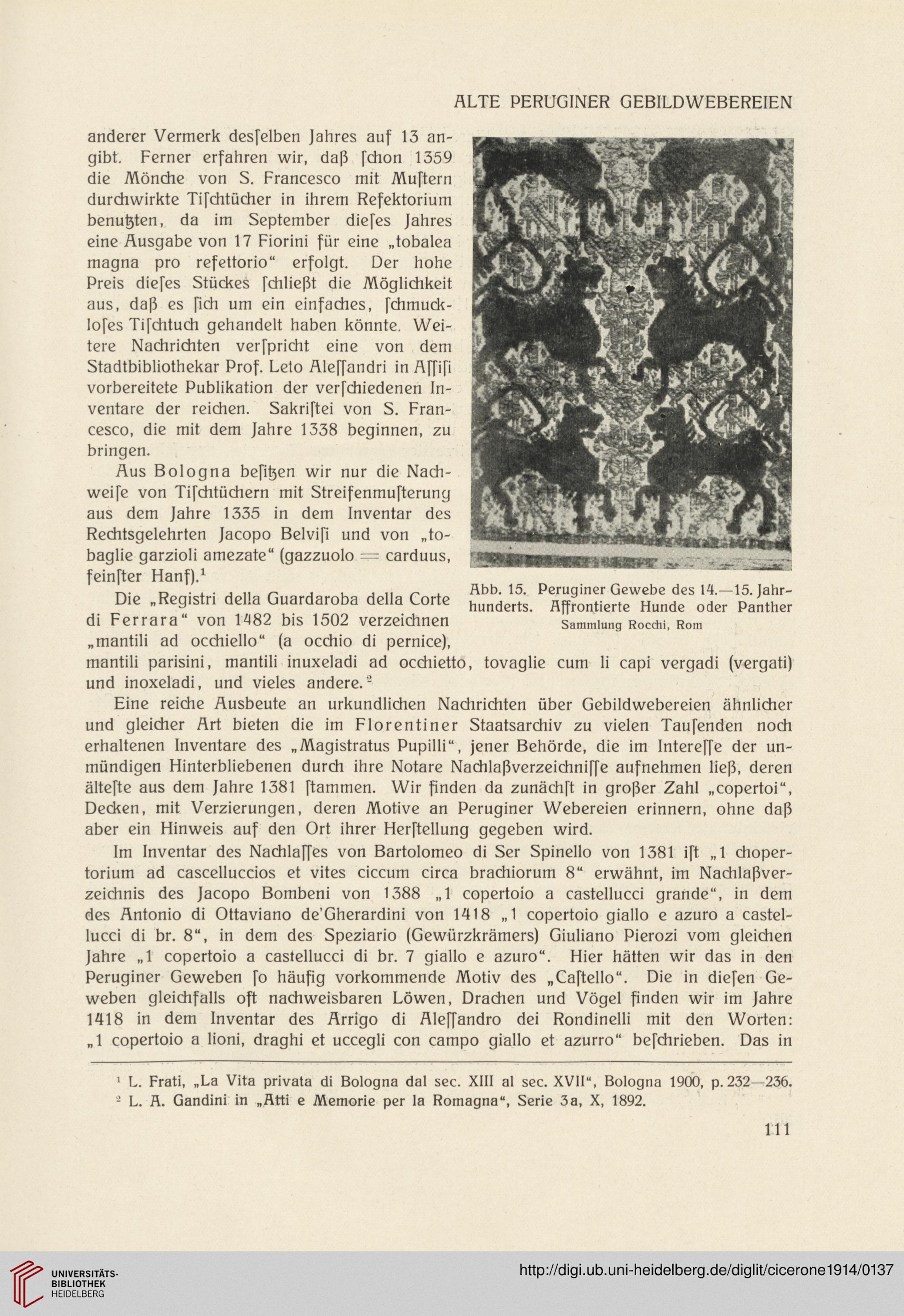Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0137
DOI issue:
4. Heft
DOI article:Bombe, Walter: Alte peruginer Gebildwebereien, [2]
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0137
ALTE PERUGINER GEBILDWEBEREIEN
anderer Vermerk desfelben Jahres auf 13 an-
gibt. Ferner erfahren wir, daß fchon 1359
die Mönche von S. Francesco mit Muftern
durchwirkte Tifchtücher in ihrem Refektorium
benutzten, da im September diefes Jahres
eine Ausgabe von 17 Fiorini für eine „tobalea
magna pro refettorio“ erfolgt. Der hohe
Preis diefes Stückes fchließt die Möglichkeit
aus, daß es fich um ein einfaches, fchmuck-
lofes Tifchtuch gehandelt haben könnte. Wei-
tere Nachrichten verfpricht eine von dem
Stadtbibliothekar Prof. Leto Aleffandri in Affifi
vorbereitete Publikation der verfchiedenen In-
ventare der reichen. Sakriftei von S. Fran-
cesco, die mit dem Jahre 1338 beginnen, zu
bringen.
Aus Bologna befißen wir nur die Nach-
weife von Tifditüchern mit Streifenmufterung
aus dem Jahre 1335 in dem Inventar des
Rechtsgelehrten Jacopo Belvifi und von „to-
baglie garzioli amezate“ (gazzuolo = carduus,
feinfter Hanf).1
Die „Registri della Guardaroba della Corte
di Ferrara“ von 1482 bis 1502 verzeichnen
„mantili ad occhiello“ (a occhio di pernice),
mantili parisini, mantili inuxeladi ad occhietto, tovaglie cum li capi vergadi (vergati)
und inoxeladi, und vieles andere.2
Eine reiche Ausbeute an urkundlichen Nachrichten über Gebildwebereien ähnlicher
und gleicher Art bieten die im Florentiner Staatsarchiv zu vielen Taufenden noch
erhaltenen Inventare des „Magistratus Pupilli“, jener Behörde, die im Intereffe der un-
mündigen Hinterbliebenen durch ihre Notare Nachlaßverzeichniffe aufnehmen ließ, deren
ältefte aus dem Jahre 1381 ftammen. Wir finden da zunächft in großer Zahl „copertoi“,
Decken, mit Verzierungen, deren Motive an Peruginer Webereien erinnern, ohne daß
aber ein Hinweis auf den Ort ihrer Herftellung gegeben wird.
Im Inventar des Nachlaßes von Bartolomeo di Ser Spinello von 1381 ift „1 choper-
torium ad cascelluccios et vites ciccum circa brachiorum 8“ erwähnt, im Nachlaßver-
zeichnis des Jacopo Bombeni von 1388 „1 copertoio a castellucci grande“, in dem
des Antonio di Ottaviano de’Gherardini von 1418 „1 copertoio giallo e azuro a castel-
lucci di br. 8“, in dem des Speziario (Gewürzkrämers) Giuliano Pierozi vom gleichen
Jahre „1 copertoio a castellucci di br. 7 giallo e azuro“. Hier hätten wir das in den
Peruginer Geweben fo häufig vorkommende Motiv des „Caftello“. Die in diefen Ge-
weben gleichfalls oft nachweisbaren Löwen, Drachen und Vögel finden wir im Jahre
1418 in dem Inventar des Arrigo di Aleffandro dei Rondinelli mit den Worten:
„1 copertoio a lioni, draghi et uccegli con campo giallo et azurro“ befchrieben. Das in
Äbb. 15. Peruginer Gewebe des 14.—15. Jahr-
hunderts. flffrontierte Hunde oder Panther
Sammlung Rocchi, Rom
1 L. Frati, „La Vita privata di Bologna dal sec. XIII al sec. XVII“, Bologna 1900, p. 232—236.
L. Ä. Gandini in „Ätti e Memorie per la Romagna“, Serie 3a, X, 1892.
111
anderer Vermerk desfelben Jahres auf 13 an-
gibt. Ferner erfahren wir, daß fchon 1359
die Mönche von S. Francesco mit Muftern
durchwirkte Tifchtücher in ihrem Refektorium
benutzten, da im September diefes Jahres
eine Ausgabe von 17 Fiorini für eine „tobalea
magna pro refettorio“ erfolgt. Der hohe
Preis diefes Stückes fchließt die Möglichkeit
aus, daß es fich um ein einfaches, fchmuck-
lofes Tifchtuch gehandelt haben könnte. Wei-
tere Nachrichten verfpricht eine von dem
Stadtbibliothekar Prof. Leto Aleffandri in Affifi
vorbereitete Publikation der verfchiedenen In-
ventare der reichen. Sakriftei von S. Fran-
cesco, die mit dem Jahre 1338 beginnen, zu
bringen.
Aus Bologna befißen wir nur die Nach-
weife von Tifditüchern mit Streifenmufterung
aus dem Jahre 1335 in dem Inventar des
Rechtsgelehrten Jacopo Belvifi und von „to-
baglie garzioli amezate“ (gazzuolo = carduus,
feinfter Hanf).1
Die „Registri della Guardaroba della Corte
di Ferrara“ von 1482 bis 1502 verzeichnen
„mantili ad occhiello“ (a occhio di pernice),
mantili parisini, mantili inuxeladi ad occhietto, tovaglie cum li capi vergadi (vergati)
und inoxeladi, und vieles andere.2
Eine reiche Ausbeute an urkundlichen Nachrichten über Gebildwebereien ähnlicher
und gleicher Art bieten die im Florentiner Staatsarchiv zu vielen Taufenden noch
erhaltenen Inventare des „Magistratus Pupilli“, jener Behörde, die im Intereffe der un-
mündigen Hinterbliebenen durch ihre Notare Nachlaßverzeichniffe aufnehmen ließ, deren
ältefte aus dem Jahre 1381 ftammen. Wir finden da zunächft in großer Zahl „copertoi“,
Decken, mit Verzierungen, deren Motive an Peruginer Webereien erinnern, ohne daß
aber ein Hinweis auf den Ort ihrer Herftellung gegeben wird.
Im Inventar des Nachlaßes von Bartolomeo di Ser Spinello von 1381 ift „1 choper-
torium ad cascelluccios et vites ciccum circa brachiorum 8“ erwähnt, im Nachlaßver-
zeichnis des Jacopo Bombeni von 1388 „1 copertoio a castellucci grande“, in dem
des Antonio di Ottaviano de’Gherardini von 1418 „1 copertoio giallo e azuro a castel-
lucci di br. 8“, in dem des Speziario (Gewürzkrämers) Giuliano Pierozi vom gleichen
Jahre „1 copertoio a castellucci di br. 7 giallo e azuro“. Hier hätten wir das in den
Peruginer Geweben fo häufig vorkommende Motiv des „Caftello“. Die in diefen Ge-
weben gleichfalls oft nachweisbaren Löwen, Drachen und Vögel finden wir im Jahre
1418 in dem Inventar des Arrigo di Aleffandro dei Rondinelli mit den Worten:
„1 copertoio a lioni, draghi et uccegli con campo giallo et azurro“ befchrieben. Das in
Äbb. 15. Peruginer Gewebe des 14.—15. Jahr-
hunderts. flffrontierte Hunde oder Panther
Sammlung Rocchi, Rom
1 L. Frati, „La Vita privata di Bologna dal sec. XIII al sec. XVII“, Bologna 1900, p. 232—236.
L. Ä. Gandini in „Ätti e Memorie per la Romagna“, Serie 3a, X, 1892.
111