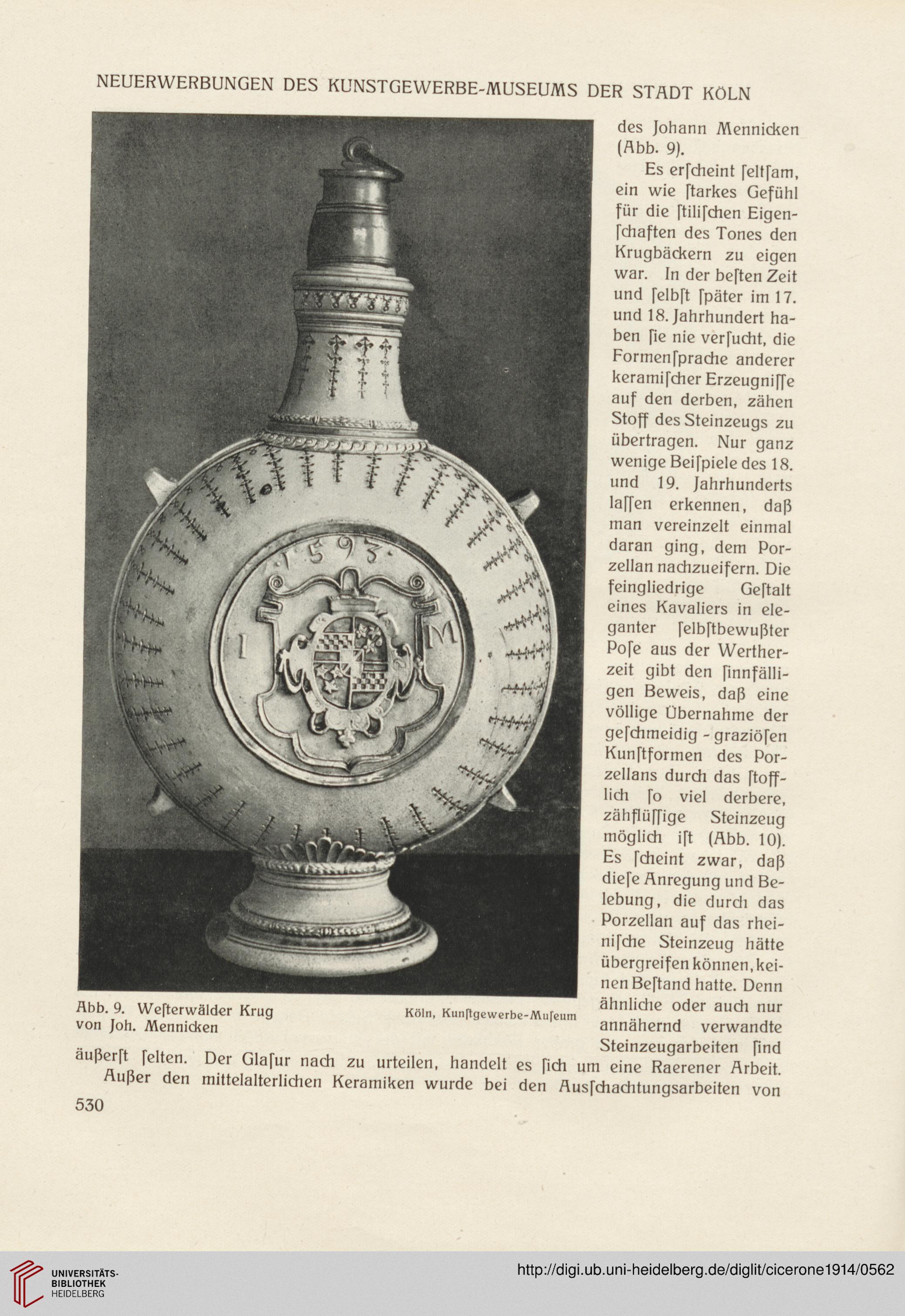Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0562
DOI Heft:
15. Heft
DOI Artikel:Lüthgen, Eugen: Neuerwerbungen des Kunstgewerbe-Museums der Stadt Köln
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0562
NEUERWERBUNGEN DES KUNSTGEWERBE-MUSEUMS DER STADT KÖLN
des Johann Mennicken
(Abb. 9).
Es erfcheint feltfam,
ein wie ftarkes Gefühl
für die ftilifchen Eigen-
fchaften des Tones den
Krugbäckern zu eigen
war. ln der beften Zeit
und felbft fpäter im 17.
und 18. Jahrhundert ha-
ben fie nie verfucht, die
Formenfprache anderer
keramifcher Erzeugniffe
auf den derben, zähen
Stoff des Steinzeugs zu
übertragen. Nur ganz
wenige Beifpiele des 18.
und 19. Jahrhunderts
laffen erkennen, daß
man vereinzelt einmal
daran ging, dem Por-
zellan nachzueifern. Die
feingliedrige Geftalt
eines Kavaliers in ele-
ganter felbftbewußter
Pofe aus der Werther-
zeit gibt den finnfälli-
gen Beweis, daß eine
völlige Übernahme der
gefchmeidig - graziöfen
Kunftformen des Por-
zellans durch das ftoff-
lich fo viel derbere,
zähflüffige Steinzeug
möglich ift (Abb. 10).
Es fcheint zwar, daß
diefe Anregung und Be-
lebung, die durdi das
Porzellan auf das rhei-
nifche Steinzeug hätte
übergreifen können,kei-
nen Beftand hatte. Denn
ähnliche oder auch nur
annähernd verwandte
Steinzeugarbeiten find
äußerft feiten. Der Glafur nach zu urteilen, handelt es fich um eine Raerener Arbeit.
Außer den mittelalterlichen Keramiken wurde bei den Ausfehachtungsarbeiten von
Äbb. 9. Wefterwälder Krug Köln, Kunftgewerbe-Mufeum
von Joh. Mennicken
530
des Johann Mennicken
(Abb. 9).
Es erfcheint feltfam,
ein wie ftarkes Gefühl
für die ftilifchen Eigen-
fchaften des Tones den
Krugbäckern zu eigen
war. ln der beften Zeit
und felbft fpäter im 17.
und 18. Jahrhundert ha-
ben fie nie verfucht, die
Formenfprache anderer
keramifcher Erzeugniffe
auf den derben, zähen
Stoff des Steinzeugs zu
übertragen. Nur ganz
wenige Beifpiele des 18.
und 19. Jahrhunderts
laffen erkennen, daß
man vereinzelt einmal
daran ging, dem Por-
zellan nachzueifern. Die
feingliedrige Geftalt
eines Kavaliers in ele-
ganter felbftbewußter
Pofe aus der Werther-
zeit gibt den finnfälli-
gen Beweis, daß eine
völlige Übernahme der
gefchmeidig - graziöfen
Kunftformen des Por-
zellans durch das ftoff-
lich fo viel derbere,
zähflüffige Steinzeug
möglich ift (Abb. 10).
Es fcheint zwar, daß
diefe Anregung und Be-
lebung, die durdi das
Porzellan auf das rhei-
nifche Steinzeug hätte
übergreifen können,kei-
nen Beftand hatte. Denn
ähnliche oder auch nur
annähernd verwandte
Steinzeugarbeiten find
äußerft feiten. Der Glafur nach zu urteilen, handelt es fich um eine Raerener Arbeit.
Außer den mittelalterlichen Keramiken wurde bei den Ausfehachtungsarbeiten von
Äbb. 9. Wefterwälder Krug Köln, Kunftgewerbe-Mufeum
von Joh. Mennicken
530