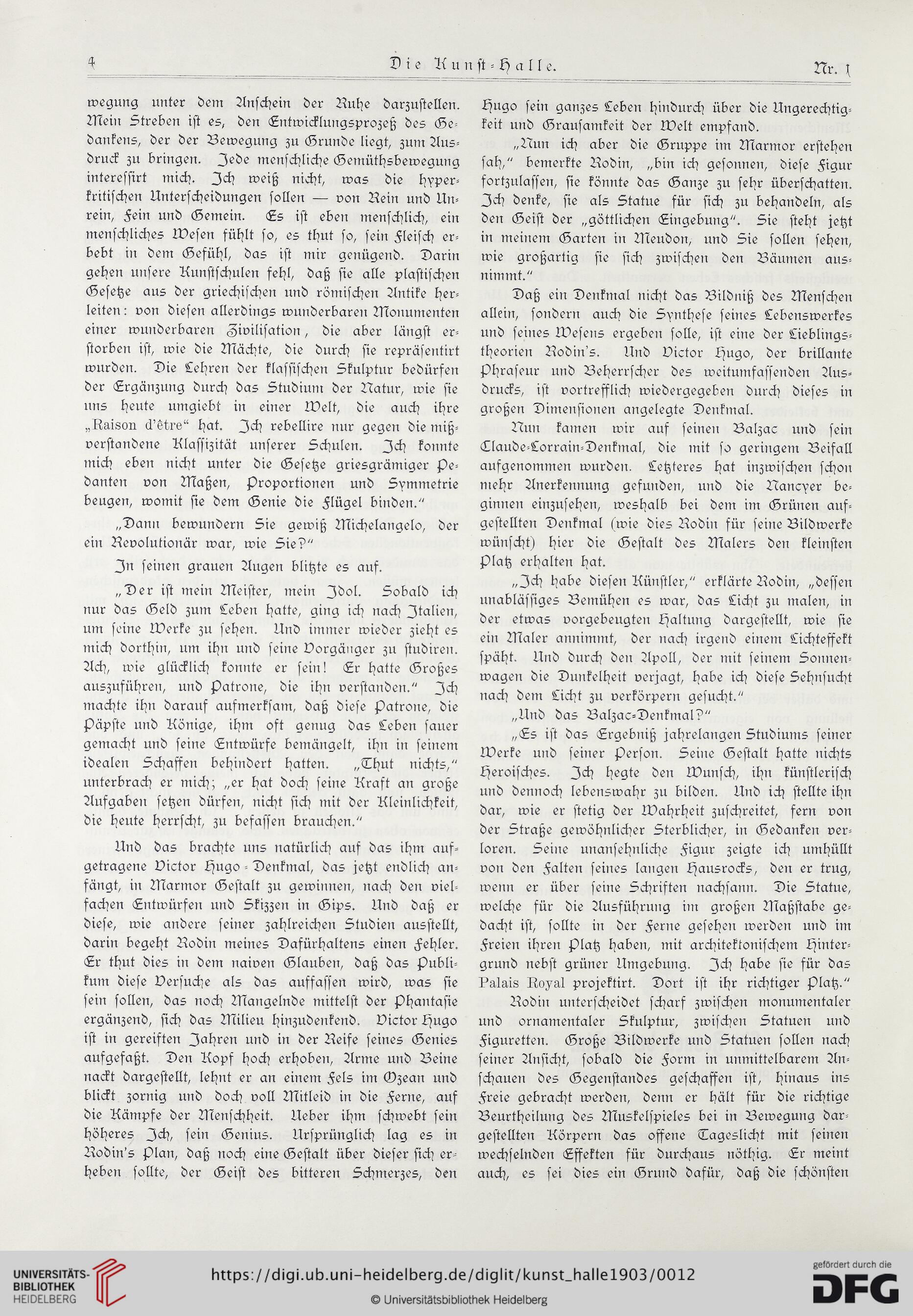Die K u n st - h a l l e.
Nr. s
wegung unter dem Anschein der Ruhe darzustellen.
Mein Streben ist es, den Entwicklungsprozeß des Ge-
dankens, der der Bewegung zu Grunde liegt, zum Aus-
druck zu bringen. Jede menschliche Gemüthsbewegung
interessirt mich. Ich weiß nicht, was die hyper-
kritischen Unterscheidungen sollen — von Rein und Un-
rein, Lein und Gemein. Ls ist eben menschlich, ein
menschliches Wesen fühlt so, es thut so, sein Fleisch er-
bebt in dem Gefühl, das ist mir genügend. Darin
gehen unsere Kunstschulen fehl, daß sie alle plastischen
Gesetze aus der griechischen und römischen Antike her-
leiten : von diesen allerdings wunderbaren Monumenten
einer wunderbaren Zivilisation, die aber längst er-
storben ist, wie die Mächte, die durch sie repräsentirt
wurden. Die Lehren der klassischen Skulptur bedürfen
der Ergänzung durch das Studium der Natur, wie sie
uns heute umgiebt in einer Welt, die auch ihre
„R^ou ä'tztrs" hat. Ich rebellire nur gegen die miß-
verstandene Klassizität unserer Schulen. Ich konnte
mich eben nicht unter die Gesetze griesgrämiger Pe-
danten von Maßen, Proportionen und Symmetrie
beugen, womit sie dem Genie die Flügel binden."
„Dann bewundern Sie gewiß Michelangelo, der
ein Revolutionär war, wie Sie?"
In seinen grauen Augen blitzte es auf.
„Der ist mein Meister, mein Idol. Sobald ich
nur das Geld zum Leben hatte, ging ich nach Italien,
um seine Werke zu sehen. Und immer wieder zieht es
mich dorthin, um ihn und seine Vorgänger zu studiren.
Ach, wie glücklich konnte er sein! Er hatte Großes
auszuführen, und Patrone, die ihn verstanden." Ich
machte ihn darauf aufmerksam, daß diese Patrone, die
Päpste und Könige, ihm oft genug das Leben sauer
gemacht und seine Entwürfe bemängelt, ihn in seinem
idealen Schaffen behindert hatten. „Thut nichts,"
unterbrach er mich; „er hat doch seine Kraft an große
Aufgaben setzen dürfen, nicht sich mit der Kleinlichkeit,
die heute herrscht, zu befassen brauchen."
Und das brachte uns natürlich auf das ihm auf-
getragene Victor Hugo - Denkmal, das setzt endlich an-
fängt, in Marmor Gestalt zu gewinnen, nach den viel-
fachen Entwürfen und Skizzen in Gips. Und daß er
diese, wie andere seiner zahlreichen Studien ausstellt,
darin begeht Rodin meines Dafürhaltens einen Fehler.
Er thut dies in dem naiven Glauben, daß das Publi-
kum diese Versuche als das auffassen wird, was sie
sein sollen, das noch Mangelnde mittelst der Phantasie
ergänzend, sich das Milieu hinzudenkend. Victor Hugo
ist in gereiften Jahren und in der Reife seines Genies
aufgefaßt. Den Kopf hoch erhoben, Arme und Beine
nackt dargestellt, lehnt er an einem Fels im Ozean und
blickt zornig und doch voll Mitleid in die Ferne, auf
die Kämpfe der Menschheit. Ueber ihm schwebt sein
höheres Ich, sein Genius. Ursprünglich lag es in
Rodin's plan, daß noch eine Gestalt über dieser sich er-
heben sollte, der Geist des bitteren Schmerzes, den
Hugo sein ganzes Leben hindurch über die Ungerechtig-
keit und Grausamkeit der Welt empfand.
„Nun ich aber die Gruppe im Marmor erstehen
sah," bemerkte Rodin, „bin ich gesonnen, diese Figur
fortzulassen, sie könnte das Ganze zu sehr überschatten.
Ich denke, sie als Statue für sich zu behandeln, als
den Geist der „göttlichen Eingebung". Sie steht setzt
in meinem Garten in Meudon, und Sie sollen sehen,
wie großartig sie sich zwischen den Bäumen aus-
nimmt."
Daß ein Denkmal nicht das Bildniß des Menschen
allein, sondern auch die Synthese seines Lebenswerkes
und seines Wesens ergeben solle, ist eine der Lieblings-
theorien Rodin's. Und Victor Hugo, der brillante
phraseur und Beherrscher des weitumfassenden Aus-
drucks, ist vortrefflich wiedergegeben durch dieses in
großen Dimensionen angelegte Denkmal.
Nun kamen wir auf seinen Balzac und sein
Llaude-Lorrain-Denkmal, die nut so geringem Beifall
aufgenommen wurden. Letzteres hat inzwischen schon
niehr Anerkennung gefunden, und die Nancyer be-
ginnen einzusehen, weshalb bei dem im Grünen auf-
gestellten Denkmal (wie dies Rodin für seine Bildwerke
wünscht) hier die Gestalt des Malers den kleinsten
Platz erhalten hat.
„Ich habe diesen Künstler," erklärte Rodin, „dessen
unablässiges Bemühen es war, das Licht zu malen, in
der etwas vorgebeugten Haltung dargestellt, wie sie
ein Maler annimmt, der nach irgend einem Lichteffekt
späht. Und durch den Apoll, der mit seinem Sonnen-
wagen die Dunkelheit versagt, habe ich diese Sehnsucht
nach dem Licht zu verkörpern gesucht."
„Und das Balzac-Denkmal?"
„Ls ist das Lrgebniß jahrelangen Studiums seiner
Werke und seiner Person. Seine Gestalt hatte nichts
heroisches. Ich hegte den Wunsch, ihn künstlerisch
und dennoch lebenswahr zu bilden. Und ich stellte ihn
dar, wie er stetig der Wahrheit zuschreitet, fern von
der Straße gewöhnlicher Sterblicher, in Gedanken ver-
loren. Seine unansehnliche Figur zeigte ich umhüllt
von den Falten seines langen Hausrocks, den er trug,
wenn er über seine Schriften nachsann. Die Statue,
welche für die Ausführung im großen Maßstabe ge-
dacht ist, sollte in der Ferne gesehen werden und im
Freien ihren Platz haben, mit architektonischem Hinter-
grund nebst grüner Umgebung. Ich habe sie für das
Valais Royal xrojektirt. Dort ist ihr richtiger Platz."
Rodin unterscheidet scharf zwischen monumentaler
und ornamentaler Skulptur, zwischen Statuen und
Figuretten. Große Bildwerke und Statuen sollen nach
seiner Ansicht, sobald die Form in unmittelbarem An-
schauen des Gegenstandes geschaffen ist, hinaus ins
Freie gebracht werden, denn er hält für die richtige
Beurtheilung des Muskelspieles bei in Bewegung dar-
gestellten Körpern das offene Tageslicht mit seinen
wechselnden Effekten für durchaus nöthig. Er meint
auch, es sei dies ein Grund dafür, daß die schönsten
Nr. s
wegung unter dem Anschein der Ruhe darzustellen.
Mein Streben ist es, den Entwicklungsprozeß des Ge-
dankens, der der Bewegung zu Grunde liegt, zum Aus-
druck zu bringen. Jede menschliche Gemüthsbewegung
interessirt mich. Ich weiß nicht, was die hyper-
kritischen Unterscheidungen sollen — von Rein und Un-
rein, Lein und Gemein. Ls ist eben menschlich, ein
menschliches Wesen fühlt so, es thut so, sein Fleisch er-
bebt in dem Gefühl, das ist mir genügend. Darin
gehen unsere Kunstschulen fehl, daß sie alle plastischen
Gesetze aus der griechischen und römischen Antike her-
leiten : von diesen allerdings wunderbaren Monumenten
einer wunderbaren Zivilisation, die aber längst er-
storben ist, wie die Mächte, die durch sie repräsentirt
wurden. Die Lehren der klassischen Skulptur bedürfen
der Ergänzung durch das Studium der Natur, wie sie
uns heute umgiebt in einer Welt, die auch ihre
„R^ou ä'tztrs" hat. Ich rebellire nur gegen die miß-
verstandene Klassizität unserer Schulen. Ich konnte
mich eben nicht unter die Gesetze griesgrämiger Pe-
danten von Maßen, Proportionen und Symmetrie
beugen, womit sie dem Genie die Flügel binden."
„Dann bewundern Sie gewiß Michelangelo, der
ein Revolutionär war, wie Sie?"
In seinen grauen Augen blitzte es auf.
„Der ist mein Meister, mein Idol. Sobald ich
nur das Geld zum Leben hatte, ging ich nach Italien,
um seine Werke zu sehen. Und immer wieder zieht es
mich dorthin, um ihn und seine Vorgänger zu studiren.
Ach, wie glücklich konnte er sein! Er hatte Großes
auszuführen, und Patrone, die ihn verstanden." Ich
machte ihn darauf aufmerksam, daß diese Patrone, die
Päpste und Könige, ihm oft genug das Leben sauer
gemacht und seine Entwürfe bemängelt, ihn in seinem
idealen Schaffen behindert hatten. „Thut nichts,"
unterbrach er mich; „er hat doch seine Kraft an große
Aufgaben setzen dürfen, nicht sich mit der Kleinlichkeit,
die heute herrscht, zu befassen brauchen."
Und das brachte uns natürlich auf das ihm auf-
getragene Victor Hugo - Denkmal, das setzt endlich an-
fängt, in Marmor Gestalt zu gewinnen, nach den viel-
fachen Entwürfen und Skizzen in Gips. Und daß er
diese, wie andere seiner zahlreichen Studien ausstellt,
darin begeht Rodin meines Dafürhaltens einen Fehler.
Er thut dies in dem naiven Glauben, daß das Publi-
kum diese Versuche als das auffassen wird, was sie
sein sollen, das noch Mangelnde mittelst der Phantasie
ergänzend, sich das Milieu hinzudenkend. Victor Hugo
ist in gereiften Jahren und in der Reife seines Genies
aufgefaßt. Den Kopf hoch erhoben, Arme und Beine
nackt dargestellt, lehnt er an einem Fels im Ozean und
blickt zornig und doch voll Mitleid in die Ferne, auf
die Kämpfe der Menschheit. Ueber ihm schwebt sein
höheres Ich, sein Genius. Ursprünglich lag es in
Rodin's plan, daß noch eine Gestalt über dieser sich er-
heben sollte, der Geist des bitteren Schmerzes, den
Hugo sein ganzes Leben hindurch über die Ungerechtig-
keit und Grausamkeit der Welt empfand.
„Nun ich aber die Gruppe im Marmor erstehen
sah," bemerkte Rodin, „bin ich gesonnen, diese Figur
fortzulassen, sie könnte das Ganze zu sehr überschatten.
Ich denke, sie als Statue für sich zu behandeln, als
den Geist der „göttlichen Eingebung". Sie steht setzt
in meinem Garten in Meudon, und Sie sollen sehen,
wie großartig sie sich zwischen den Bäumen aus-
nimmt."
Daß ein Denkmal nicht das Bildniß des Menschen
allein, sondern auch die Synthese seines Lebenswerkes
und seines Wesens ergeben solle, ist eine der Lieblings-
theorien Rodin's. Und Victor Hugo, der brillante
phraseur und Beherrscher des weitumfassenden Aus-
drucks, ist vortrefflich wiedergegeben durch dieses in
großen Dimensionen angelegte Denkmal.
Nun kamen wir auf seinen Balzac und sein
Llaude-Lorrain-Denkmal, die nut so geringem Beifall
aufgenommen wurden. Letzteres hat inzwischen schon
niehr Anerkennung gefunden, und die Nancyer be-
ginnen einzusehen, weshalb bei dem im Grünen auf-
gestellten Denkmal (wie dies Rodin für seine Bildwerke
wünscht) hier die Gestalt des Malers den kleinsten
Platz erhalten hat.
„Ich habe diesen Künstler," erklärte Rodin, „dessen
unablässiges Bemühen es war, das Licht zu malen, in
der etwas vorgebeugten Haltung dargestellt, wie sie
ein Maler annimmt, der nach irgend einem Lichteffekt
späht. Und durch den Apoll, der mit seinem Sonnen-
wagen die Dunkelheit versagt, habe ich diese Sehnsucht
nach dem Licht zu verkörpern gesucht."
„Und das Balzac-Denkmal?"
„Ls ist das Lrgebniß jahrelangen Studiums seiner
Werke und seiner Person. Seine Gestalt hatte nichts
heroisches. Ich hegte den Wunsch, ihn künstlerisch
und dennoch lebenswahr zu bilden. Und ich stellte ihn
dar, wie er stetig der Wahrheit zuschreitet, fern von
der Straße gewöhnlicher Sterblicher, in Gedanken ver-
loren. Seine unansehnliche Figur zeigte ich umhüllt
von den Falten seines langen Hausrocks, den er trug,
wenn er über seine Schriften nachsann. Die Statue,
welche für die Ausführung im großen Maßstabe ge-
dacht ist, sollte in der Ferne gesehen werden und im
Freien ihren Platz haben, mit architektonischem Hinter-
grund nebst grüner Umgebung. Ich habe sie für das
Valais Royal xrojektirt. Dort ist ihr richtiger Platz."
Rodin unterscheidet scharf zwischen monumentaler
und ornamentaler Skulptur, zwischen Statuen und
Figuretten. Große Bildwerke und Statuen sollen nach
seiner Ansicht, sobald die Form in unmittelbarem An-
schauen des Gegenstandes geschaffen ist, hinaus ins
Freie gebracht werden, denn er hält für die richtige
Beurtheilung des Muskelspieles bei in Bewegung dar-
gestellten Körpern das offene Tageslicht mit seinen
wechselnden Effekten für durchaus nöthig. Er meint
auch, es sei dies ein Grund dafür, daß die schönsten