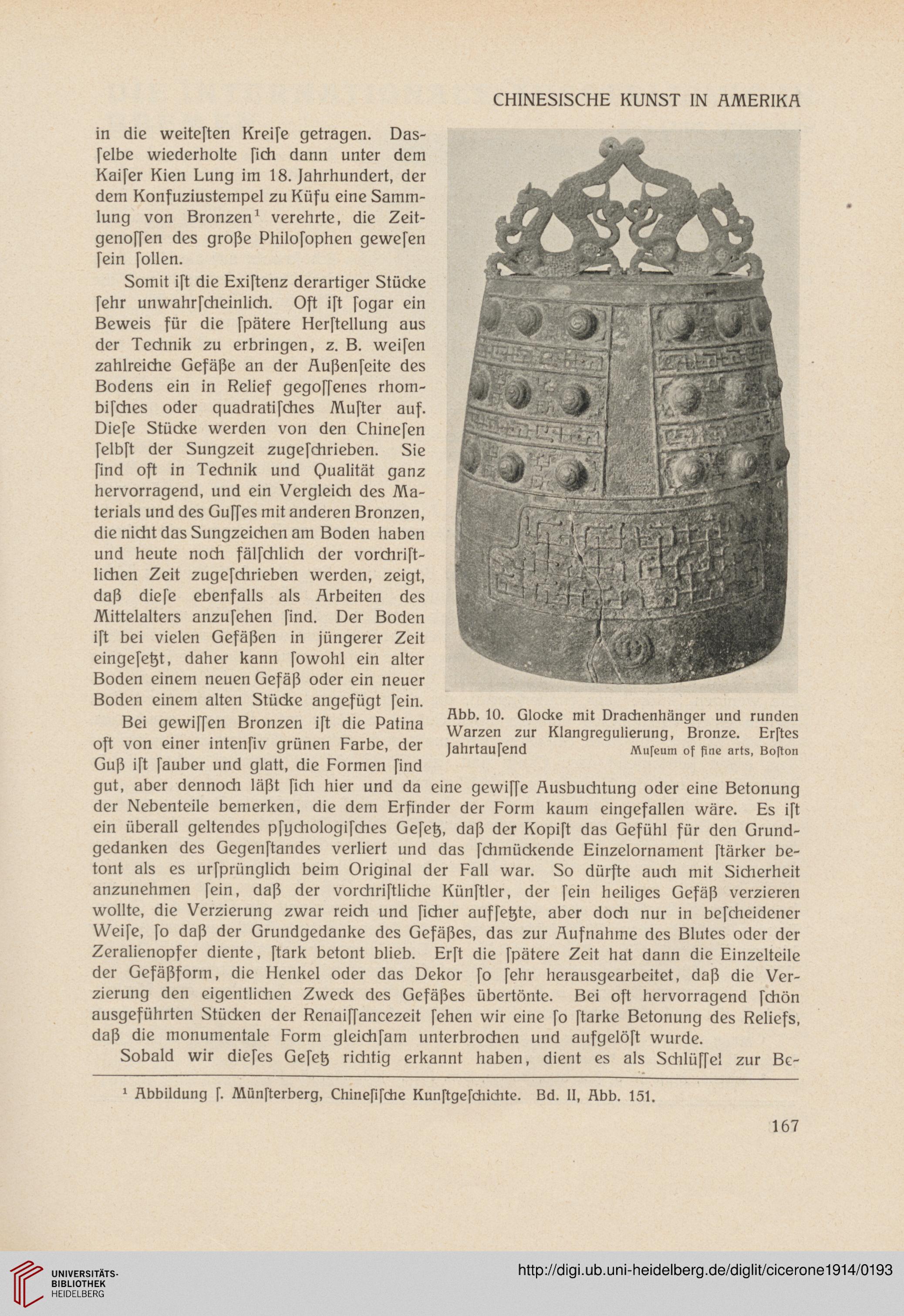Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 6.1914
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0193
DOI Heft:
5. Heft
DOI Artikel:Münsterberg, Oskar: Chinesische Kunst in Amerika, [1]
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.26375#0193
CHINESISCHE KUNST IN AMERIKA
in die weiteren Kreife getragen. Das-
felbe wiederholte fich dann unter dem
Kaifer Kien Lung im 18. Jahrhundert, der
dem Konfuziustempel zu Küfu eine Samm-
lung von Bronzen1 verehrte, die Zeit-
genoffen des große Philofophen gewefen
fein follen.
Somit ift die Exiftenz derartiger Stücke
fehr unwahrfcheinlich. Oft ift fogar ein
Beweis für die fpätere Herftellung aus
der Technik zu erbringen, z. B. weifen
zahlreiche Gefäße an der Außenfeite des
Bodens ein in Relief gegoffenes rhom-
bifches oder quadratifches Mufter auf.
Diefe Stücke werden von den Chinefen
felbft der Sungzeit zugefchrieben. Sie
find oft in Technik und Qualität ganz
hervorragend, und ein Vergleich des Ma-
terials und des Guffes mit anderen Bronzen,
die nicht das Sungzeichen am Boden haben
und heute noch fälfchlich der vorchrift-
lichen Zeit zugefchrieben werden, zeigt,
daß diefe ebenfalls als Arbeiten des
Mittelalters anzufehen find. Der Boden
ift bei vielen Gefäßen in jüngerer Zeit
eingefeßt, daher kann fowohl ein alter
Boden einem neuen Gefäß oder ein neuer
Boden einem alten Stücke angefügt fein.
„ . n Abb. 10. Glocke mit Dradienhänqer und runden
Bei gewiffen Bronzen ift die Patina Warzen ZUf Klangregulierung, Bronze. Erftes
oft von einer intenfiv grünen Farbe, der jahrtaufend Mufeum of fine arts, Bofton
Guß ift fauber und glatt, die Formen find
gut, aber dennoch läßt fich hier und da eine gewiffe Ausbuchtung oder eine Betonung
der Nebenteile bemerken, die dem Erfinder der Form kaum eingefallen wäre. Es ift
ein überall geltendes pfychologifches Gefeß, daß der Kopift das Gefühl für den Grund-
gedanken des Gegenftandes verliert und das fchmückende Einzelornament ftärker be-
tont als es urfprünglich beim Original der Fall war. So dürfte auch mit Sicherheit
anzunehmen fein, daß der vorchriftliche Künftler, der fein heiliges Gefäß verzieren
wollte, die Verzierung zwar reich und ficher auffeßte, aber doch nur in befcheidener
Weife, fo daß der Grundgedanke des Gefäßes, das zur Aufnahme des Blutes oder der
Zeralienopfer diente, ftark betont blieb. Erft die fpätere Zeit hat dann die Einzelteile
der Gefäßform, die Henkel oder das Dekor fo fehr herausgearbeitet, daß die Ver-
zierung den eigentlichen Zweck des Gefäßes übertönte. Bei oft hervorragend fchön
ausgeführten Stücken der Renaiffancezeit fehen wir eine fo ftarke Betonung des Reliefs,
daß die monumentale Form gleichfam unterbrochen und aufgelöft wurde.
Sobald wir diefes Gefeß richtig erkannt haben, dient es als Schlüffe! zur Be-
1 Abbildung f. Münfterberg, Chinefifche Kunftgefdiidite. Bd. II, Hbb. 151.
in die weiteren Kreife getragen. Das-
felbe wiederholte fich dann unter dem
Kaifer Kien Lung im 18. Jahrhundert, der
dem Konfuziustempel zu Küfu eine Samm-
lung von Bronzen1 verehrte, die Zeit-
genoffen des große Philofophen gewefen
fein follen.
Somit ift die Exiftenz derartiger Stücke
fehr unwahrfcheinlich. Oft ift fogar ein
Beweis für die fpätere Herftellung aus
der Technik zu erbringen, z. B. weifen
zahlreiche Gefäße an der Außenfeite des
Bodens ein in Relief gegoffenes rhom-
bifches oder quadratifches Mufter auf.
Diefe Stücke werden von den Chinefen
felbft der Sungzeit zugefchrieben. Sie
find oft in Technik und Qualität ganz
hervorragend, und ein Vergleich des Ma-
terials und des Guffes mit anderen Bronzen,
die nicht das Sungzeichen am Boden haben
und heute noch fälfchlich der vorchrift-
lichen Zeit zugefchrieben werden, zeigt,
daß diefe ebenfalls als Arbeiten des
Mittelalters anzufehen find. Der Boden
ift bei vielen Gefäßen in jüngerer Zeit
eingefeßt, daher kann fowohl ein alter
Boden einem neuen Gefäß oder ein neuer
Boden einem alten Stücke angefügt fein.
„ . n Abb. 10. Glocke mit Dradienhänqer und runden
Bei gewiffen Bronzen ift die Patina Warzen ZUf Klangregulierung, Bronze. Erftes
oft von einer intenfiv grünen Farbe, der jahrtaufend Mufeum of fine arts, Bofton
Guß ift fauber und glatt, die Formen find
gut, aber dennoch läßt fich hier und da eine gewiffe Ausbuchtung oder eine Betonung
der Nebenteile bemerken, die dem Erfinder der Form kaum eingefallen wäre. Es ift
ein überall geltendes pfychologifches Gefeß, daß der Kopift das Gefühl für den Grund-
gedanken des Gegenftandes verliert und das fchmückende Einzelornament ftärker be-
tont als es urfprünglich beim Original der Fall war. So dürfte auch mit Sicherheit
anzunehmen fein, daß der vorchriftliche Künftler, der fein heiliges Gefäß verzieren
wollte, die Verzierung zwar reich und ficher auffeßte, aber doch nur in befcheidener
Weife, fo daß der Grundgedanke des Gefäßes, das zur Aufnahme des Blutes oder der
Zeralienopfer diente, ftark betont blieb. Erft die fpätere Zeit hat dann die Einzelteile
der Gefäßform, die Henkel oder das Dekor fo fehr herausgearbeitet, daß die Ver-
zierung den eigentlichen Zweck des Gefäßes übertönte. Bei oft hervorragend fchön
ausgeführten Stücken der Renaiffancezeit fehen wir eine fo ftarke Betonung des Reliefs,
daß die monumentale Form gleichfam unterbrochen und aufgelöft wurde.
Sobald wir diefes Gefeß richtig erkannt haben, dient es als Schlüffe! zur Be-
1 Abbildung f. Münfterberg, Chinefifche Kunftgefdiidite. Bd. II, Hbb. 151.