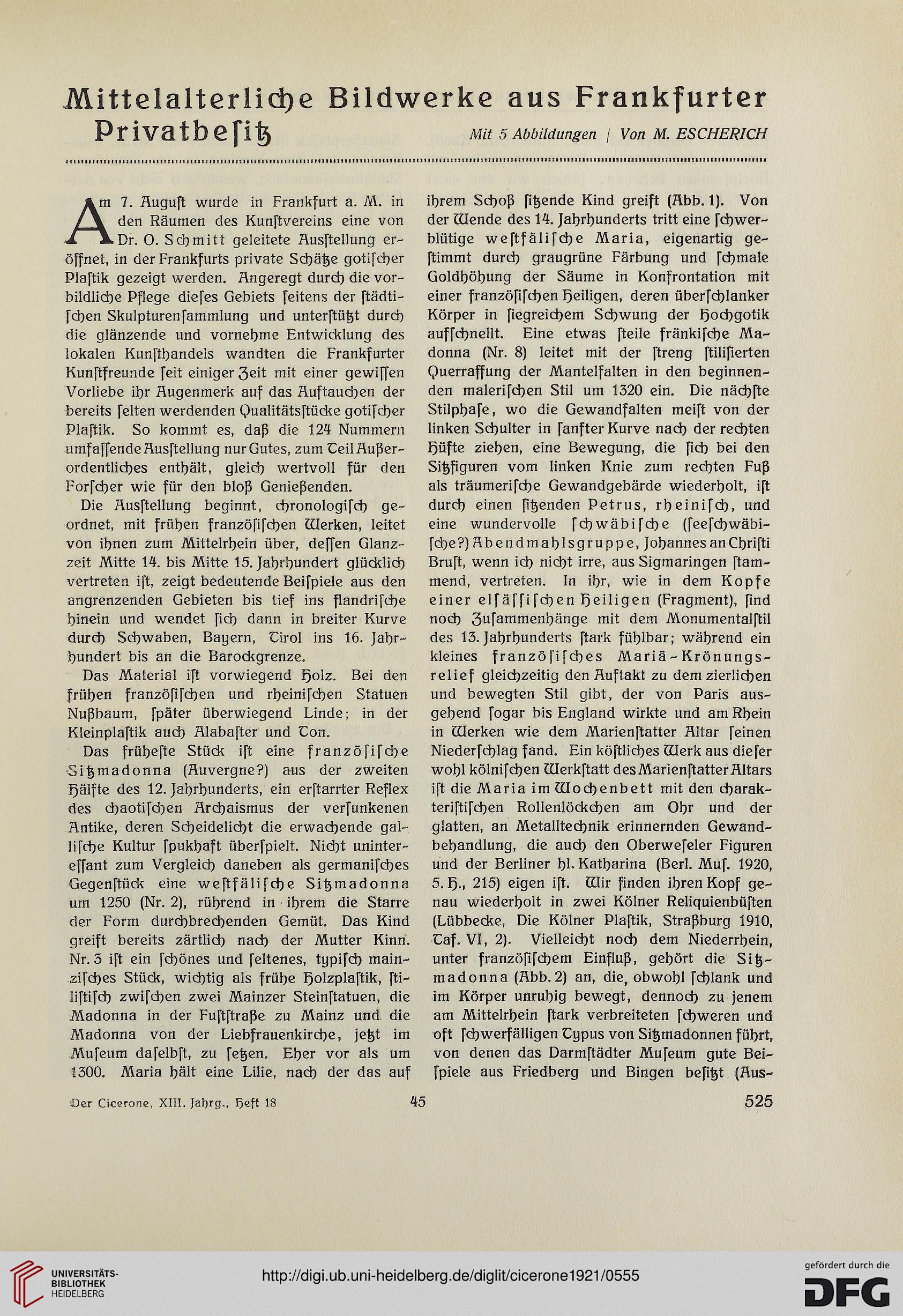Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 13.1921
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0555
DOI issue:
Heft 18
DOI article:Escherich, Mela: Mittelalterliche Bildwerke aus Frankfurter Privatbesitz
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0555
Mittelalterliche Bildwerke aus Frankfurter
Privatbefi^ AMAAAMMHng'cn ; VonAf. ESC//EWC//
Am 7. Auguft wurde in Frankfurt a. AL in
/ \ den Räumen des Kunftvereins eine von
A ^LDr. O. Schmitt geleitete Ausheilung er-
öffnet, in der Frankfurts private Schäle gotifcher
Piaftik gezeigt werden. Angeregt durch die vor-
bildliche Pflege diefes Gebiets feitens der ftädti-
fchen Skulpturenfammlung und unterftüßt durch
die glänzende und vornehme Entwicklung des
lokalen Kunftßandels wandten die Frankfurter
Kunftfreunde feit einiger 3eit mit einer gewiffen
Vorliebe ihr Augenmerk auf das Auftauchen der
bereits feiten werdenden Qualitätsftücke gotifcher
Piaftik. So kommt es, daß die 124 Nummern
umfaffende Ausftellung nur Gutes, zum Ceil Außer-
ordentliches enthält, gleich wertvoll für den
Forfcßer wie für den bloß Genießenden.
Die Ausftellung beginnt, cßronologifcß ge-
ordnet, mit frühen franzöfifchen Klerken, leitet
von ihnen zum Mittelrhein über, deffen Glanz-
zeit Mitte 14. bis Mitte 15. Jahrhundert glücklich
vertreten ift, zeigt bedeutende Beifpiele aus den
angrenzenden Gebieten bis tief ins flandrifche
hinein und wendet fich dann in breiter Kurve
durch Schwaben, Bagern, Cirol ins 16. Jahr-
hundert bis an die Barodegrenze.
Das Material ift vorwiegend FJolz. Bei den
frühen franzöfifchen und rheinifchen Statuen
Nußbaum, fpäter überwiegend Linde; in der
Kleinplaftik auch Alabafter und Don.
Das frühefte Stück ift eine franzöfifeße
Sißmadonna (Auvergne?) aus der zweiten
Qälfte des 12. Jahrhunderts, ein erftarrter Reflex
des cßaotifcßen Archaismus der verfunkenen
Antike, deren Scheidelicht die erwachende gal-
lifcße Kultur fpukßaft überfpielt. Nicht uninter-
effant zum Vergleich daneben als germanifeßes
Gegenftück eine weftfälifcße Sißmadonna
um 1250 (Nr. 2), rührend in ißrem die Starre
der Form durchbrechenden Gemüt. Das Kind
greift bereits zärtlich nach der Mutter Kinn.
Nr. 5 ift ein feßönes und feltenes, tgpifcß main-
zifeßes Stück, wichtig als frühe Fjolzplaftik, fti-
liftifcß zwifeßen zwei Alainzer Steinftatuen, die
Madonna in der Fuftftraße zu Mainz und die
Madonna von der Liebfrauenkircße, jet$t im
Alufeum dafelbft, zu feßen. Eher vor als um
1300. Alaria hält eine Lilie, nach der das auf
ißrem Scßoß ßt^ende Kind greift (Abb. 1). Von
der Klende des 14. Jahrhunderts tritt eine feßwer-
blütigc weftfälifcße Maria, eigenartig ge-
ftimmt durd) graugrüne Färbung und fcßmale
Goldßößung der Säume in Konfrontation mit
einer franzöfifchen ^eiligen, deren überfcßlanker
Körper in fiegreießem Scßwung der Hochgotik
auffcßnellt. Eine etwas fteile fränkifeße Ma-
donna (Nr. 8) leitet mit der ftreng ftilißerten
Querraffung der Mantelfalten in den beginnen-
den malerifcßen Stil um 1320 ein. Die näcßfte
Stilpßafe, wo die Gewandfalten meift von der
linken Schulter in fanfter Kurve nach der rechten
Fjüfte zießen, eine Bewegung, die fich bei den
Sißßguren vom linken Knie zum rechten Fuß
als träumerifeße Gewandgebärde wiederholt, ift
durch einen fißenden Petrus, rßeinifcß, und
eine wundervolle feßwäbifeße (feefeßwäbi-
fche?)Abcndmaßlsgruppe,J oßannes an Cßrifti
Bruft, wenn ich nicht irre, aus Sigmaringen ftam-
mend, vertreten, ln ißr, wie in dem Kopfe
einer elfäffifcßenFjeiligen (Fragment), find
noch 3ufammenßänge mit dem Monumentalftil
des 13. Jaßrßunderts ftark fühlbar; während ein
kleines franzöfifeßes Mariä-Krönungs-
relief gleichzeitig den Auftakt zu dem zierlichen
und bewegten Stil gibt, der von Paris aus-
gehend fogar bis England wirkte und am Rhein
in Klerken wie dem Marienftatter Altar feinen
Niederfcßlag fand. Ein köftlicßes (Herk aus diefer
wohl kölnifcßen Klerkftatt desMarienftatter Altars
ift die Maria im Klocßenbett mit den cßarak-
teriftifeßen Rollenlöckcßen am Oßr und der
glatten, an Metalltecßnik erinnernden Gewand-
beßandlung, die auch den Oberwefeler Figuren
und der Berliner ßl. Katharina (Berl. Muf. 1920,
5. F)., 215) eigen ift. ULlir finden ißren Kopf ge-
nau wiederholt in zwei Kölner Reliquienbüften
(Lübbecke, Die Kölner Piaftik, Straßburg 1910,
Caf. VI, 2). Vielleicht noch dem Niederrhein,
unter franzöfifeßem Einfluß, gehört die Siß-
madonna (Abb.2) an, die, obwohl feßiank und
im Körper unruhig bewegt, dennoch zu jenem
am Mittelrßein ftark verbreiteten feßweren und
oft fcßwerfälligen Cypus von Sißmadonnen führt,
von denen das Darmftädter Mufeum gute Bei-
fpiele aus Friedberg und Bingen befi^t (Aus-
Der Cicerone, XIH. Jabrg., beft 18
45
525
Privatbefi^ AMAAAMMHng'cn ; VonAf. ESC//EWC//
Am 7. Auguft wurde in Frankfurt a. AL in
/ \ den Räumen des Kunftvereins eine von
A ^LDr. O. Schmitt geleitete Ausheilung er-
öffnet, in der Frankfurts private Schäle gotifcher
Piaftik gezeigt werden. Angeregt durch die vor-
bildliche Pflege diefes Gebiets feitens der ftädti-
fchen Skulpturenfammlung und unterftüßt durch
die glänzende und vornehme Entwicklung des
lokalen Kunftßandels wandten die Frankfurter
Kunftfreunde feit einiger 3eit mit einer gewiffen
Vorliebe ihr Augenmerk auf das Auftauchen der
bereits feiten werdenden Qualitätsftücke gotifcher
Piaftik. So kommt es, daß die 124 Nummern
umfaffende Ausftellung nur Gutes, zum Ceil Außer-
ordentliches enthält, gleich wertvoll für den
Forfcßer wie für den bloß Genießenden.
Die Ausftellung beginnt, cßronologifcß ge-
ordnet, mit frühen franzöfifchen Klerken, leitet
von ihnen zum Mittelrhein über, deffen Glanz-
zeit Mitte 14. bis Mitte 15. Jahrhundert glücklich
vertreten ift, zeigt bedeutende Beifpiele aus den
angrenzenden Gebieten bis tief ins flandrifche
hinein und wendet fich dann in breiter Kurve
durch Schwaben, Bagern, Cirol ins 16. Jahr-
hundert bis an die Barodegrenze.
Das Material ift vorwiegend FJolz. Bei den
frühen franzöfifchen und rheinifchen Statuen
Nußbaum, fpäter überwiegend Linde; in der
Kleinplaftik auch Alabafter und Don.
Das frühefte Stück ift eine franzöfifeße
Sißmadonna (Auvergne?) aus der zweiten
Qälfte des 12. Jahrhunderts, ein erftarrter Reflex
des cßaotifcßen Archaismus der verfunkenen
Antike, deren Scheidelicht die erwachende gal-
lifcße Kultur fpukßaft überfpielt. Nicht uninter-
effant zum Vergleich daneben als germanifeßes
Gegenftück eine weftfälifcße Sißmadonna
um 1250 (Nr. 2), rührend in ißrem die Starre
der Form durchbrechenden Gemüt. Das Kind
greift bereits zärtlich nach der Mutter Kinn.
Nr. 5 ift ein feßönes und feltenes, tgpifcß main-
zifeßes Stück, wichtig als frühe Fjolzplaftik, fti-
liftifcß zwifeßen zwei Alainzer Steinftatuen, die
Madonna in der Fuftftraße zu Mainz und die
Madonna von der Liebfrauenkircße, jet$t im
Alufeum dafelbft, zu feßen. Eher vor als um
1300. Alaria hält eine Lilie, nach der das auf
ißrem Scßoß ßt^ende Kind greift (Abb. 1). Von
der Klende des 14. Jahrhunderts tritt eine feßwer-
blütigc weftfälifcße Maria, eigenartig ge-
ftimmt durd) graugrüne Färbung und fcßmale
Goldßößung der Säume in Konfrontation mit
einer franzöfifchen ^eiligen, deren überfcßlanker
Körper in fiegreießem Scßwung der Hochgotik
auffcßnellt. Eine etwas fteile fränkifeße Ma-
donna (Nr. 8) leitet mit der ftreng ftilißerten
Querraffung der Mantelfalten in den beginnen-
den malerifcßen Stil um 1320 ein. Die näcßfte
Stilpßafe, wo die Gewandfalten meift von der
linken Schulter in fanfter Kurve nach der rechten
Fjüfte zießen, eine Bewegung, die fich bei den
Sißßguren vom linken Knie zum rechten Fuß
als träumerifeße Gewandgebärde wiederholt, ift
durch einen fißenden Petrus, rßeinifcß, und
eine wundervolle feßwäbifeße (feefeßwäbi-
fche?)Abcndmaßlsgruppe,J oßannes an Cßrifti
Bruft, wenn ich nicht irre, aus Sigmaringen ftam-
mend, vertreten, ln ißr, wie in dem Kopfe
einer elfäffifcßenFjeiligen (Fragment), find
noch 3ufammenßänge mit dem Monumentalftil
des 13. Jaßrßunderts ftark fühlbar; während ein
kleines franzöfifeßes Mariä-Krönungs-
relief gleichzeitig den Auftakt zu dem zierlichen
und bewegten Stil gibt, der von Paris aus-
gehend fogar bis England wirkte und am Rhein
in Klerken wie dem Marienftatter Altar feinen
Niederfcßlag fand. Ein köftlicßes (Herk aus diefer
wohl kölnifcßen Klerkftatt desMarienftatter Altars
ift die Maria im Klocßenbett mit den cßarak-
teriftifeßen Rollenlöckcßen am Oßr und der
glatten, an Metalltecßnik erinnernden Gewand-
beßandlung, die auch den Oberwefeler Figuren
und der Berliner ßl. Katharina (Berl. Muf. 1920,
5. F)., 215) eigen ift. ULlir finden ißren Kopf ge-
nau wiederholt in zwei Kölner Reliquienbüften
(Lübbecke, Die Kölner Piaftik, Straßburg 1910,
Caf. VI, 2). Vielleicht noch dem Niederrhein,
unter franzöfifeßem Einfluß, gehört die Siß-
madonna (Abb.2) an, die, obwohl feßiank und
im Körper unruhig bewegt, dennoch zu jenem
am Mittelrßein ftark verbreiteten feßweren und
oft fcßwerfälligen Cypus von Sißmadonnen führt,
von denen das Darmftädter Mufeum gute Bei-
fpiele aus Friedberg und Bingen befi^t (Aus-
Der Cicerone, XIH. Jabrg., beft 18
45
525