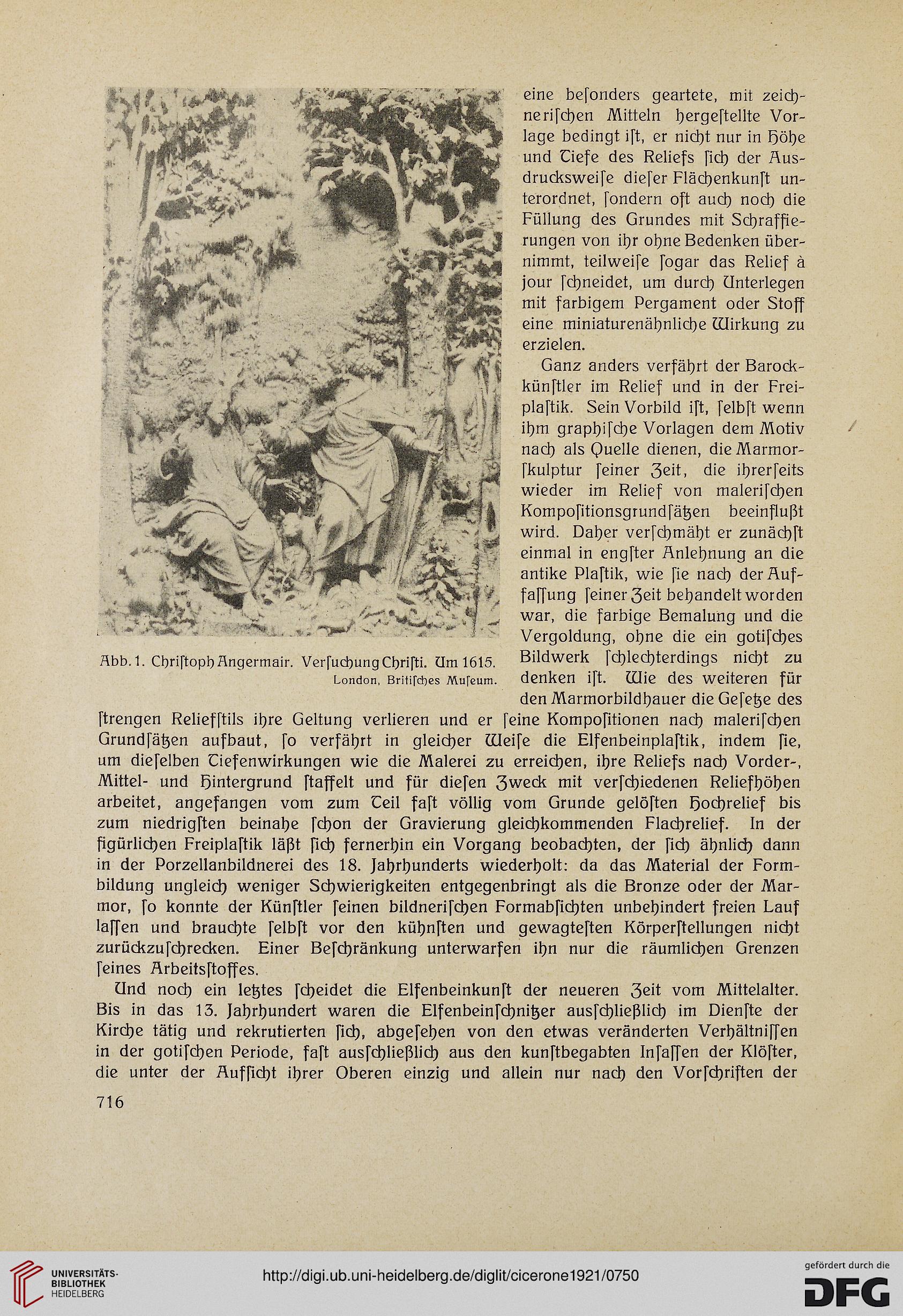Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 13.1921
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0750
DOI Heft:
Heft 24
DOI Artikel:Pelka, Otto: Barocke deutsche Elfenbeine
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.27278#0750
einebefonders geartete, mit zeich-
ne rifd)en Mittein h^rgeftellte Vor-
tage bedingt ift, er nicht nur in Höhe
und Tiefe des Reliefs fid) der Aus-
drucksweife diefer Flächenkunft un-
terordnet, fondern oft auch nod) die
Füllung des Grundes mit Schraffie-
rungen von it)r ohne Bedenken über-
nimmt, teiiweife fogar das Relief ä
jour fchneidet, um durch Unterlegen
mit farbigem Pergament oder Stoff
eine miniaturenähnliche (Uirkung zu
erzielen.
Ganz anders verfährt der Barock-
künftler im Relief und in der Frei-
plaftik. Sein Vorbild ift, felbft wenn
ihm graphifche Vorlagen dem Motiv
nach als Quelle dienen, dieMarmor-
fkulptur feiner geit, die ihrerfeits
wieder im Relief von malerifchen
Kompofitionsgrundfä^en beeinflußt
wird. Daher verfchmäht er zunächft
einmal in engfter Anlehnung an die
antike Plaftik, wie fie nach derAuf-
faffung feiner geit behandelt worden
war, die farbige Bemalung und die
Vergoldung, ohne die ein gotifches
Bildwerk fchlechterdings nicht zu
denken ift. (Die des weiteren für
den Marmorbildhauer dieGefe^e des
ftrengen Reliefftils ihre Geltung verlieren und er feine Kompofitionen nach malerifchen
Grundfät$en aufbaut, fo verfährt in gleicher (Heife die Elfenbeinplaftik, indem fie,
um diefelben Tiefenwirkungen wie die Malerei zu erreichen, ihre Reliefs nach Vorder-,
Mittel- und Hintergrund ftaffelt und für diefen gweck mit verfchiedenen Reliefhöhen
arbeitet, angefangen vom zum Teil faft völlig vom Grunde gelöften Hochrelief bis
zum niedrigften beinahe fchon der Gravierung gleichkommenden Flachrelief. In der
figürlichen Freiplaftik läßt fid) fernerhin ein Vorgang beobachten, der fid) ähnlich) dann
in der Porzellanbildnerei des 18. Jahrhunderts wiederholt: da das Material der Form-
bildung ungleich weniger Schwierigkeiten entgegenbringt als die Bronze oder der Mar-
mor, fo konnte der Künftler feinen bildnerifcßen Formabfid)ten unbehindert freien Lauf
laffen und brauchte felbft vor den küßnften und gewagteften Körperftellungen nicht
zurückzufchrecken. Einer Befcßränkung unterwarfen ihn nur die räumlichen Grenzen
feines Arbeitsftoffes.
Und nod) ein le^tes fcheidet die Elfenbeinkunft der neueren geit vom Mittelalter.
Bis in das 13. Jahrhundert waren die Elfenbeinfchnit$er ausfchließlid) im Dienfte der
Kirche tätig und rekrutierten fid), abgefehen von den etwas veränderten Verl)ä!tniffen
in der gotifchen Periode, faft ausfchließlid) aus den kunftbegabten Infaffen der Klöfter,
die unter der Aufßcßt ihrer Oberen einzig und allein nur nach den Vorfcßriften der
Hbb.l. Chriftoph Angermair. VerfuchungChrifti. dm 1615.
London, Br!tifd)cs Mufeum.
716
ne rifd)en Mittein h^rgeftellte Vor-
tage bedingt ift, er nicht nur in Höhe
und Tiefe des Reliefs fid) der Aus-
drucksweife diefer Flächenkunft un-
terordnet, fondern oft auch nod) die
Füllung des Grundes mit Schraffie-
rungen von it)r ohne Bedenken über-
nimmt, teiiweife fogar das Relief ä
jour fchneidet, um durch Unterlegen
mit farbigem Pergament oder Stoff
eine miniaturenähnliche (Uirkung zu
erzielen.
Ganz anders verfährt der Barock-
künftler im Relief und in der Frei-
plaftik. Sein Vorbild ift, felbft wenn
ihm graphifche Vorlagen dem Motiv
nach als Quelle dienen, dieMarmor-
fkulptur feiner geit, die ihrerfeits
wieder im Relief von malerifchen
Kompofitionsgrundfä^en beeinflußt
wird. Daher verfchmäht er zunächft
einmal in engfter Anlehnung an die
antike Plaftik, wie fie nach derAuf-
faffung feiner geit behandelt worden
war, die farbige Bemalung und die
Vergoldung, ohne die ein gotifches
Bildwerk fchlechterdings nicht zu
denken ift. (Die des weiteren für
den Marmorbildhauer dieGefe^e des
ftrengen Reliefftils ihre Geltung verlieren und er feine Kompofitionen nach malerifchen
Grundfät$en aufbaut, fo verfährt in gleicher (Heife die Elfenbeinplaftik, indem fie,
um diefelben Tiefenwirkungen wie die Malerei zu erreichen, ihre Reliefs nach Vorder-,
Mittel- und Hintergrund ftaffelt und für diefen gweck mit verfchiedenen Reliefhöhen
arbeitet, angefangen vom zum Teil faft völlig vom Grunde gelöften Hochrelief bis
zum niedrigften beinahe fchon der Gravierung gleichkommenden Flachrelief. In der
figürlichen Freiplaftik läßt fid) fernerhin ein Vorgang beobachten, der fid) ähnlich) dann
in der Porzellanbildnerei des 18. Jahrhunderts wiederholt: da das Material der Form-
bildung ungleich weniger Schwierigkeiten entgegenbringt als die Bronze oder der Mar-
mor, fo konnte der Künftler feinen bildnerifcßen Formabfid)ten unbehindert freien Lauf
laffen und brauchte felbft vor den küßnften und gewagteften Körperftellungen nicht
zurückzufchrecken. Einer Befcßränkung unterwarfen ihn nur die räumlichen Grenzen
feines Arbeitsftoffes.
Und nod) ein le^tes fcheidet die Elfenbeinkunft der neueren geit vom Mittelalter.
Bis in das 13. Jahrhundert waren die Elfenbeinfchnit$er ausfchließlid) im Dienfte der
Kirche tätig und rekrutierten fid), abgefehen von den etwas veränderten Verl)ä!tniffen
in der gotifchen Periode, faft ausfchließlid) aus den kunftbegabten Infaffen der Klöfter,
die unter der Aufßcßt ihrer Oberen einzig und allein nur nach den Vorfcßriften der
Hbb.l. Chriftoph Angermair. VerfuchungChrifti. dm 1615.
London, Br!tifd)cs Mufeum.
716