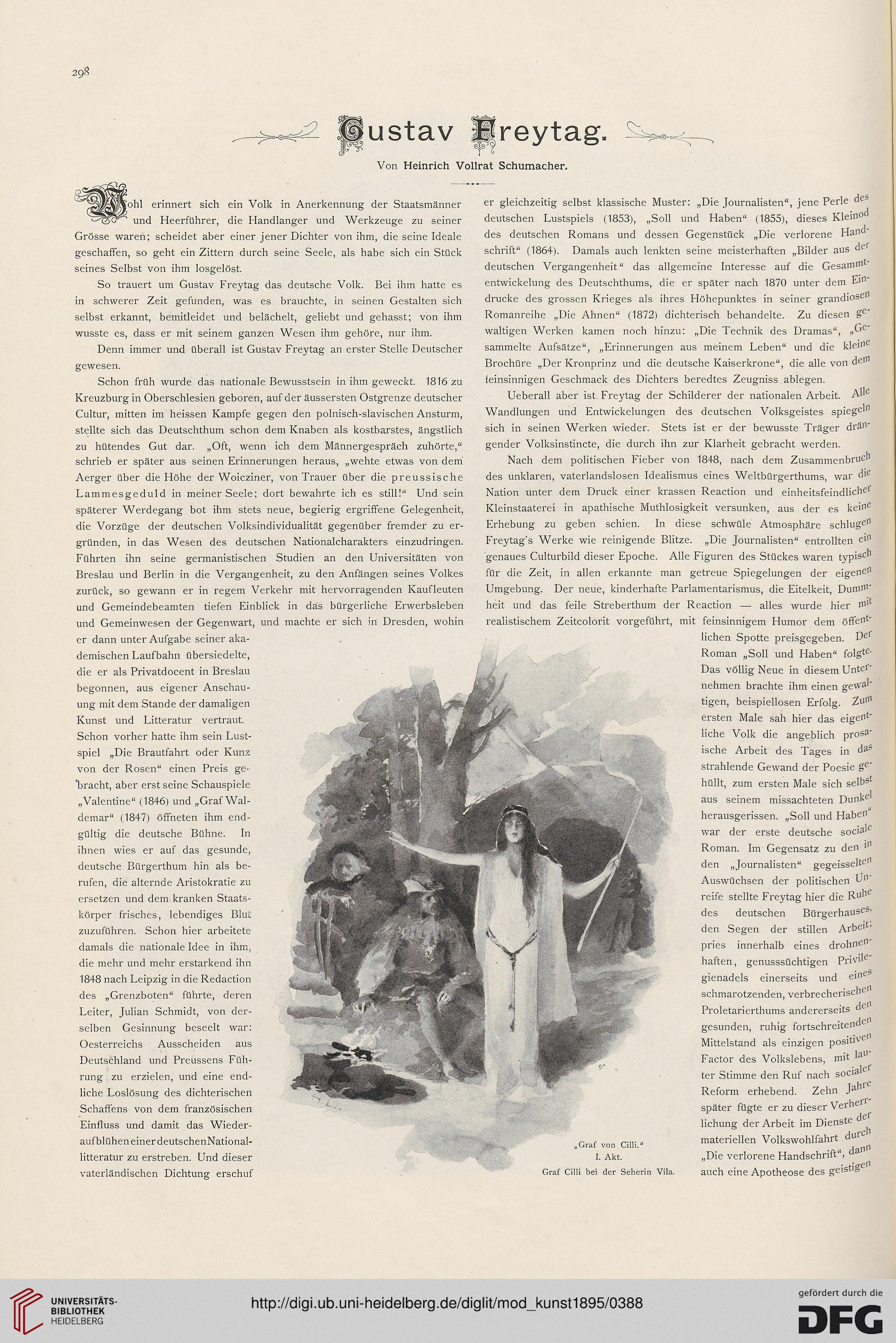Von Heinrich Vollrat Schumacher.
ohl erinnert sich ein Volk in Anerkennung der Staatsmänner
und Heerführer, die Handlanger und Werkzeuge zu seiner
Grösse waren; scheidet aber einer jener Dichter von ihm, die seine Ideale
geschaffen, so geht ein Zittern durch seine Seele, als habe sich ein Stück
seines Selbst von ihm losgelöst.
So trauert um Gustav Freytag das deutsche Volk. Bei ihm hatte es
in schwerer Zeit gefunden, was es brauchte, in seinen Gestalten sich
selbst erkannt, bemitleidet und belächelt, geliebt und gehasst; von ihm
wusste es, dass er mit seinem ganzen Wesen ihm gehöre, nur ihm.
Denn immer und überall ist Gustav Freytag an erster Stelle Deutscher
gewesen.
Schon friih wurde das nationale Bewusstsein in ihm geweckt. 1816 zu
Kreuzburg in Oberschlesien geboren, auf der äussersten Ostgrenze deutscher
Cultur, mitten im heissen Kampfe gegen den polnisch-slavischen Ansturm,
stellte sich das Deutschthum schon dem Knaben als kostbarstes, ängstlich
zu hütendes Gut dar. „Oft, wenn ich dem Männergespräch zuhörte,“
schrieb er später aus seinen Erinnerungen heraus, „wehte etwas von dem
Aerger über die Höhe der Woicziner, von Trauer über die preussische
Lammesgeduld in meinerSeele; dort bewahrte ich es still!“ Und sein
späterer Werdegang bot ihm stets neue, begierig ergriflfene Gelegenheit,
die Vorzüge der deutschen Volksindividualität gegenüber fremder zu er-
gründen, in das Wesen des deutschen Nationalcharakters einzudringen.
Führten ihn seine germanistischen Studien an den Universitäten von
Breslau und Berlin in die Vergangenheit, zu den Anfängen seines Volkes
zurück, so gewann er in regem Verkehr mit hervorragenden Kaufleuten
und Gemeindebeamten tiefen Einblick in däs bürgerliche Erwerbsleben
und Gemeinwesen der Gegenwart, und machte er sich in Dresden, wohin
er dann unter Aufgabe seiner aka-
demischen Laufbahn übersiedelte,
die er als Privatdocent in Breslau
begonnen, aus eigener Anschau-
ung mit dem Stande der damaligen
Kunst und Litteratur vertraut.
Schon vorher hatte ihm sein Lust-
spiel „Die Brautfahrt oder Kunz
von der Rosen“ einen Preis ge-
*bracht, aber erst seine Schauspiele
„Valentine“ (1846) und „Graf Wal-
demar“ (1847) öffneten ihm end-
gültig die deutsche Bühne. In
ihnen wies er auf das gesunde,
deutsche Bürgerthum hin als be-
rufen, die alternde Aristokratie zu
ersetzen und dem kranken Staats-
körper frisches, lebendiges Blut
zuzuführen. Schon hier arbeitete
damals die nationale Idee in ihm,
die mehr und mehr erstarkend ihn
1848 nach Leipzig in die Redaction
des „Grenzboten“ führte, deren
Leiter, Julian Schmidt, von der-
selben Gesinnung beseelt war:
Oesterreichs Ausscheiden aus
Deutschland und Preussens Fiih-
rung zu erzielen, und eine end-
liche Loslösung des dichterischen
Schaftens von dem französischen
Einfluss und damit das Wieder-
aufblühen einer deutschenNational-
litteratur zu erstreben. Und dieser
vaterländischen Dichtung erschuf
er gleichzeitig selbst klassische Muster: „Die Journalisten“, jene Perle de b
deutschen Lustspiels (1853), „Soll und Haben“ (1855), dieses Klein°d
des deutschen Romans und dessen Gegenstück „Die verlorene Hand
schrift“ (1864). Damals auch lenkten seine meisterhaften „Bilder aus de’
deutschen Vergangenheit “ das allgemeine Interesse auf die GesamnF
entwickelung des Deutschthums, die er später nach 1870 unter dem E l0
drucke des grossen Krieges als ihres Höhepunktes in seiner grandios 611
Romanreihe „Die Ahnen“ (1872) dichterisch behandelte. Zu diesen g e
waltigen Werken kamen noch hinzu: „Die Technik des Dramas“,
sammelte Aufsätze“, „Erinnerungen aus meinem Leben“ und die klem t
Brochüre „Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone“, die alle von de 01
leinsinnigen Geschmack des Dichters beredtes Zeugniss ablegen.
Ueberall aber ist Freytag der Schilderer der nationalen Arbeit. AH e
Wandlungen und Entwickelungen des deutschen Volksgeistes spieg el°
sich in seinen Werken wieder. Stets ist er der bewusste Träger dräm
gender Volksinstincte, die durch ihn zur Klarheit gebracht werden.
Nach dem politischen Fieber von 1848, nach dem Zusammenbrud 1
des unklaren, vaterlandslosen Idealismus eines Weltbürgerthums, war di e
Nation unter dem Druck einer krassen Reaction und einheitsfeindlich er
Kleinstaaterei in apathische Muthlosigkeit versunken, aus der es kein e
Erhebung zu geben schien. In diese schwüle Atmosphäre schluge' 1
Freytag’s Werke wie reinigende Blitze. „Die Journalisten“ entrollten ei 11
genaues Culturbild dieser Epoche. Alle Figuren des Stückes waren typis^
für die Zeit, in allen erkannte man getreue Spiegelungen der eigen eI1
Umgebung. Der neue, kinderhafte Parlamentarismus, die Eitelkeit, Durm 11'
heit und das feile Streberthum der Reaction —- alles wurde hier ui |l;
realistischem Zeitcolorit vorgeführt, mit feinsinnigem Humor dem öffeiF'
lichen Spotte preisgegeben. E £l
Roman „Soll und Haben“ folg te'
Das völlig Neue in diesemUnte 1'
nehmen brachte ihm einen gewal'
tigcn, beispiellosen Erfolg. iZuü 1
ersten Male sah hicr das eigen 1'
liche Volk die angeblich prosä'
ische Arbcit des Tages in da b
strahlende Gewand der Poesie g e'
hüllt, zum ersten Male sich selb st
aus seinem missachteten Dunk e'
n
herausgerissen. „Soll und Hab e0
war der erste deutsche socfi e
Roman. Im Gegensatz zu den 1,1
den „Journalisten“ gegeisselt eil
Auswüchsen der politischen Eu
reife stellte Freytag hier die Ruh e
des deutschen Bürgerhaus eS’
den Segen der stillen Arb elt'
pries innerhalb eines drohne 11
haften, genusssiichtigen PrivÜ e
gienadels einerseits und ein eS
schmarotzenden, verbrecherisd iel1
.
„Graf von Cilli."
I. Akt.
Graf Cilli bei der Seherin Vila.
Proletarierthums andererseits
gesunden, ruhig fortschreiten
Mittelstand als einzigen positi vCl
Factor des Volkslebens, mit l al1
ter Stimme den Ruf nach socid e
Reform erhebend. Zehn J a' l!
später fügte er zu dieser Verh el1
lichung der Arbeit im Dienste d e^
materiellen Volkswohlfahrt d urC
dan°
„Die verlorene Handschrift'S
auch eine Apotheose des gei
stig en
ohl erinnert sich ein Volk in Anerkennung der Staatsmänner
und Heerführer, die Handlanger und Werkzeuge zu seiner
Grösse waren; scheidet aber einer jener Dichter von ihm, die seine Ideale
geschaffen, so geht ein Zittern durch seine Seele, als habe sich ein Stück
seines Selbst von ihm losgelöst.
So trauert um Gustav Freytag das deutsche Volk. Bei ihm hatte es
in schwerer Zeit gefunden, was es brauchte, in seinen Gestalten sich
selbst erkannt, bemitleidet und belächelt, geliebt und gehasst; von ihm
wusste es, dass er mit seinem ganzen Wesen ihm gehöre, nur ihm.
Denn immer und überall ist Gustav Freytag an erster Stelle Deutscher
gewesen.
Schon friih wurde das nationale Bewusstsein in ihm geweckt. 1816 zu
Kreuzburg in Oberschlesien geboren, auf der äussersten Ostgrenze deutscher
Cultur, mitten im heissen Kampfe gegen den polnisch-slavischen Ansturm,
stellte sich das Deutschthum schon dem Knaben als kostbarstes, ängstlich
zu hütendes Gut dar. „Oft, wenn ich dem Männergespräch zuhörte,“
schrieb er später aus seinen Erinnerungen heraus, „wehte etwas von dem
Aerger über die Höhe der Woicziner, von Trauer über die preussische
Lammesgeduld in meinerSeele; dort bewahrte ich es still!“ Und sein
späterer Werdegang bot ihm stets neue, begierig ergriflfene Gelegenheit,
die Vorzüge der deutschen Volksindividualität gegenüber fremder zu er-
gründen, in das Wesen des deutschen Nationalcharakters einzudringen.
Führten ihn seine germanistischen Studien an den Universitäten von
Breslau und Berlin in die Vergangenheit, zu den Anfängen seines Volkes
zurück, so gewann er in regem Verkehr mit hervorragenden Kaufleuten
und Gemeindebeamten tiefen Einblick in däs bürgerliche Erwerbsleben
und Gemeinwesen der Gegenwart, und machte er sich in Dresden, wohin
er dann unter Aufgabe seiner aka-
demischen Laufbahn übersiedelte,
die er als Privatdocent in Breslau
begonnen, aus eigener Anschau-
ung mit dem Stande der damaligen
Kunst und Litteratur vertraut.
Schon vorher hatte ihm sein Lust-
spiel „Die Brautfahrt oder Kunz
von der Rosen“ einen Preis ge-
*bracht, aber erst seine Schauspiele
„Valentine“ (1846) und „Graf Wal-
demar“ (1847) öffneten ihm end-
gültig die deutsche Bühne. In
ihnen wies er auf das gesunde,
deutsche Bürgerthum hin als be-
rufen, die alternde Aristokratie zu
ersetzen und dem kranken Staats-
körper frisches, lebendiges Blut
zuzuführen. Schon hier arbeitete
damals die nationale Idee in ihm,
die mehr und mehr erstarkend ihn
1848 nach Leipzig in die Redaction
des „Grenzboten“ führte, deren
Leiter, Julian Schmidt, von der-
selben Gesinnung beseelt war:
Oesterreichs Ausscheiden aus
Deutschland und Preussens Fiih-
rung zu erzielen, und eine end-
liche Loslösung des dichterischen
Schaftens von dem französischen
Einfluss und damit das Wieder-
aufblühen einer deutschenNational-
litteratur zu erstreben. Und dieser
vaterländischen Dichtung erschuf
er gleichzeitig selbst klassische Muster: „Die Journalisten“, jene Perle de b
deutschen Lustspiels (1853), „Soll und Haben“ (1855), dieses Klein°d
des deutschen Romans und dessen Gegenstück „Die verlorene Hand
schrift“ (1864). Damals auch lenkten seine meisterhaften „Bilder aus de’
deutschen Vergangenheit “ das allgemeine Interesse auf die GesamnF
entwickelung des Deutschthums, die er später nach 1870 unter dem E l0
drucke des grossen Krieges als ihres Höhepunktes in seiner grandios 611
Romanreihe „Die Ahnen“ (1872) dichterisch behandelte. Zu diesen g e
waltigen Werken kamen noch hinzu: „Die Technik des Dramas“,
sammelte Aufsätze“, „Erinnerungen aus meinem Leben“ und die klem t
Brochüre „Der Kronprinz und die deutsche Kaiserkrone“, die alle von de 01
leinsinnigen Geschmack des Dichters beredtes Zeugniss ablegen.
Ueberall aber ist Freytag der Schilderer der nationalen Arbeit. AH e
Wandlungen und Entwickelungen des deutschen Volksgeistes spieg el°
sich in seinen Werken wieder. Stets ist er der bewusste Träger dräm
gender Volksinstincte, die durch ihn zur Klarheit gebracht werden.
Nach dem politischen Fieber von 1848, nach dem Zusammenbrud 1
des unklaren, vaterlandslosen Idealismus eines Weltbürgerthums, war di e
Nation unter dem Druck einer krassen Reaction und einheitsfeindlich er
Kleinstaaterei in apathische Muthlosigkeit versunken, aus der es kein e
Erhebung zu geben schien. In diese schwüle Atmosphäre schluge' 1
Freytag’s Werke wie reinigende Blitze. „Die Journalisten“ entrollten ei 11
genaues Culturbild dieser Epoche. Alle Figuren des Stückes waren typis^
für die Zeit, in allen erkannte man getreue Spiegelungen der eigen eI1
Umgebung. Der neue, kinderhafte Parlamentarismus, die Eitelkeit, Durm 11'
heit und das feile Streberthum der Reaction —- alles wurde hier ui |l;
realistischem Zeitcolorit vorgeführt, mit feinsinnigem Humor dem öffeiF'
lichen Spotte preisgegeben. E £l
Roman „Soll und Haben“ folg te'
Das völlig Neue in diesemUnte 1'
nehmen brachte ihm einen gewal'
tigcn, beispiellosen Erfolg. iZuü 1
ersten Male sah hicr das eigen 1'
liche Volk die angeblich prosä'
ische Arbcit des Tages in da b
strahlende Gewand der Poesie g e'
hüllt, zum ersten Male sich selb st
aus seinem missachteten Dunk e'
n
herausgerissen. „Soll und Hab e0
war der erste deutsche socfi e
Roman. Im Gegensatz zu den 1,1
den „Journalisten“ gegeisselt eil
Auswüchsen der politischen Eu
reife stellte Freytag hier die Ruh e
des deutschen Bürgerhaus eS’
den Segen der stillen Arb elt'
pries innerhalb eines drohne 11
haften, genusssiichtigen PrivÜ e
gienadels einerseits und ein eS
schmarotzenden, verbrecherisd iel1
.
„Graf von Cilli."
I. Akt.
Graf Cilli bei der Seherin Vila.
Proletarierthums andererseits
gesunden, ruhig fortschreiten
Mittelstand als einzigen positi vCl
Factor des Volkslebens, mit l al1
ter Stimme den Ruf nach socid e
Reform erhebend. Zehn J a' l!
später fügte er zu dieser Verh el1
lichung der Arbeit im Dienste d e^
materiellen Volkswohlfahrt d urC
dan°
„Die verlorene Handschrift'S
auch eine Apotheose des gei
stig en