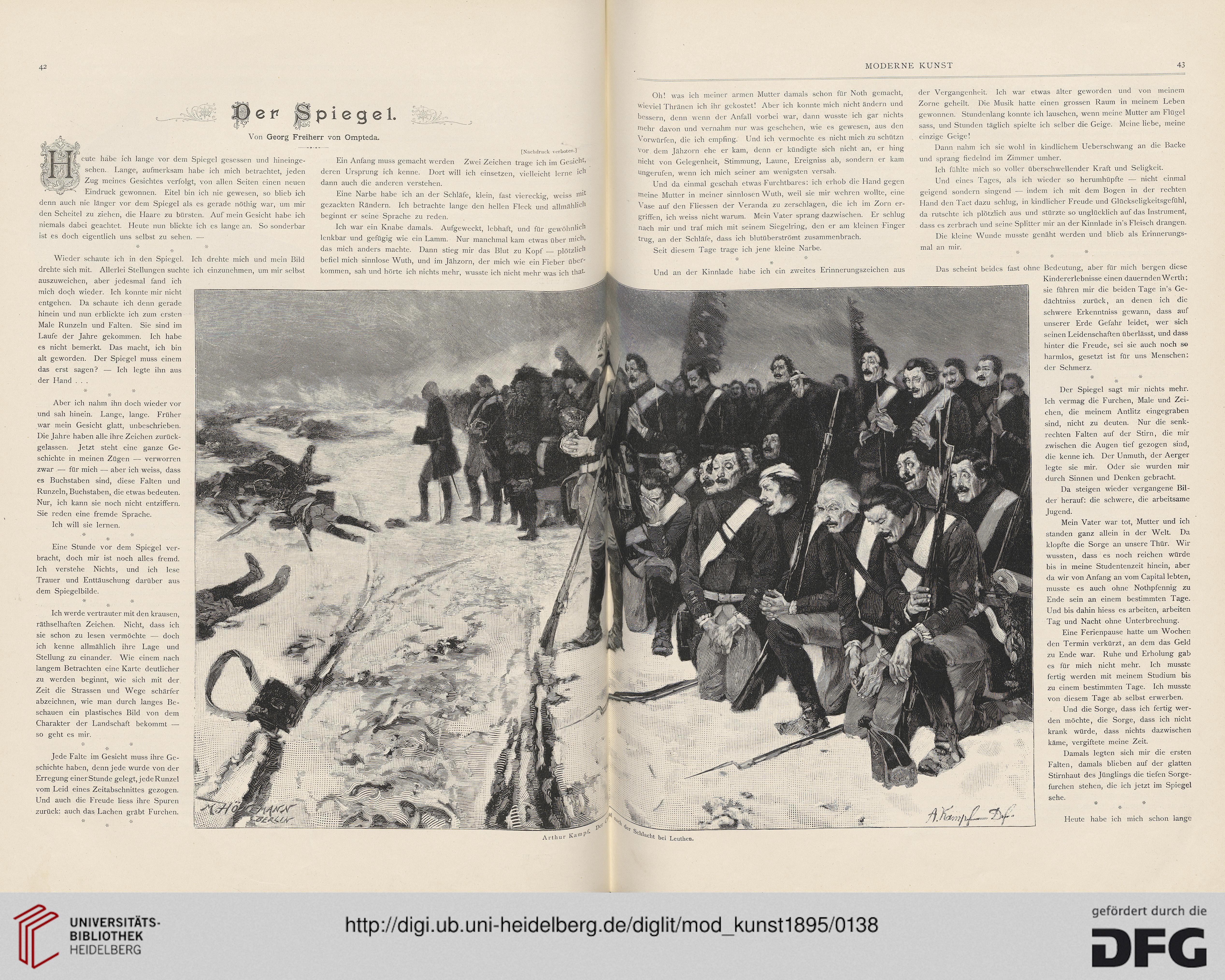42
e p S p i e q e 1.
Von Georg Freiherr von Ompteda.
f>
eute häbe ich lange vor dem Spiegel gesessen und hineinge-
J sehen. Lange, aufmerksam habe ich mich betrachtet, jeden
i§|Ssf Zug meines Gesichtes verfolgt, von allen Seiten einen neuen
Eindruck gewonnen. Eitel bin ich nie gewesen, so blieb ich
denn auch nie länger vor dem Spiegel als es gerade nöthig war, um mir
den Scheitel zu ziehen, die Haare zu bürsten. Auf mein Gesicht habe ich
niemals dabei geachtet. Heute nun blickte ich es lange an. So sonderbar
ist es doch eigentlich uns selbst zu sehen. —
Wieder schaute ich in den Spiegel. Ich drehte mich und mein Bild
drehte sich mit. Allerlei Stellungen suchte ich einzunehmen, um mir selbst
auszuweichen, aber jedesmal fand ich
mich doch wieder. Ich konnte mir nicht
entgehen. Da schaute ich denn gerade
hinein und nun erblickte ich zum ersten
Male Runzeln und Falten. Sie sind im
Laufe der Jahre gekommen. Ich habe
es nicht bemerkt. Das macht, ich bin
alt geworden. Der Spiegel muss einem
das erst sagen? — Ich legte ihn aus
der Hand . . .
Aber ich nahm ihn doch wieder vor
und sah hinein. Lange, lange. Früher
war mein Gesicht glatt, unbeschrieben.
Die Jahre haben alle ihre Zeichen zurück-
gelassen. Jetzt steht eine ganze Ge-
schichte in meinen Zügen — verworren
zwar — für mich — aber ich weiss, dass
es Buchstaben sind, diese Falten und
Runzeln, Buchstaben, die etwas bedeuten.
Nur, ich kann sie noch nicht entziffern.
Sie reden eine fremde Sprache.
Ich will sie lernen.
[Nachdruck verboten.]
Ein Anfang rnuss gemacht werden Zwei Zeichen trage ich im Gesicht,
deren Ursprung ich kenne. Dort will ich einsetzen, vielleicht lerne ich
dann auch die anderen verstehen.
Eine Narbe habe ich an der Schläfe, klein, fast viereckig, weiss mit
gezackten Rändern. Ich betrachte lange den hellen Fleck und allmählich
beginnt er seine Sprache zu reden.
Ich war ein Knabe damals. Aufgeweckt, lebhaft, und für gewöhnlich
lenkbar und gefügig wie ein Lamm. Nur manchmal kam etwas über mich,
das mich anders machte. Dann stieg mir das Blut zu Kopf — plötzlich
befiel mich sinnlose Wuth, und im Jähzorn, der mich wie ein Fieber über-
kommen, sah und hörte ich nichts mehr, wusste ich nicht mehr was ich that-
Eine Stunde vor dem Spiegel ver-
bracht, doch mir ist noch alles fremd.
Ich verstehe Nichts, und ich lese
Trauer und Enttäuschung dariiber aus
dem Spiegelbilde.
Ich werde vertrauter mit den krausen,
räthselhaften Zeichen. Nicht, dass ich
sie schon zu lesen vermöchte — doch
ich kenne allmählich ihre Lage und
Stellung zu einander. Wie einem nach
langem Betrachten eine Karte deutlicher
zu werden beginnt, wie sich mit der
Zeit die Strassen und Wege schärfer
abzeichnen, wie man durch langes Be-
schauen ein plastisches Bild von dem
Charakter der Landschaft bekommt —
so geht es mir.
Jede Falte im Gesicht muss ihre Ge-
schichte haben, denn jede wurde von der
Erregung einerStunde gelegt, jedeRunzel
vom Leid eines Zeitabschnittes gezogen.
Und auch die Freude liess ihre Spuren
zurück: auch das Lachen gräbt Furchen.
Arthur Ka n,pf‘
MODERNE KUNST
43
Oh! was ich meiner arrnen Mutter darnals schon für Noth gemacht,
Wieviel Thränen ich ihr gekostet! Aber ich konnte mich nicht ändern und
bessern, denn wenn der Anfall vorbei war, dann wüsste ich gar nichts
rnehr davon und vernahm nur was geschehen, wie es gewesen, aus den
Vorwürfen, die ich empfing. Und ich vermochte es nicht mich zu schützn
vor dem Jähzorn ehe er kam, denn er kündigte sich nicht an, er hing
nicht von Gelegenheit, Stimmung, Laune, Ereigniss ab, sondern er kam
Ungerufen, wenn ich mich seiner am wenigsten versah.
Und da einmal geschah etwas Furchtbares: ich erhob die Hand gegen
rueine Mutter in meiner sinnlosen Wuth, weil sie mir wehren wollte, eine
Vase auf den Fliessen der Veranda zu zerschlagen, die ich im Zorn er-
griffen, ich weiss nicht warum. Mein Vater sprang dazwischen. Er schlug
nach mir und traf mich mit seinem Siegelring, den er am kleinen Finger
trug, an der Schläfe, dass ich blutüberströmt zusammenbrach.
Seit diesem Tage trage ich jene kleine Narbe.
der Vergangenheit. Ich war etwas älter geworden und von meinem
Zorne geheilt. Die Musik hatte einen grossen Raum in meinem Leben
gewonnen. Stundenlang konnte ich lauschen, wenn meine Mutter am Flügel
sass, und Stunden täglich spielte ich selber die Geige. Meine liebe, meine
einzige Geige!
Dann nahm ich sie wohl in kindlichem Ueberschwang an die Backe
und sprang fiedelnd im Zimmer umher.
Ich fühlte mich so voller überschwellender Kraft und Seligkeit.
Und eines Tages, als ich wieder so henmihüpfte — nicht einmal
geigend sondern singend — indern ich mit dem Bogen in der rechten
Hand den Tact dazu schlug, in kindlicher Freude und Glückseligkeitsgefühl,
da rutschte ich plötzlich aus und stürzte so unglücklich auf das Instrument,
dass es zerbrach und seine Splitter mir an der Kinnlade in’s Fleisch drangen.
Die kleine Wunde musste genäht werden und blieb als Erinnerungs-
mal an mir.
Und an der Kinnlade habe ich ein zweites Erinnerungszeichen aus
Das scheint beides fast ohne
^hi;
acht bei Leuthen.
fyjhnj
Bedeutung, aber für mich bergen diese
Kindererlebnisse einen dauerndenWerth;
sie führen mir die beiden Tage in’s Ge-
dächtniss zurück, an denen ich die
schwere Erkenntniss gewann, dass auf
unserer Erde Gefahr leidet, wer sich
seinen Leidenschaften überlässt, und dass
hinter die Freude, sei sie auch noch so
harmlos, gesetzt ist für uns Menschen:
der Schmerz.
•X- *v
Der Spiegel sagt mir nichts mehr.
Ich vermag die Furchen, Male und Zei-
chen, die meinem Antlitz eingegraben
sind, nicht zu deuten. Nur die senk-
rechten Falten auf der Stirn, die mir
zwischen die Augen tief gezogen sind,
die kenne ich. Der Unmuth, der Aerger
legte sie mir. Oder sie wurden mir
durch Sinnen und Denken gebracht.
Da steigen wieder vergangene Bil-
der herauf: die schwere, die arbeitsame
Jugend.
Mein Vater war tot, Mutter und ich
standen ganz allein in der Welt. Da
klopfte die Sorge an unsere Thür. Wir
wussten, dass es noch reichen würde
bis in meine Studentenzeit hinein, aber
da wir von Anfang an vom Capital lebten,
musste es auch ohne Nothpfennig zu
Ende sein an einem bestimmten Tage.
Und bis dahin hiess es arbeiten, arbeiten
Tag und Nacht ohne Unterbrechung.
Eine Ferienpause hatte um Wochen
den Termin verkürzt, an dem das Geld
zu Ende war. Ruhe und Erholung gab
es für mich nicht mehr. Ich musste
fertig werden mit meinem Studium bis
zu einem bestimmten Tage. Ich musste
von diesem Tage ab selbst erwerben.
Und die Sorge, dass ich fertig wer-
den möchte, die Sorge, dass ich nicht
krank würde, dass nichts dazwischen
käme, vergiftete meine Zeit.
Damals legten sich mir die ersten
Falten, damals blieben auf der glatten
Stirnhaut des Jünglings die tiefen Sorge-
furchen stehen, die ich jetzt im Spiegel
sehe.
* *
*
Heute habe ich mich schon lange
e p S p i e q e 1.
Von Georg Freiherr von Ompteda.
f>
eute häbe ich lange vor dem Spiegel gesessen und hineinge-
J sehen. Lange, aufmerksam habe ich mich betrachtet, jeden
i§|Ssf Zug meines Gesichtes verfolgt, von allen Seiten einen neuen
Eindruck gewonnen. Eitel bin ich nie gewesen, so blieb ich
denn auch nie länger vor dem Spiegel als es gerade nöthig war, um mir
den Scheitel zu ziehen, die Haare zu bürsten. Auf mein Gesicht habe ich
niemals dabei geachtet. Heute nun blickte ich es lange an. So sonderbar
ist es doch eigentlich uns selbst zu sehen. —
Wieder schaute ich in den Spiegel. Ich drehte mich und mein Bild
drehte sich mit. Allerlei Stellungen suchte ich einzunehmen, um mir selbst
auszuweichen, aber jedesmal fand ich
mich doch wieder. Ich konnte mir nicht
entgehen. Da schaute ich denn gerade
hinein und nun erblickte ich zum ersten
Male Runzeln und Falten. Sie sind im
Laufe der Jahre gekommen. Ich habe
es nicht bemerkt. Das macht, ich bin
alt geworden. Der Spiegel muss einem
das erst sagen? — Ich legte ihn aus
der Hand . . .
Aber ich nahm ihn doch wieder vor
und sah hinein. Lange, lange. Früher
war mein Gesicht glatt, unbeschrieben.
Die Jahre haben alle ihre Zeichen zurück-
gelassen. Jetzt steht eine ganze Ge-
schichte in meinen Zügen — verworren
zwar — für mich — aber ich weiss, dass
es Buchstaben sind, diese Falten und
Runzeln, Buchstaben, die etwas bedeuten.
Nur, ich kann sie noch nicht entziffern.
Sie reden eine fremde Sprache.
Ich will sie lernen.
[Nachdruck verboten.]
Ein Anfang rnuss gemacht werden Zwei Zeichen trage ich im Gesicht,
deren Ursprung ich kenne. Dort will ich einsetzen, vielleicht lerne ich
dann auch die anderen verstehen.
Eine Narbe habe ich an der Schläfe, klein, fast viereckig, weiss mit
gezackten Rändern. Ich betrachte lange den hellen Fleck und allmählich
beginnt er seine Sprache zu reden.
Ich war ein Knabe damals. Aufgeweckt, lebhaft, und für gewöhnlich
lenkbar und gefügig wie ein Lamm. Nur manchmal kam etwas über mich,
das mich anders machte. Dann stieg mir das Blut zu Kopf — plötzlich
befiel mich sinnlose Wuth, und im Jähzorn, der mich wie ein Fieber über-
kommen, sah und hörte ich nichts mehr, wusste ich nicht mehr was ich that-
Eine Stunde vor dem Spiegel ver-
bracht, doch mir ist noch alles fremd.
Ich verstehe Nichts, und ich lese
Trauer und Enttäuschung dariiber aus
dem Spiegelbilde.
Ich werde vertrauter mit den krausen,
räthselhaften Zeichen. Nicht, dass ich
sie schon zu lesen vermöchte — doch
ich kenne allmählich ihre Lage und
Stellung zu einander. Wie einem nach
langem Betrachten eine Karte deutlicher
zu werden beginnt, wie sich mit der
Zeit die Strassen und Wege schärfer
abzeichnen, wie man durch langes Be-
schauen ein plastisches Bild von dem
Charakter der Landschaft bekommt —
so geht es mir.
Jede Falte im Gesicht muss ihre Ge-
schichte haben, denn jede wurde von der
Erregung einerStunde gelegt, jedeRunzel
vom Leid eines Zeitabschnittes gezogen.
Und auch die Freude liess ihre Spuren
zurück: auch das Lachen gräbt Furchen.
Arthur Ka n,pf‘
MODERNE KUNST
43
Oh! was ich meiner arrnen Mutter darnals schon für Noth gemacht,
Wieviel Thränen ich ihr gekostet! Aber ich konnte mich nicht ändern und
bessern, denn wenn der Anfall vorbei war, dann wüsste ich gar nichts
rnehr davon und vernahm nur was geschehen, wie es gewesen, aus den
Vorwürfen, die ich empfing. Und ich vermochte es nicht mich zu schützn
vor dem Jähzorn ehe er kam, denn er kündigte sich nicht an, er hing
nicht von Gelegenheit, Stimmung, Laune, Ereigniss ab, sondern er kam
Ungerufen, wenn ich mich seiner am wenigsten versah.
Und da einmal geschah etwas Furchtbares: ich erhob die Hand gegen
rueine Mutter in meiner sinnlosen Wuth, weil sie mir wehren wollte, eine
Vase auf den Fliessen der Veranda zu zerschlagen, die ich im Zorn er-
griffen, ich weiss nicht warum. Mein Vater sprang dazwischen. Er schlug
nach mir und traf mich mit seinem Siegelring, den er am kleinen Finger
trug, an der Schläfe, dass ich blutüberströmt zusammenbrach.
Seit diesem Tage trage ich jene kleine Narbe.
der Vergangenheit. Ich war etwas älter geworden und von meinem
Zorne geheilt. Die Musik hatte einen grossen Raum in meinem Leben
gewonnen. Stundenlang konnte ich lauschen, wenn meine Mutter am Flügel
sass, und Stunden täglich spielte ich selber die Geige. Meine liebe, meine
einzige Geige!
Dann nahm ich sie wohl in kindlichem Ueberschwang an die Backe
und sprang fiedelnd im Zimmer umher.
Ich fühlte mich so voller überschwellender Kraft und Seligkeit.
Und eines Tages, als ich wieder so henmihüpfte — nicht einmal
geigend sondern singend — indern ich mit dem Bogen in der rechten
Hand den Tact dazu schlug, in kindlicher Freude und Glückseligkeitsgefühl,
da rutschte ich plötzlich aus und stürzte so unglücklich auf das Instrument,
dass es zerbrach und seine Splitter mir an der Kinnlade in’s Fleisch drangen.
Die kleine Wunde musste genäht werden und blieb als Erinnerungs-
mal an mir.
Und an der Kinnlade habe ich ein zweites Erinnerungszeichen aus
Das scheint beides fast ohne
^hi;
acht bei Leuthen.
fyjhnj
Bedeutung, aber für mich bergen diese
Kindererlebnisse einen dauerndenWerth;
sie führen mir die beiden Tage in’s Ge-
dächtniss zurück, an denen ich die
schwere Erkenntniss gewann, dass auf
unserer Erde Gefahr leidet, wer sich
seinen Leidenschaften überlässt, und dass
hinter die Freude, sei sie auch noch so
harmlos, gesetzt ist für uns Menschen:
der Schmerz.
•X- *v
Der Spiegel sagt mir nichts mehr.
Ich vermag die Furchen, Male und Zei-
chen, die meinem Antlitz eingegraben
sind, nicht zu deuten. Nur die senk-
rechten Falten auf der Stirn, die mir
zwischen die Augen tief gezogen sind,
die kenne ich. Der Unmuth, der Aerger
legte sie mir. Oder sie wurden mir
durch Sinnen und Denken gebracht.
Da steigen wieder vergangene Bil-
der herauf: die schwere, die arbeitsame
Jugend.
Mein Vater war tot, Mutter und ich
standen ganz allein in der Welt. Da
klopfte die Sorge an unsere Thür. Wir
wussten, dass es noch reichen würde
bis in meine Studentenzeit hinein, aber
da wir von Anfang an vom Capital lebten,
musste es auch ohne Nothpfennig zu
Ende sein an einem bestimmten Tage.
Und bis dahin hiess es arbeiten, arbeiten
Tag und Nacht ohne Unterbrechung.
Eine Ferienpause hatte um Wochen
den Termin verkürzt, an dem das Geld
zu Ende war. Ruhe und Erholung gab
es für mich nicht mehr. Ich musste
fertig werden mit meinem Studium bis
zu einem bestimmten Tage. Ich musste
von diesem Tage ab selbst erwerben.
Und die Sorge, dass ich fertig wer-
den möchte, die Sorge, dass ich nicht
krank würde, dass nichts dazwischen
käme, vergiftete meine Zeit.
Damals legten sich mir die ersten
Falten, damals blieben auf der glatten
Stirnhaut des Jünglings die tiefen Sorge-
furchen stehen, die ich jetzt im Spiegel
sehe.
* *
*
Heute habe ich mich schon lange