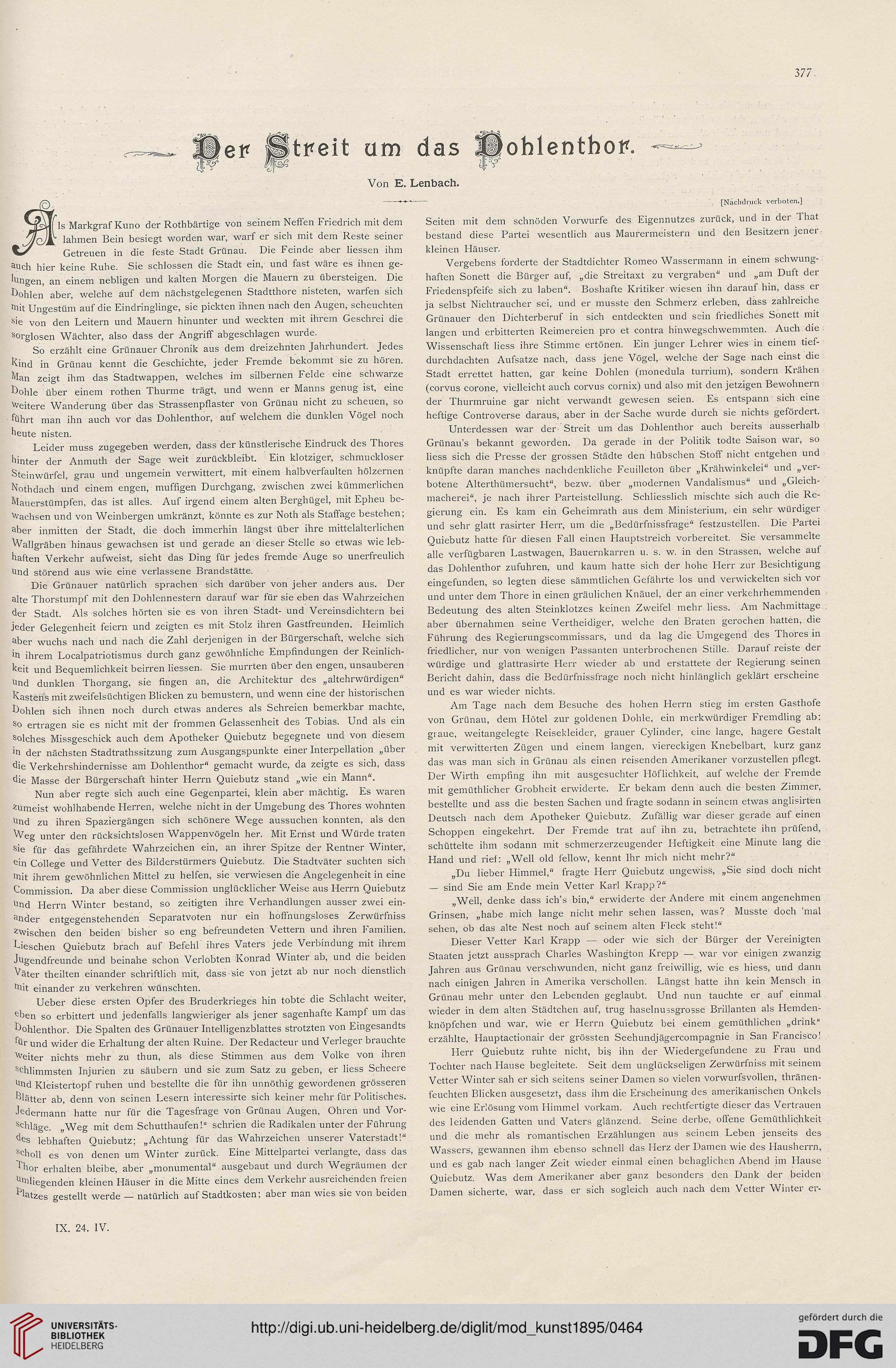377
treit um das
ohlenthor.
Von E. Lenbach.
Jls Markgraf Kuno der Rothbärtige von seinem Neffen Friedrich mit dem
' lahmen Bein besiegt worden war, warf er sich mit dem Reste seiner
Getreuen in die feste Stadt Grünau. Die Feinde aber liessen ihm
aUch hier keine Ruhe. Sie schlossen die Stadt ein, und fast wäre es ihnen ge-
'ungen, an einem nebligen und kalten Morgen die Mauern zu übersteigen. Die
hohlen aber, welche auf dem nächstgelegenen Stadtthore nisteten, warfen sich
mit Ungestüm auf die Eindringlinge, sie pickten ihnen nach den Augen, scheuchten
s>e von den Leitern und Mauern hinunter und weckten mit ihrem Geschrei die
s°rglosen Wächter, also dass der Angriff abgeschlagen wurde.
So erzählt eine Grünauer Chronik aus dem dreizehnten Jahrhundert. Jedes
Kind in Grünau kennt die Geschichte, jeder Fremde bekommt sie zu hören.
Man zeigt ihm das Stadtwappen, welches im silbernen Felde eine schwarze
t*ohle über einem rothen Thurme trägt, und wenn er Manns genug ist, eine
"'eitere Wanderung über das Strassenpflaster von Grünau nicht zu scheuen, so
führt man ihn auch vor das Dohlenthor, auf welchem die dunlden Vögel noch
heute nisten.
Leider muss zugegeben werden, dass der künstlerische Eindruck des Thores
hinter der Anmuth der Sage weit zurückbleibt. Ein klotziger, schmuckloser
Steinwürfel, grau und ungemein verwittert, mit einem halbverfaulten hölzernen
Nothdach und einem engen, muffigen Durchgang, zwischen zwei kümmerlichen
^lauerstümpfen, das ist alles. Auf irgend einem alten Berghügel, mit Epheu be-
"'achsen und von Weinbergen umkränzt, könnte es zur Noth als Staffage bestehen;
aber inmitten der Stadt, die doch immerhin längst über ihre mittelalterlichen
Wallgräben hinaus gewachsen ist und gerade an dieser Stelle so etwas wie leb-
baften Verkehr aufweist, sieht das Ding für jedes fremde Äuge so unerfreulich
Und störend aus wie eine verlassene Brandstätte.
Die Grünauer natürlich sprachen sich darüber von jeher anders aus. Der
alte Thorstumpf mit den Dohlennestern darauf war für sie eben das Wahrzeichen
der Stadt. Als solches hörten sie es von ihren Stadt- und Vereinsdichtern bei
jeder Gelegenheit feiern und zeigten es mit Stolz ihren Gastfreunden. Heimlich
aber wuchs nach und nach die Zahl derjenigen in der Bürgerschaft, welche sich
ihrem Localpatriotismus durch ganz gewöhnliche Empfindungen der Reinlich-
keit und Bequemlichkeit beirren liessen. Sie murrten über den engen, unsauberen
ünd dunklen Thorgang, sie fingen an, die Architektur des „altehrwürdigen“
Kastens mit zweifelsüchtigen Blicken zu bemustern, und wenn eine der historischen
öohlen sich ihnen noch durch etwas anderes als Schreien bemerkbar machte,
so ertragen sie es nicht mit der frommen Gelassenheit des Tobias. Und als ein
solches Missgeschick auch dem Apotheker Quiebutz begegnete und von diesem
>n der nächsten Stadtrathssitzung zum Ausgangspunkte einer Interpellation „über
bie Verkehrshindernisse am Dohlenthor“ gemacht wurde, da zeigte es sich, dass
bie Masse der Bürgerschaft hinter Herrn Quiebutz stand „wie ein Mann“.
Nun aber regte sich auch eine Gegenpartei, klein aber mächtig. Es waren
^umeist wohlhabende Herren, welche nicht in der Umgebung des Thores wohnten
ünd zu ihren Spaziergängen sich schönere Wege aussuchen konnten, als den
^Veg unter den riicksichtslosen Wappenvögeln her. Mit Ernst und Würde traten
s>e für das gefährdete Wahrzeichen ein, an ihrer Spitze der Rentner Winter,
ein College und Vetter des Bilderstürmers Quiebutz. Die Stadtväter suchten sich
htit ihrem gewöhnlichen Mittel zu helfen, sie verwiesen die Angelegenheit in eine
Commission. Da aber diese Commission unglücklicher Weise aus Herrn Quiebutz
ünd Herrn Winter bestand, so zeitigten ihre Verhandlungen ausser zwei ein-
ander entgegenstehenden Separatvoten nur ein hoffnungsloses Zerwürfniss
2Wischen den beiden bisher so eng befreundeten Vettern und ihren Familien.
Lieschen Quiebutz brach auf Befehl ihres Vaters jede Verbindung mit ihrem
Jügendfreunde und beinahe schon Verlobten Konrad Winter ab, und die beiden
^äter theilten einander schriftlich mit, dass 'sie von jetzt ab nur noch dienstlich
üfit einander zu verkehren wünschten.
Ueber diese ersten Opfer des Bruderkrieges hin tobte die Schlacht weiter,
eben so erbittert und jedenfalls langwieriger als jener sagenhafte Kampf um das
^ohlenthor. Die Spalten des Grünauer Intelligenzblattes strotzten von Eingesandts
*ür und wider die Erhaltung der alten Ruine. Der Redacteur und Verleger brauchte
Vveiter nichts mehr zu thun, als diese Stimmen aus dem Volke von ihren
Schlimmsten Injurien zu säubern und sie zum Satz zu geben, er liess Scheere
üüd Kleistertopf ruhen und bestellte die für ihn unnöthig gewordenen grösseren
Clätter ab, denn von seinen Lesern interessirte sich keiner mehr für Politisches.
Jsdermann hatte nur für die Tagesfrage von Grünau Augen, Ohren und Vor-
Schläge. „Weg mit dem Schutthaufen!“ schrien die Radikalen unter der Führung
des lebhaften Quiebutz; „Achtung für das Wahrzeichen unserer Vaterstadt!“
Scholl es von denen um Winter zurück. Eine Mittelpartei verlangte, dass das
Jhor erhalten bleibe, aber „monumental“ ausgebaut und durch Wegräumen der
ü'üliegenden kleinen Häuser in die Mitte eines dem Verkehr ausreichenden freien
■^latzes gestellt werde — natürlich auf Stadtkosten; aber man wies sie von beiden
. [Nächdruck verboten.]
Seiten mit dem schnöden Vorwurfe des Eigennutzes zurück, und in der That
bestand diese Partei wesentlich aus Maurermeistern und den Besitzern jener
kleinen Häuser.
Vergebens forderte der Stadtdichter Romeo Wassermann in einem schwung-
haften Sonett die Bürger auf, „die Streitaxt zu vergraben“ und „am Duft der
Friedenspfeife sich zu laben“. Boshafte Kritiker wiesen ihn darauf hin, dass er
ja selbst Nichtraucher sei, und er musste den Schmerz erleben, dass zahlreiche
Grünauer den Dichterberuf in sich entdeckten und sein friedliches Sonett mit
langen und erbitterten Reimereien pro et contra hinwegschwemmten. Auch die
Wissenschaft liess ihre Stimme ertönen. Ein junger Lehrer wies in einern tief-
durchdachten Aufsatze nach, dass jene Vögel, welche der Sage nach einst die
Stadt errettet hatten, gar. keine Dohlen (monedula turrium), sondern Krähen
(corvus corone, vielleicht auch corvus cornix) und also mit den jetzigen Bewohnern
der Thurmruine gar nicht verwandt gewesen seien. Es entspann sich eine
heftige Controverse daraus, aber in der Sache wurde durch sie nichts gefördert.
Unterdessen war der ; Streit um das Dohlenthor auch bereits ausserhalb
Grünau’s bekannt geworden. Da gerade in der Politik todte Saison war, so
liess sich die Presse der grossen Städte den hübschen Stoff nicht entgehen und
kniipfte daran manches nachdenkliche Feuilleton über „Krähwinkelei“ und „ver-
botene Alterthümersucht“, bezw. über „modernen Vandalismus“ und „Gleich-
macherei“, je nach ihrer Parteistellung. Schliesslich mischte sich auch die Re-
gierung ein. Es kam ein Geheimrath aus dem Ministerium, ein sehr würdiger
und sehr glatt rasirter Herr, um die „Bedürfnissfrage“ festzustellen. Die Partei
Quiebutz hatte für diesen Fall einen Hauptstreich vorbereitet. Sie versammelte
alle verfügbaren Lastwagen, Bauernkarren u. s. w. in den Strassen, welche auf
das Dohlenthor zufuhren, und kaum hatte sich der hohe Herr zur Besichtigung
eingefunden, so legten diese sämmtlichen Gefährte los und verwickelten sich vor
und unter dem Thore in einen gräulichen Knäuel, der an einer verkehrhemmenden
Bedeutung des alten Steinklotzes keinen Zweifel mehr liess. Am Nachmittage
aber übernahmen seine Vertheidiger, welche den Braten gerochen hatten, die
Führung des Regierungscommissars, und da lag die Umgegend des Thores in
friedlicher, nur von wenigen Passanten unterbrochenen Stille. Darauf reiste der
würdige und glattrasirte Herr wieder ab und erstattete der Regierung seinen
Bericht dahin, dass die Bedürfnissfrage noch nicht hinlänglich geklärt erscheine
und es war wieder nichts.
Am Tage nach dem Besuche des hohen Herrn stieg im ersten Gasthofe
von Grünau, dem Hotel zur goldenen Dohle, ein merlcwürdiger Fremdling ab:
graue, weitangelegte Reisekleider, grauer Cylinder, eine lange, hagere Gestalt
mit verwitterten Zügen und einem langen, viereckigen Knebelbart, kurz ganz
das was man sich in Grünau als einen reisenden Amerikaner vorzustellen pflegt.
Der Wirth empfing ihn mit ausgesuchter Höflichkeit, auf welche der Fremde
mit gemüthlicher Grobheit erwiderte. Er bekam denn auch die besten Zimmer,
bestellte und ass die besten Sachen und fragte sodann in seinem etwas anglisirten
Deutsch nach dem Apotheker Quiebutz. Zufällig war dieser gerade auf einen
Schoppen eingekehrt. Der Fremde trat auf ihn zu, betrachtete ihn prüfend,
schüttelte ihm sodann mit schmerzerzeugender Heftigkeit eine Minute lang die
Hand und rief: „Well old fellow, kennt Ihr mich nicht mehr?“
„Du lieber Himmel,“ fragte Herr Quiebutz ungewiss, „Sie siud doch nicht
— sind Sie am Ende mein Vetter Karl Krapp?“
„Well, denke dass ich’s bin,“ erwiderte der Andere mit einem angenehmen
Grinsen, „habe mich lange nicht mehr sehen lassen, was? Musste doch ’mal
sehen, ob das alte Nest noch auf seinem alten P’leck steht!“
Dieser Vetter Karl Krapp — oder wie sich der Bürger der Vereinigten
Staaten jetzt aussprach Charles Washington Krepp — war vor einigen zwanzig
Jahren aus Grünau verschwunden, nicht ganz freiwillig, wie es hiess, und dann
nach einigen Jahren in Amerika verschollen. Längst hatte ihn kein Mensch in
Grünau mehr unter den Lebenden geglaubt. Und nun taüchte er. auf einmal
wieder in dem alten Städtchen auf, trug haselnussgrosse Brillanten als Hemden-
knöpfchen und war, wie er Herrn Quiebutz bei einem gemüthlichen „drink“
erzählte, Hauptactionair der grössten Seehundjägercompagnie in San Francisco!
Herr Quiebutz ruhte nicht, bis ihn der Wiedergefundene zu Frau und
Tochter nach Hause begleitete. Seit dem unglückseligen Zerwürfniss mit seinem
Vetter Winter sah er sich seitens seiner Damen so vielen vorwurfsvollen, thränen-
feuchten Blicken ausgesetzt, dass ihm die Erscheinung des amerikailischen Onkels
wie eine Erlösung vom Himmel vorkam. Auch rechtfertigte dieser däs Vertrauen
des leidenden Gatten und Vaters glänzend. Seine derbe, offene Gemüthlichkeit
und die mehr als romantischen Erzählungen aus seinem Leben jenseits des
Wassers, gewannen ihm ebenso schnell das Herz der Damen wie des Hausherrn,
und es gab nach langer Z.eit wieder einmal einen behaglichen Abend im Hause
Quiebutz. Was dem Amerikan.er aber ganz besonders , den Dank der beiden
Damen sicherte, war, dass er sich sogleich auch nach dem Vetter Winter er-
IX. 24. IV.
treit um das
ohlenthor.
Von E. Lenbach.
Jls Markgraf Kuno der Rothbärtige von seinem Neffen Friedrich mit dem
' lahmen Bein besiegt worden war, warf er sich mit dem Reste seiner
Getreuen in die feste Stadt Grünau. Die Feinde aber liessen ihm
aUch hier keine Ruhe. Sie schlossen die Stadt ein, und fast wäre es ihnen ge-
'ungen, an einem nebligen und kalten Morgen die Mauern zu übersteigen. Die
hohlen aber, welche auf dem nächstgelegenen Stadtthore nisteten, warfen sich
mit Ungestüm auf die Eindringlinge, sie pickten ihnen nach den Augen, scheuchten
s>e von den Leitern und Mauern hinunter und weckten mit ihrem Geschrei die
s°rglosen Wächter, also dass der Angriff abgeschlagen wurde.
So erzählt eine Grünauer Chronik aus dem dreizehnten Jahrhundert. Jedes
Kind in Grünau kennt die Geschichte, jeder Fremde bekommt sie zu hören.
Man zeigt ihm das Stadtwappen, welches im silbernen Felde eine schwarze
t*ohle über einem rothen Thurme trägt, und wenn er Manns genug ist, eine
"'eitere Wanderung über das Strassenpflaster von Grünau nicht zu scheuen, so
führt man ihn auch vor das Dohlenthor, auf welchem die dunlden Vögel noch
heute nisten.
Leider muss zugegeben werden, dass der künstlerische Eindruck des Thores
hinter der Anmuth der Sage weit zurückbleibt. Ein klotziger, schmuckloser
Steinwürfel, grau und ungemein verwittert, mit einem halbverfaulten hölzernen
Nothdach und einem engen, muffigen Durchgang, zwischen zwei kümmerlichen
^lauerstümpfen, das ist alles. Auf irgend einem alten Berghügel, mit Epheu be-
"'achsen und von Weinbergen umkränzt, könnte es zur Noth als Staffage bestehen;
aber inmitten der Stadt, die doch immerhin längst über ihre mittelalterlichen
Wallgräben hinaus gewachsen ist und gerade an dieser Stelle so etwas wie leb-
baften Verkehr aufweist, sieht das Ding für jedes fremde Äuge so unerfreulich
Und störend aus wie eine verlassene Brandstätte.
Die Grünauer natürlich sprachen sich darüber von jeher anders aus. Der
alte Thorstumpf mit den Dohlennestern darauf war für sie eben das Wahrzeichen
der Stadt. Als solches hörten sie es von ihren Stadt- und Vereinsdichtern bei
jeder Gelegenheit feiern und zeigten es mit Stolz ihren Gastfreunden. Heimlich
aber wuchs nach und nach die Zahl derjenigen in der Bürgerschaft, welche sich
ihrem Localpatriotismus durch ganz gewöhnliche Empfindungen der Reinlich-
keit und Bequemlichkeit beirren liessen. Sie murrten über den engen, unsauberen
ünd dunklen Thorgang, sie fingen an, die Architektur des „altehrwürdigen“
Kastens mit zweifelsüchtigen Blicken zu bemustern, und wenn eine der historischen
öohlen sich ihnen noch durch etwas anderes als Schreien bemerkbar machte,
so ertragen sie es nicht mit der frommen Gelassenheit des Tobias. Und als ein
solches Missgeschick auch dem Apotheker Quiebutz begegnete und von diesem
>n der nächsten Stadtrathssitzung zum Ausgangspunkte einer Interpellation „über
bie Verkehrshindernisse am Dohlenthor“ gemacht wurde, da zeigte es sich, dass
bie Masse der Bürgerschaft hinter Herrn Quiebutz stand „wie ein Mann“.
Nun aber regte sich auch eine Gegenpartei, klein aber mächtig. Es waren
^umeist wohlhabende Herren, welche nicht in der Umgebung des Thores wohnten
ünd zu ihren Spaziergängen sich schönere Wege aussuchen konnten, als den
^Veg unter den riicksichtslosen Wappenvögeln her. Mit Ernst und Würde traten
s>e für das gefährdete Wahrzeichen ein, an ihrer Spitze der Rentner Winter,
ein College und Vetter des Bilderstürmers Quiebutz. Die Stadtväter suchten sich
htit ihrem gewöhnlichen Mittel zu helfen, sie verwiesen die Angelegenheit in eine
Commission. Da aber diese Commission unglücklicher Weise aus Herrn Quiebutz
ünd Herrn Winter bestand, so zeitigten ihre Verhandlungen ausser zwei ein-
ander entgegenstehenden Separatvoten nur ein hoffnungsloses Zerwürfniss
2Wischen den beiden bisher so eng befreundeten Vettern und ihren Familien.
Lieschen Quiebutz brach auf Befehl ihres Vaters jede Verbindung mit ihrem
Jügendfreunde und beinahe schon Verlobten Konrad Winter ab, und die beiden
^äter theilten einander schriftlich mit, dass 'sie von jetzt ab nur noch dienstlich
üfit einander zu verkehren wünschten.
Ueber diese ersten Opfer des Bruderkrieges hin tobte die Schlacht weiter,
eben so erbittert und jedenfalls langwieriger als jener sagenhafte Kampf um das
^ohlenthor. Die Spalten des Grünauer Intelligenzblattes strotzten von Eingesandts
*ür und wider die Erhaltung der alten Ruine. Der Redacteur und Verleger brauchte
Vveiter nichts mehr zu thun, als diese Stimmen aus dem Volke von ihren
Schlimmsten Injurien zu säubern und sie zum Satz zu geben, er liess Scheere
üüd Kleistertopf ruhen und bestellte die für ihn unnöthig gewordenen grösseren
Clätter ab, denn von seinen Lesern interessirte sich keiner mehr für Politisches.
Jsdermann hatte nur für die Tagesfrage von Grünau Augen, Ohren und Vor-
Schläge. „Weg mit dem Schutthaufen!“ schrien die Radikalen unter der Führung
des lebhaften Quiebutz; „Achtung für das Wahrzeichen unserer Vaterstadt!“
Scholl es von denen um Winter zurück. Eine Mittelpartei verlangte, dass das
Jhor erhalten bleibe, aber „monumental“ ausgebaut und durch Wegräumen der
ü'üliegenden kleinen Häuser in die Mitte eines dem Verkehr ausreichenden freien
■^latzes gestellt werde — natürlich auf Stadtkosten; aber man wies sie von beiden
. [Nächdruck verboten.]
Seiten mit dem schnöden Vorwurfe des Eigennutzes zurück, und in der That
bestand diese Partei wesentlich aus Maurermeistern und den Besitzern jener
kleinen Häuser.
Vergebens forderte der Stadtdichter Romeo Wassermann in einem schwung-
haften Sonett die Bürger auf, „die Streitaxt zu vergraben“ und „am Duft der
Friedenspfeife sich zu laben“. Boshafte Kritiker wiesen ihn darauf hin, dass er
ja selbst Nichtraucher sei, und er musste den Schmerz erleben, dass zahlreiche
Grünauer den Dichterberuf in sich entdeckten und sein friedliches Sonett mit
langen und erbitterten Reimereien pro et contra hinwegschwemmten. Auch die
Wissenschaft liess ihre Stimme ertönen. Ein junger Lehrer wies in einern tief-
durchdachten Aufsatze nach, dass jene Vögel, welche der Sage nach einst die
Stadt errettet hatten, gar. keine Dohlen (monedula turrium), sondern Krähen
(corvus corone, vielleicht auch corvus cornix) und also mit den jetzigen Bewohnern
der Thurmruine gar nicht verwandt gewesen seien. Es entspann sich eine
heftige Controverse daraus, aber in der Sache wurde durch sie nichts gefördert.
Unterdessen war der ; Streit um das Dohlenthor auch bereits ausserhalb
Grünau’s bekannt geworden. Da gerade in der Politik todte Saison war, so
liess sich die Presse der grossen Städte den hübschen Stoff nicht entgehen und
kniipfte daran manches nachdenkliche Feuilleton über „Krähwinkelei“ und „ver-
botene Alterthümersucht“, bezw. über „modernen Vandalismus“ und „Gleich-
macherei“, je nach ihrer Parteistellung. Schliesslich mischte sich auch die Re-
gierung ein. Es kam ein Geheimrath aus dem Ministerium, ein sehr würdiger
und sehr glatt rasirter Herr, um die „Bedürfnissfrage“ festzustellen. Die Partei
Quiebutz hatte für diesen Fall einen Hauptstreich vorbereitet. Sie versammelte
alle verfügbaren Lastwagen, Bauernkarren u. s. w. in den Strassen, welche auf
das Dohlenthor zufuhren, und kaum hatte sich der hohe Herr zur Besichtigung
eingefunden, so legten diese sämmtlichen Gefährte los und verwickelten sich vor
und unter dem Thore in einen gräulichen Knäuel, der an einer verkehrhemmenden
Bedeutung des alten Steinklotzes keinen Zweifel mehr liess. Am Nachmittage
aber übernahmen seine Vertheidiger, welche den Braten gerochen hatten, die
Führung des Regierungscommissars, und da lag die Umgegend des Thores in
friedlicher, nur von wenigen Passanten unterbrochenen Stille. Darauf reiste der
würdige und glattrasirte Herr wieder ab und erstattete der Regierung seinen
Bericht dahin, dass die Bedürfnissfrage noch nicht hinlänglich geklärt erscheine
und es war wieder nichts.
Am Tage nach dem Besuche des hohen Herrn stieg im ersten Gasthofe
von Grünau, dem Hotel zur goldenen Dohle, ein merlcwürdiger Fremdling ab:
graue, weitangelegte Reisekleider, grauer Cylinder, eine lange, hagere Gestalt
mit verwitterten Zügen und einem langen, viereckigen Knebelbart, kurz ganz
das was man sich in Grünau als einen reisenden Amerikaner vorzustellen pflegt.
Der Wirth empfing ihn mit ausgesuchter Höflichkeit, auf welche der Fremde
mit gemüthlicher Grobheit erwiderte. Er bekam denn auch die besten Zimmer,
bestellte und ass die besten Sachen und fragte sodann in seinem etwas anglisirten
Deutsch nach dem Apotheker Quiebutz. Zufällig war dieser gerade auf einen
Schoppen eingekehrt. Der Fremde trat auf ihn zu, betrachtete ihn prüfend,
schüttelte ihm sodann mit schmerzerzeugender Heftigkeit eine Minute lang die
Hand und rief: „Well old fellow, kennt Ihr mich nicht mehr?“
„Du lieber Himmel,“ fragte Herr Quiebutz ungewiss, „Sie siud doch nicht
— sind Sie am Ende mein Vetter Karl Krapp?“
„Well, denke dass ich’s bin,“ erwiderte der Andere mit einem angenehmen
Grinsen, „habe mich lange nicht mehr sehen lassen, was? Musste doch ’mal
sehen, ob das alte Nest noch auf seinem alten P’leck steht!“
Dieser Vetter Karl Krapp — oder wie sich der Bürger der Vereinigten
Staaten jetzt aussprach Charles Washington Krepp — war vor einigen zwanzig
Jahren aus Grünau verschwunden, nicht ganz freiwillig, wie es hiess, und dann
nach einigen Jahren in Amerika verschollen. Längst hatte ihn kein Mensch in
Grünau mehr unter den Lebenden geglaubt. Und nun taüchte er. auf einmal
wieder in dem alten Städtchen auf, trug haselnussgrosse Brillanten als Hemden-
knöpfchen und war, wie er Herrn Quiebutz bei einem gemüthlichen „drink“
erzählte, Hauptactionair der grössten Seehundjägercompagnie in San Francisco!
Herr Quiebutz ruhte nicht, bis ihn der Wiedergefundene zu Frau und
Tochter nach Hause begleitete. Seit dem unglückseligen Zerwürfniss mit seinem
Vetter Winter sah er sich seitens seiner Damen so vielen vorwurfsvollen, thränen-
feuchten Blicken ausgesetzt, dass ihm die Erscheinung des amerikailischen Onkels
wie eine Erlösung vom Himmel vorkam. Auch rechtfertigte dieser däs Vertrauen
des leidenden Gatten und Vaters glänzend. Seine derbe, offene Gemüthlichkeit
und die mehr als romantischen Erzählungen aus seinem Leben jenseits des
Wassers, gewannen ihm ebenso schnell das Herz der Damen wie des Hausherrn,
und es gab nach langer Z.eit wieder einmal einen behaglichen Abend im Hause
Quiebutz. Was dem Amerikan.er aber ganz besonders , den Dank der beiden
Damen sicherte, war, dass er sich sogleich auch nach dem Vetter Winter er-
IX. 24. IV.