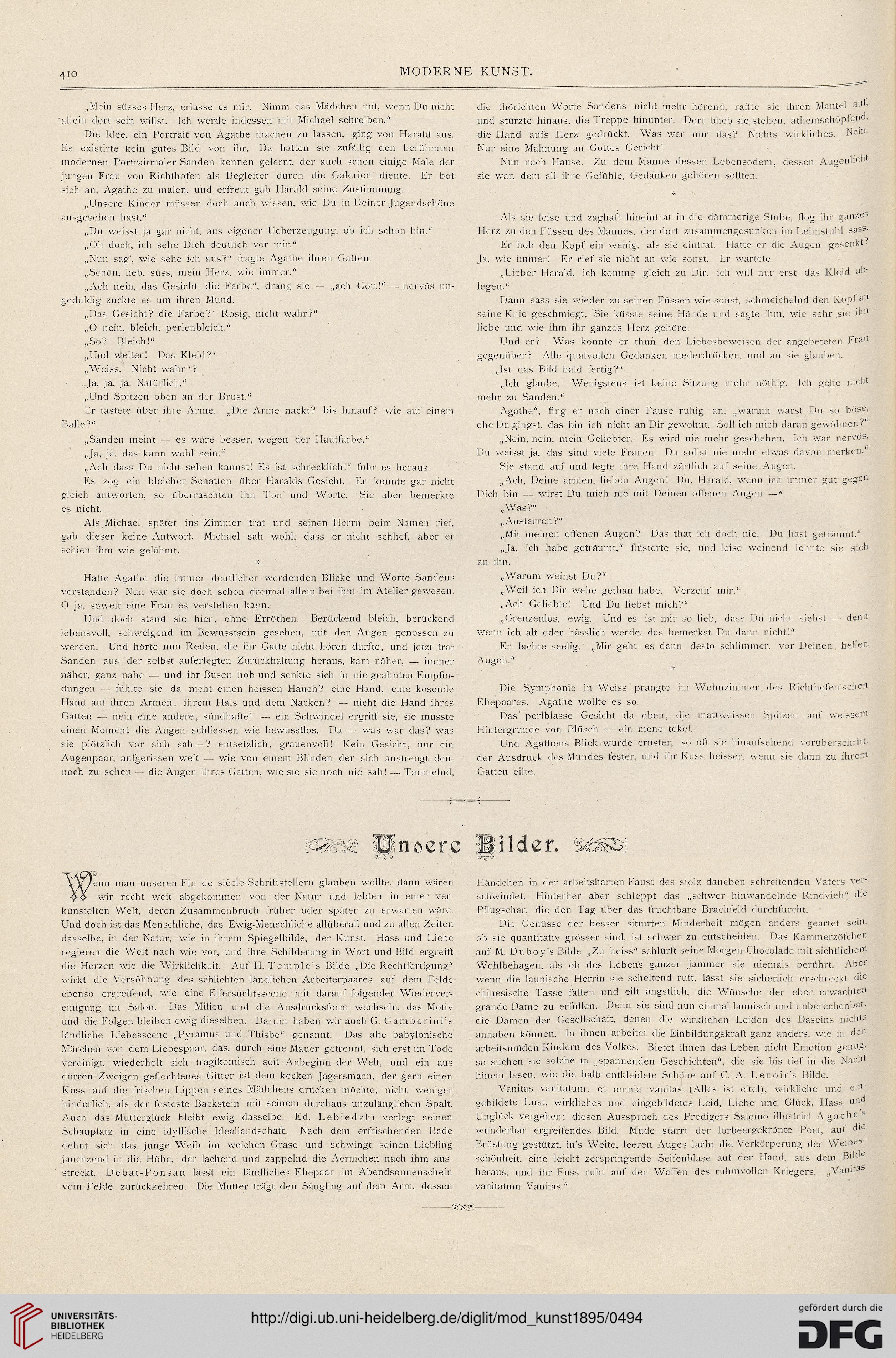4io
MODERNE KUNST.
„Mein süsses Herz, erlasse es mir. Nimm das Mädchen mit, wenn Du nicht
'allcin dort sein willst. Ich werde indessen mit Michael schreiben.“
Die Idce, ein Portrait von Agathe machen zu lassen, ging von Ilarald aus.
Es existirte kein gutes Bild von ihr. Da hatten sie zufällig den berühmten
modernen Portraitmaler Sanden kennen gelernt, der auch schon einige Male der
jungen Frau von Richthofen ais Begleiter durch die Galerien diente. Er bot
sich an, Agathe zu inalen, und erfreut gab Harald seine Zustimmung.
„Unsere Kinder müssen doch auch wissen, wie Du in Deiner Jugendschöne
ausgesehen hast.“
„Du weisst ja gar nicht, aus eigener Ueberzeugung, ob ich schön bin.“
„Oli doch, ich sehe Dich deutlich vor mir.“
„Nun sag’, wie sehe ich aus?" fragte Agathe ihren Gatten.
„Schön, lieb, süss, mein Herz, wie immer.“
„Ach nein, das Gesicht die Farbe“, drang sie — „ach Gottl“ — ncrvös un-
geduldig zuckte es um ihren Mund.
„Das Gesicht? die Farbe?' Rosig, nicht wahr?“
„O nein, bleich, perlenbleich.“
„So? Bleichl“
„Und weiterl Das Kleid?“
„Weiss. Nicht wahr“?
„Ja, ja, ja. Natürlich.“
„Und Spitzen oben an der Brust.“
Er tastcte iiber ilne Arme. „Die Armc nackt? bis hinauf? wie auf einem
Ballc?“
„Sanden meint es wäre besser, wegen der Hautfarbe.“
„Ja, ja, das kann wohl sein.“
„Ach dass Du nicht sehen kannst! Es ist schrccklich I“ fuhr es heraus.
Es zog ein bleicher Schatten über Haralds Gesicht. Er konnte gar nicht
gleich antworten, so überraschten ihn Ton und Worte. Sie aber bemerkte
es nicht.
AIs Michael später ins Zimrner trat und seinen Herrn beim Namen rie),
gab dieser keine Antwort. Michael sah wohl, dass er nicht schlief, aber er
schien ihm wie gelähmt.
Hatte Agathe die immei deutlicher werdenden Blicke und Worte Sandens
verstanden? Nun war sie doch schon dreimal allein bei ihm im Atelier gewesen.
O ja, soweit eine Frau es verstehen kann.
Und doch stand sie hier, ohne Erröthen. Beriickend bleich, berückend
iebensvoll, schwelgend im Bewusstsein gesehen, mit den Augen genossen zu
werden. Und hörte nun Reden, die ihr Gatte nicht horen dürfte, und jetzt trat
Sanden aus der selbst auferlegten Zurückhaltung heraus, kam riäher, — immer
näher, ganz nahe — und ihr ßusen hob und senkte sich in nie geahnten Empfin-
dungen — fühlte sie da mcht einen heissen Hauch? eine Hand, eine kosende
Hand auf ihren Armen, ihrem Hals und dem Nacken? — nicht die Hand ihres
Gatten — nein einc andere, sündhafte! — ein Schwindel ergriff sie, sie musste
einen Moment die Augen schliessen wie bewusstlos. Da — was war das? was
sie plötzlich vor sich sah — ? entsetzlich, grauenvoll! Kein Ges'cht, nur ein
Augenpaar. aufgerissen weit — wie von emem Blinden der sich anstrengt den-
noch zu sehen die Augen ihres Gatten, wie sie sie noch nie sah I Taumelnd,
Ipn^cre
V^/yenn man unseren Fin dc siecle-Schriftstellern glauben wollte, dann wären
Vsk wir recht weit abgekommen von der Natur und lebten in einer ver-
künstelten Welt, deren Zusarnmenbruch früher oder später zu erwarten wäre.
Und doch ist das Menschliche, das Ewig-Menschliche allüberall und zu allen Zeiten
dasselbe, in der Natur, wie in ihrem Spiegelbilde, der Kunst. Hass und Liebc
regieren die Welt nach wie vor, und ihre Schildcrung in Wort und Bild ergreift
die Herzen wie die Wirklichkeit. Auf H. Temple’s Bilde „Die Rechtfertigung“
wirkt die Versöhnung des schlichten ländlichen Arbeiterpaares auf dem Felde
ebenso ergreifend, wie eine Eifersuchtsscene mit darauf folgender Wiederver-
einigung im Salon. Das Milieu und die Ausdrucksform wechseln, das Motiv
und die Folgen bleibcn cwig dieselben. Darum haben wir auch G. Gamberini’s
ländlichc Liebesscene „Pyramus und Thisbe“ genannt. Das altc babylonische
Märchcn von dem Liebespaar, das, dureh eine Mauer gctrennt, sich erst im Tode
vereinigt, wiedcrholt sich tragikomisch seit Anbeginn dcr Welt, und ein aus
dürren Zweigen geflochtenes Gitter ist dem kecken Jägersmann, der gern einen
Kuss auf die frischen Lippen seines Mädchens drücken möchte, nicht weniger
hinderlich, als der festeste Backstein mit seinem durchaus unzulänglichen Spalt.
Auch das Mutterglück bleibt ewig dasselbe. Ed. Lebiedzki verlegt seinen
Schauplatz in eine idyllische Ideallandschaft. Nach dem erfrischenden Bade
dehnt sich das junge Weib im weichen Grase und schwingt seinen Liebling
jauchzend in die Höhe, der lachend und zappelnd die Aermchen nach ihm aus-
streckt. Debat-Ponsan lässt ein Iändliches Ehepaar im Abendsonnenschein
vom Felde zuriickkehren. Die Mutter trägt den Säugling auf dem Arm, dessen
die thörichten Wortc Sandens nicht mehr hörend, raffte sic ihren Mantel auf,
und stürzte hinaus, die Treppe hinunter. Dort blieb sie stehen, athemschöpfeüd’
die Hand aufs Herz gedriickt. Was war nur das? Nichts wirkliches. Nein-
Nur eine Mahnung an Gottes Gericht!
Nun nach Ilause. Zu dem Manne dessen Lebensodem, dessen AugenlicM
sic war, dem all ihre Gefühle, Gedanken gehören solltcn.
Als sie leise und zaghaft hineintrat in die dämmerige Stube, flog ihr ganzes
Ilerz zu den Füssen des Mannes, der dort zusannnengesunken im Lehnstuhl sass-
Er hob den Kopf ein wenig, als sie eintrat. Hatte er die Augen gesenkt-
Ja, wie immer! Er rief sie nicht an wie sonst. Er wartete.
„Lieber Harald, ich komrne gleich zu Dir, ich will nur erst das Kleid ab-
legen.“
Dann sass sie wieder zu seinen Füssen wie sonst, schmeichelnd den Kopf 3,1
seinc Knie geschmiegt. Sie küsste seine Hände und sagte ihm, wie sehr sie ihn
liebe und wie ihrn ihr ganzes Herz gehöre.
Und er? Was konnte er thuri den Liebesbeweisen der angebeteten FraU
gegenüber? Alle qualvollen Gedanken niederdrücken, und an sie glauben.
„Ist das Bild bald fertig?“
„Ich glauhe. Wenigstens ist keine Sitzung mehr nöthig. Ich gehe nicht
mehr zu Sanden.“
Agathe“, fing er nacli einer Pause ruhig an. „warum warst Du so böse,
ehe Du gingst, das bin ich nicht an Dir gewohnt. Soll ich mich daran gewöhnen?“
„Nein. nein, mein Geliebter. Es wird nie mehr geschehen. Ich war nervös.
Du weisst ja, das sind viele Frauen. Du sollst nie rnehr etwas davon merken.
Sie stand auf und legte ihre Hand zärtlich auf seine Augen.
„Ach, Deine armen, lieben Augen! Du, Harald, wenn ich immer gut gegert
Dich bin — wirst Du mich nie mit Deinen offenen Augen —“
„Was?“
„Anstarren?“
„Mit meinen oflenen Augen? Das that ich doch nie. Du hast geträumt.“
„Ja, ich habe geträumt," flüsterte sie, und leise weinend lehnte sie sich
an ihn.
„Warum weinst Du?“
„Weil ich Dir wehe gethan habe. Verzeih’ mir.“
„Ach Geliebte! Und Du liebst mich?“
„Grenzenlos, ewig. Und es ist mir so lieb, dass Du nicht siehst — denrt
wenn ich alt oder hässlich werde, das bemerkst Du dann nicht!“
Er lachte seelig. „Mir geht es dann desto schlimmer, vor Deinen hellert
Augen.“
Die S.ymphonie in Weiss prangte im Wohnzimmer des Richt'nofen’schen
Ehepaares. Agathe wollte es so.
Das' perlblasse Gesicht da oben, die mattweissen Spitzen auf weissern
Hintergrunde von Plüsch — ein mene tekel.
Und Agathens Blick wurde ernster, so oft sie hinaulsehend vorüberschritt.
der Ausdruck dcs Mundes fester, und ihr Kuss heisser, wenn sie dann zu ihrem
Gatten eilte.
Händchen in der arbeitsharten Faust des stolz daneben schreitenden Vaters ver-
schwindet. Hinterher aber schleppt das „schwer hinwandelnde Rindvieh“ dte
Pflugschar, die den Tag über das fruchtbare Brachfeld durchfurcht.
Die Genüsse der besser situirten Minderheit mögen anders geartet sein-
ob sie quantitativ grösser sind, ist schwer zu entscheiden. Das Kammerzöfcheü
auf M. Duboy’s Bilde „Zu heiss“ schlürit seine Morgen-Chocolade mit sichtlicherü
Wohlbehagen, als ob des Lebens ganzer Jammer sie niemals berührt. Aber
wenn die launische Herrin sie scheltend ruft, lässt sie sicherlich erschreckt die
chinesische Tasse f'allen und eilt ängstlich, die Wünsche der eben ervvachteü
grande Darne zu erfüllen. Denn sie sind nun einmal launisch und unberechenbaf-
die Danien der Gesellschaft, denen die wirklichen Leiden des Daseins nichts
anhaben können. In ihnen arbeitet die Einbildungskraft ganz anders, wie in deü
arbeitsmüden Kindern des Volkes. Bietet ihnen das Leben nicht Emotion genug,
so suchen sie solche m „spannenden Geschichten“, dic sie bis tief in die Nacht
hinein lesen, wie die halb entkleidete Schöne auf C. A. Lenoir’s Bilde.
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas (Alles ist eitel), wirkliche und ein-
gebildete Lust, wirkliches und eingebildetes Leid, Liebe und Glück, Hass nnd
Unglück vergehen; diesen Ausspiuch des Predigers Salomo illustrirt Agache s
wunderbar ergreifendes Bild. Müde starrt der lorbeergekrönte Poet, auf di e
Brüstung gestützt, in's Weite, leeren Auges lacht die Verkörperung der WeibeS'
schönheit, eine leicht zerspringende Seifenblase auf der Hand, aus dem Bi'd e
heraus, und ihr Fuss ruht auf den Waffen des ruhmvollen Kriegers. „Vanita 3
vanitatum Vanitas.“
•X- -
MODERNE KUNST.
„Mein süsses Herz, erlasse es mir. Nimm das Mädchen mit, wenn Du nicht
'allcin dort sein willst. Ich werde indessen mit Michael schreiben.“
Die Idce, ein Portrait von Agathe machen zu lassen, ging von Ilarald aus.
Es existirte kein gutes Bild von ihr. Da hatten sie zufällig den berühmten
modernen Portraitmaler Sanden kennen gelernt, der auch schon einige Male der
jungen Frau von Richthofen ais Begleiter durch die Galerien diente. Er bot
sich an, Agathe zu inalen, und erfreut gab Harald seine Zustimmung.
„Unsere Kinder müssen doch auch wissen, wie Du in Deiner Jugendschöne
ausgesehen hast.“
„Du weisst ja gar nicht, aus eigener Ueberzeugung, ob ich schön bin.“
„Oli doch, ich sehe Dich deutlich vor mir.“
„Nun sag’, wie sehe ich aus?" fragte Agathe ihren Gatten.
„Schön, lieb, süss, mein Herz, wie immer.“
„Ach nein, das Gesicht die Farbe“, drang sie — „ach Gottl“ — ncrvös un-
geduldig zuckte es um ihren Mund.
„Das Gesicht? die Farbe?' Rosig, nicht wahr?“
„O nein, bleich, perlenbleich.“
„So? Bleichl“
„Und weiterl Das Kleid?“
„Weiss. Nicht wahr“?
„Ja, ja, ja. Natürlich.“
„Und Spitzen oben an der Brust.“
Er tastcte iiber ilne Arme. „Die Armc nackt? bis hinauf? wie auf einem
Ballc?“
„Sanden meint es wäre besser, wegen der Hautfarbe.“
„Ja, ja, das kann wohl sein.“
„Ach dass Du nicht sehen kannst! Es ist schrccklich I“ fuhr es heraus.
Es zog ein bleicher Schatten über Haralds Gesicht. Er konnte gar nicht
gleich antworten, so überraschten ihn Ton und Worte. Sie aber bemerkte
es nicht.
AIs Michael später ins Zimrner trat und seinen Herrn beim Namen rie),
gab dieser keine Antwort. Michael sah wohl, dass er nicht schlief, aber er
schien ihm wie gelähmt.
Hatte Agathe die immei deutlicher werdenden Blicke und Worte Sandens
verstanden? Nun war sie doch schon dreimal allein bei ihm im Atelier gewesen.
O ja, soweit eine Frau es verstehen kann.
Und doch stand sie hier, ohne Erröthen. Beriickend bleich, berückend
iebensvoll, schwelgend im Bewusstsein gesehen, mit den Augen genossen zu
werden. Und hörte nun Reden, die ihr Gatte nicht horen dürfte, und jetzt trat
Sanden aus der selbst auferlegten Zurückhaltung heraus, kam riäher, — immer
näher, ganz nahe — und ihr ßusen hob und senkte sich in nie geahnten Empfin-
dungen — fühlte sie da mcht einen heissen Hauch? eine Hand, eine kosende
Hand auf ihren Armen, ihrem Hals und dem Nacken? — nicht die Hand ihres
Gatten — nein einc andere, sündhafte! — ein Schwindel ergriff sie, sie musste
einen Moment die Augen schliessen wie bewusstlos. Da — was war das? was
sie plötzlich vor sich sah — ? entsetzlich, grauenvoll! Kein Ges'cht, nur ein
Augenpaar. aufgerissen weit — wie von emem Blinden der sich anstrengt den-
noch zu sehen die Augen ihres Gatten, wie sie sie noch nie sah I Taumelnd,
Ipn^cre
V^/yenn man unseren Fin dc siecle-Schriftstellern glauben wollte, dann wären
Vsk wir recht weit abgekommen von der Natur und lebten in einer ver-
künstelten Welt, deren Zusarnmenbruch früher oder später zu erwarten wäre.
Und doch ist das Menschliche, das Ewig-Menschliche allüberall und zu allen Zeiten
dasselbe, in der Natur, wie in ihrem Spiegelbilde, der Kunst. Hass und Liebc
regieren die Welt nach wie vor, und ihre Schildcrung in Wort und Bild ergreift
die Herzen wie die Wirklichkeit. Auf H. Temple’s Bilde „Die Rechtfertigung“
wirkt die Versöhnung des schlichten ländlichen Arbeiterpaares auf dem Felde
ebenso ergreifend, wie eine Eifersuchtsscene mit darauf folgender Wiederver-
einigung im Salon. Das Milieu und die Ausdrucksform wechseln, das Motiv
und die Folgen bleibcn cwig dieselben. Darum haben wir auch G. Gamberini’s
ländlichc Liebesscene „Pyramus und Thisbe“ genannt. Das altc babylonische
Märchcn von dem Liebespaar, das, dureh eine Mauer gctrennt, sich erst im Tode
vereinigt, wiedcrholt sich tragikomisch seit Anbeginn dcr Welt, und ein aus
dürren Zweigen geflochtenes Gitter ist dem kecken Jägersmann, der gern einen
Kuss auf die frischen Lippen seines Mädchens drücken möchte, nicht weniger
hinderlich, als der festeste Backstein mit seinem durchaus unzulänglichen Spalt.
Auch das Mutterglück bleibt ewig dasselbe. Ed. Lebiedzki verlegt seinen
Schauplatz in eine idyllische Ideallandschaft. Nach dem erfrischenden Bade
dehnt sich das junge Weib im weichen Grase und schwingt seinen Liebling
jauchzend in die Höhe, der lachend und zappelnd die Aermchen nach ihm aus-
streckt. Debat-Ponsan lässt ein Iändliches Ehepaar im Abendsonnenschein
vom Felde zuriickkehren. Die Mutter trägt den Säugling auf dem Arm, dessen
die thörichten Wortc Sandens nicht mehr hörend, raffte sic ihren Mantel auf,
und stürzte hinaus, die Treppe hinunter. Dort blieb sie stehen, athemschöpfeüd’
die Hand aufs Herz gedriickt. Was war nur das? Nichts wirkliches. Nein-
Nur eine Mahnung an Gottes Gericht!
Nun nach Ilause. Zu dem Manne dessen Lebensodem, dessen AugenlicM
sic war, dem all ihre Gefühle, Gedanken gehören solltcn.
Als sie leise und zaghaft hineintrat in die dämmerige Stube, flog ihr ganzes
Ilerz zu den Füssen des Mannes, der dort zusannnengesunken im Lehnstuhl sass-
Er hob den Kopf ein wenig, als sie eintrat. Hatte er die Augen gesenkt-
Ja, wie immer! Er rief sie nicht an wie sonst. Er wartete.
„Lieber Harald, ich komrne gleich zu Dir, ich will nur erst das Kleid ab-
legen.“
Dann sass sie wieder zu seinen Füssen wie sonst, schmeichelnd den Kopf 3,1
seinc Knie geschmiegt. Sie küsste seine Hände und sagte ihm, wie sehr sie ihn
liebe und wie ihrn ihr ganzes Herz gehöre.
Und er? Was konnte er thuri den Liebesbeweisen der angebeteten FraU
gegenüber? Alle qualvollen Gedanken niederdrücken, und an sie glauben.
„Ist das Bild bald fertig?“
„Ich glauhe. Wenigstens ist keine Sitzung mehr nöthig. Ich gehe nicht
mehr zu Sanden.“
Agathe“, fing er nacli einer Pause ruhig an. „warum warst Du so böse,
ehe Du gingst, das bin ich nicht an Dir gewohnt. Soll ich mich daran gewöhnen?“
„Nein. nein, mein Geliebter. Es wird nie mehr geschehen. Ich war nervös.
Du weisst ja, das sind viele Frauen. Du sollst nie rnehr etwas davon merken.
Sie stand auf und legte ihre Hand zärtlich auf seine Augen.
„Ach, Deine armen, lieben Augen! Du, Harald, wenn ich immer gut gegert
Dich bin — wirst Du mich nie mit Deinen offenen Augen —“
„Was?“
„Anstarren?“
„Mit meinen oflenen Augen? Das that ich doch nie. Du hast geträumt.“
„Ja, ich habe geträumt," flüsterte sie, und leise weinend lehnte sie sich
an ihn.
„Warum weinst Du?“
„Weil ich Dir wehe gethan habe. Verzeih’ mir.“
„Ach Geliebte! Und Du liebst mich?“
„Grenzenlos, ewig. Und es ist mir so lieb, dass Du nicht siehst — denrt
wenn ich alt oder hässlich werde, das bemerkst Du dann nicht!“
Er lachte seelig. „Mir geht es dann desto schlimmer, vor Deinen hellert
Augen.“
Die S.ymphonie in Weiss prangte im Wohnzimmer des Richt'nofen’schen
Ehepaares. Agathe wollte es so.
Das' perlblasse Gesicht da oben, die mattweissen Spitzen auf weissern
Hintergrunde von Plüsch — ein mene tekel.
Und Agathens Blick wurde ernster, so oft sie hinaulsehend vorüberschritt.
der Ausdruck dcs Mundes fester, und ihr Kuss heisser, wenn sie dann zu ihrem
Gatten eilte.
Händchen in der arbeitsharten Faust des stolz daneben schreitenden Vaters ver-
schwindet. Hinterher aber schleppt das „schwer hinwandelnde Rindvieh“ dte
Pflugschar, die den Tag über das fruchtbare Brachfeld durchfurcht.
Die Genüsse der besser situirten Minderheit mögen anders geartet sein-
ob sie quantitativ grösser sind, ist schwer zu entscheiden. Das Kammerzöfcheü
auf M. Duboy’s Bilde „Zu heiss“ schlürit seine Morgen-Chocolade mit sichtlicherü
Wohlbehagen, als ob des Lebens ganzer Jammer sie niemals berührt. Aber
wenn die launische Herrin sie scheltend ruft, lässt sie sicherlich erschreckt die
chinesische Tasse f'allen und eilt ängstlich, die Wünsche der eben ervvachteü
grande Darne zu erfüllen. Denn sie sind nun einmal launisch und unberechenbaf-
die Danien der Gesellschaft, denen die wirklichen Leiden des Daseins nichts
anhaben können. In ihnen arbeitet die Einbildungskraft ganz anders, wie in deü
arbeitsmüden Kindern des Volkes. Bietet ihnen das Leben nicht Emotion genug,
so suchen sie solche m „spannenden Geschichten“, dic sie bis tief in die Nacht
hinein lesen, wie die halb entkleidete Schöne auf C. A. Lenoir’s Bilde.
Vanitas vanitatum, et omnia vanitas (Alles ist eitel), wirkliche und ein-
gebildete Lust, wirkliches und eingebildetes Leid, Liebe und Glück, Hass nnd
Unglück vergehen; diesen Ausspiuch des Predigers Salomo illustrirt Agache s
wunderbar ergreifendes Bild. Müde starrt der lorbeergekrönte Poet, auf di e
Brüstung gestützt, in's Weite, leeren Auges lacht die Verkörperung der WeibeS'
schönheit, eine leicht zerspringende Seifenblase auf der Hand, aus dem Bi'd e
heraus, und ihr Fuss ruht auf den Waffen des ruhmvollen Kriegers. „Vanita 3
vanitatum Vanitas.“
•X- -