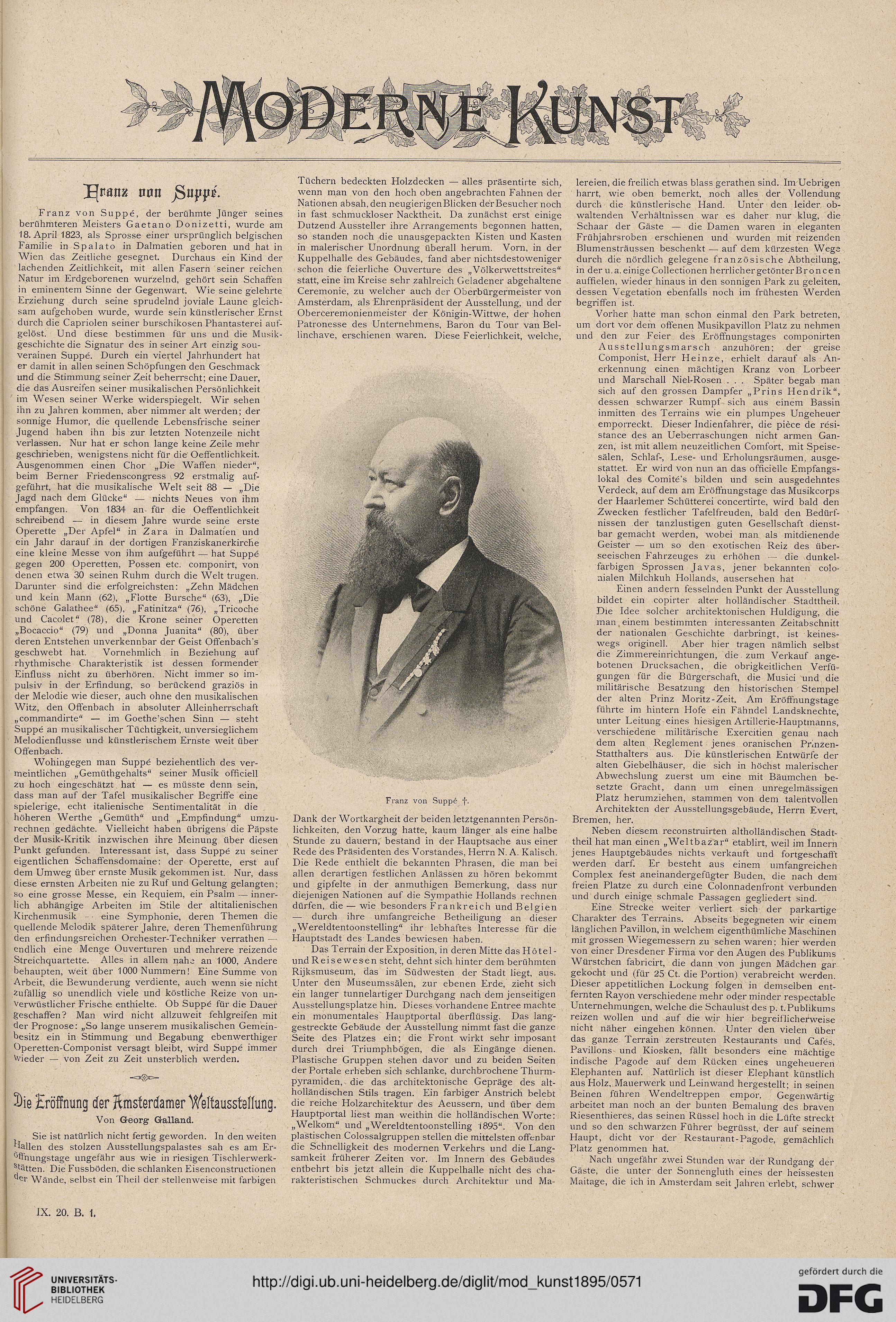l^itans nnn jSnjipif.
Franz von Suppe, der berühmte Jünger seines
berühmteren Meisters Gaetano Donizetti, wurde am
18. April 1823, als Sprosse einer ursprünglich belgischen
Familie in Spalato in Dalmatien geboren und hat in
Wien das Zeitliche gesegnet. Durchaus ein Kind der
lachenden Zeitlichkeit, mit allen Fasern seiner reichen
Natur im Erdgeborenen wurzelnd, gehört sein Schafi'en
in eminentem Sinne der Gegenwart. Wie seine gelehrte
Erziehung durch seine sprudelnd joviale Laune gleich-
sam aufgehoben wurde, wurde sein künstlerischer Ernst
durch die Capriolen seiner burschikosen Phantasterei auf-
gelöst. Und diese bestimmen für uns und die Musik-
geschichte die Signatur des in seiner Art einzig sou-
verainen Suppe. Durch ein viertel Jahrhundert hat
er damit in allen seinen Schöpfungen den Geschmack
und die Stimmung seiner Zeit beherrscht; eine Dauer,
die das Ausreifen seiner musikalischen Persönlichkeit
im Wesen seiner Werke widerspiegelt. Wir sehen
ihn zu Jahren kommen, aber nimmer alt werden; der
sonnige Humor, die quellende Lebensfrische seiner
Jugend haben ihn bis zur letzten Notenzeile nicht
verlassen. Nur hat er schon lange keine Zeile mehr
geschrieben, wenigstens nicht für die Oeffentlichkeit.
Ausgenommen einen Chor „Die Waffen nieder“,
beim Berner Friedenscongress 92 erstmalig auf-
geführt, hat die musikalische Welt seit 88 — „Die
Jagd nach dem Glücke“ — nichts Neues von ihm
empfangen. Von 1834 an für die Oeffentlichkeit
schreibend — in diesem Jahre wurde seine erste
Operette „Der Apfel“ in Zara in Dalmatien und
ein Jahr darauf in der dortigen Franziskanerkirche
eine kleine Messe von ihm aufgeführt — hat Suppe
gegen 200 Operetten, Possen etc. componirt, von
denen etwa 30 seinen Ruhm durch die Welt trugen.
Darunter sind die erfolgreichsten: „Zehn Mädchen
und kein Mann (62), „Flotte Bursche“ (63), „Die
schöne Galathee“ (65), „Fatinitza“ (76), „Tricoche
und Cacolet“ (78), die Krone seiner Operetten
„Bocaccio“ (79) und „Donna Juanita“ (80), über
deren Entstehen unverkennbar der Geist Offenbach's
geschwebt hat. Vornehmlich in Beziehung auf
rhythmische Charakteristik ist dessen formender
Einfluss nicht zu überhören. Nicht immer so im-
pulsiv in der Erfindung, so berückend graziös in
der Melodie wie dieser, auch ohne den musikalischen
Witz, den Offenbach in absoluter Alleinherrschaft
„commandirte“ — im Goethe’schen Sinn — steht
, Suppe an musikalischer Tüchtigkeit, unversieglichem
Melodienflusse und künstlerischem Ernste weit tiber
Offenbach.
Wohingegen man Suppe beziehentlich des ver-
meintlichen „Gemüthgehalts“ seiner Musik officiell
zu hoch eingeschätzt hat — es müsste denn sein,
dass man auf der Tafel musikalischer Begriffe eme
spielerige, echt italienische Sentimentalität in die
höheren Werthe „Gemüth“ und „Empfindung“ umzu-
rechnen gedächte. Vielleicht haben übrigens die Päpste
der Musik-Kritik inzwischen ihre Meinung über diesen
Punkt gefunden. Interessant ist, dass Suppe zu seiner
eigentlichen Schaffensdomaine: der Operette, erst auf
dem Umweg über ernste Musik gekommen ist. Nur, dass
diese ernsten Arbeiten nie zu Ruf und Geltung gelangten;
so eine grosse Messe, ein Requiem, ein Psalm — inner-
lich abhängige Arbeiten im Stile der altitalienischen
Kirchenmusik - eine Symphonie, deren Themen die
quellende Melodik späterer Jahre, deren Themenführung
den erfindungsreichen Orchester-Techniker verrathen —
endlich eine Menge Ouverturen und mehrere reizende
Streichquartette. Alles in allem nahe an 1000, Andere
behaupten, weit über lOOONummern! Eine Summe von
Arbeit, die Bewunderung verdiente, auch wenn sie nicht
Zufällig so unendlich viele und köstliche Reize von un-
Verwüstlicher Frische enthielte. Ob Suppe für die Dauer
geschaffen? Man wird nicht allzuweit fehlgreifen mit
der Prognose: „So lange unserem musikalischen Gemein-
besitz ein in Stimmung und Begabung ebenwerthiger
Operetten-Componist versagt bleibt, wird Suppe immer
\vieder — von Zeit zu Zeit unsterblich werden.
-=*§*=~
3)ie Eröffnung der Emsferdamer Welfaussfeflung.
Von Georg Galland.
Sie ist natürlich nicht fertig geworden. In den weiten
^lallen des stolzen Ausstellungspalastes sah es am Er-
öftnungstage ungefähr aus wie in riesigen Tischlerwerk-
stätten. Die Fussböden, die schlanken Eisenconstructionen
^ er Wände, selbst ein Theil der stellenweise mit farbigen
Tüchern bedeckten Holzdecken — alles präsentirte sich,
wenn man von den hoch oben angebrachten Fahnen der
Nationen absah, den neugierigenBlicken derBesucher noch
in fast schmuckloser Nacktheit. Da zunächst erst einige
Dutzend Aussteller ihre Arrangements begonnen hatten,
so standen noch die unausgepackten Kisten und Kasten
in malerischer Unordnung überall herum. Vorn, in der
Kuppelhalle des Gebäudes, fand aber nichtsdestoweniger
schon die feierliche Ouverture des „Völkerwettstreites“
statt, eine im Kreise sehr zahlreich Geladener abgehaltene
Ceremonie, zu welcher auch der Oberbürgermeister von
Amsterdam, als Ehrenpräsident der Ausstellung, und der
Oberceremonienmeister der Königin-Wittwe, der hohen
Patronesse des Unternehmens, Baron du Tour van Bel-
linchave, erschienen waren. Diese Feierlichkeit, welche,
Franz von Suppe f.
Dank der Wortkargheit der beiden letztgenannten Persön-
lichkeiten, den Vorzug hatte, kaum länger als eine halbe
Stunde zu dauern, bestand in der Hauptsache aus einer
Rede des Präsidenten des Vorstandes, Herrn N. A. Kalisch.
Die Rede enthielt die bekannten Phrasen, die man bei
allen derartigen festlichen Anlässen zu hören bekommt
und gipfelte in der anmuthigen Bemerkung, dass nur
diejenigen Nationen auf die Sympathie Hollands rechnen
dürfen, die — wie besonders Frankreich und Belgien
— durch ihre umfangreiche Betheiligung an dieser
„Wereldtentoonstelling“ ihr lebhaftes Interesse für die
Hauptstadt des Landes bewiesen haben.
Das Terrain der Exposition, in deren Mitte das Hötel-
und Reisewesen steht, dehnt sich hinter dem berühmten
Rijksmuseum, das im Südwesten der Stadt liegt, aus.
Unter den Museumssälen, zur ebenen Erde, zieht sich
ein langer tunnelartiger Durchgang nach dem jenseitigen
Ausstellungsplatze hin. Dieses vorhandene Entree machte
ein monumentales Hauptportal überflüssig. Das lang-
gestreckte Gebäude der Ausstellung nimmt fast die ganze
Seite des Platzes ein; die Front wirkt sehr imposant
durch drei Triumphbögen, die als Eingänge dienen.
Plastische Gruppen stehen davor und zu beiden Seiten
der Portale erheben sich schlanke, durchbrochene Thurm-
pyramiden, die das architektonische Gepräge des alt-
holländischen Stils tragen. Ein farbiger Anstrich belebt
die reiche Holzarchitektur des Aeussern, und iiber dem
Hauptportal liest man weithin die holländischen Worte:
„Welkom“ und „Wereldtentoonstelling 1895“. Von den
plastischen Colossalgruppen stellen die mittelsten offenbar
die Schnelligkeit des modernen Verkehrs und die Lang-
samkeit früherer Zeiten vor. Im Innern des Gebäudes
entbehrt bis jetzt allein die Kuppelhalle nicht des cha-
rakteristischen Schmuckes durch Architektur und Ma-
lereien, die freilich etwas blass gerathen sind. Im Uebrigen
harrt, wie oben bemerkt. noch alles der Vollendung
durch die künstlerische Hand. Unter den leider ob-
waltenden Verhältnissen war e^ daher nur klug, die
Schaar der Gäste — die Damen waren in eleganten
Frühjahrsroben erschienen und wurden mit reizenden
Blumensträussen beschenkt — auf dem kürzesten Wega
durch die nördlich gelegene französische Abtheilung,
in der u.a.einigeCollectionen herrlichergetönterBroncen
auffielen, wieder hinaus in den sonnigen Park zu geleiten,
dessen Vegetation ebenfalls noch im frühesten Werden
begriffen ist.
Vorher hatte man schon einmal den Park betreten,
um dort vor dem offenen Musikpavillon Platz zu nehmen
und den zur Feier des Eröffnungstages componirten
Ausstellungsmarsch anzuhören; der greise
Componist, Herr Heinze, erhielt darauf als An-
erkennung einen mächtigen Kranz von Lorbeer
und Marschall Niel-Rosen . . . Später begab man
sich auf den grossen Dampfer „Prins Hendrik“,
dessen schwarzer Rumpf sich aus einem Bassin
inmitten des Terrains wie ein plumpes Ungeheuer
emporreckt. Dieser Indienfahrer, die piece de resi-
stance des an Ueberraschungen nicht armen Gan-
zen, ist mit allem neuzeitlichen Comfort, mit Speise-
sälen, Schlaf-, Lese- und Erholungsräumen, ausge-
stattet. Er wird von nun an das officifelle Empfangs-
lokal des Comite's bilden und sein ausgedehntes
Verdeck, auf dem am Eröffnungstage das Musikcorps
der Haarlemer Schütterei concertirte, wird bald den
Zwecken festlicher Tafelfreuden, bald den Bedürf-
nissen der tanzlustigen guten Gesellschaft dienst-
bar gemacht werden, wobei man als mitdienende
Geister — um so den exotischen Reiz des über-
seeischen Fahrzeuges zu erhöhen — die dunkel-
farbigen Sprossen Javas, jener bekannten colo-
aialen Milchkuh Hollands, ausersehen hat
Einen andern fesselnden Punkt der Ausstellung
bildet ein copirter alter holländischer Stadttheil.
Die Idee solcher architektonischen Huldigung, die
man , einem bestimmten interessanten Zeitabschnitt
der nationalen Geschichte darbringt, ist keines-
wegs originell. Aber hier tragen nämlich selbst
die Zimmereinrichtungen, die zum Verkauf ange-
botenen Drucksachen, die obrigkeitlichen Verfü-
gungen für die Bürgerschaft, die Musici und die
militärische Besatzung den historischen Stempel
der alten Prinz Moritz-Zeit. Am Eröffnungstage
führte im hintern Hofe ein Fähndel Landsknechte,
unter Leitung eines hiesigen Artillerie-Hauptmanns,
verschiederie militärische Exercitien genau nach
dem alten Reglement jenes oranischen Prmzen-
Statthalters aus. Die künstlerischen Entwürfe der
alten Giebelhäuser, die sich in höchst malerischer
Abwechslung zuerst um eine mit Bäumchen be-
setzte Gracht, dann um einen unregelmässigen
Platz herumziehen, stammen von dem talentvollen
Architekten der Ausstellungsgebäude, Herrn Evert,
Bremen, her.
Neben diesem reconstruirten altholländischen Stadt-
theil hat man einen „Weltbazär“ etablirt, weil im Innern
jenes Hauptgebäudes nichts verkauft und fortgeschafft
werden darf. Er besteht aus einem umfangreichen
Complex fest aneinandergefügter Buden, die nach dem
freien Platze zu durch eine Colonnadenfront verbunden
und durch einige schmale Passagen gegliedert sind.
Eine Strecke weiter verliert sich der parkartige
Charakter des Terrains. Abseits begegneten wir einem
länglichen Pavillon, in welchem eigenthümliche Maschinen
mit grossen Wiegemessern zu sehen waren; hier werden
von einer Dresdener Firma vor den Augen des Publikums
Würstehen fabricirt, die dann von jungen Mädchen gar
gekocht und (für 25 Ct. die Portion) verabreicht werden.
Dieser appetitlichen Lockung folgeri in demselben ent-
fernten Rayon verschiedene mehr oder minder respectable
Unternehmungen, welche die Schaulust des p. t.Publikums
reizen wollen und auf die wir hier begreiflicherweise
nicht näher eingehen können. Unter den vielen über
das ganze Teri'ain zerstreuten Restaurants und Cafes,
Pavillons und Kiosken, fällt besonders eine mächtige
indische P.agode auf dem Rücken eines ungeheuereri
Elephanten auf. Natürlich ist dieser Elephant künstlich
ausHolz, Mauerwerk und Leinwand hergestellt; in seinen
Beinen führen Wendeltreppen empoi'. Gegenwärtig
arbeitet man noch an der bunten Bemalung des braven
Riesenthieres, das seinen Rüssel hoch in die Lüfte streckt
und so den schwarzen Führer begrüsst, der auf seinem
Haupt, dicht vor der Restaurant-Pagode, gemächlich
Platz genommen hat.
Nach ungefähr zwei Stunden war der Rundgang der
Gäste, die unter der Sonnengluth eines der heissesten
Maitage, die ich in Amsterdam seit Jahren erlebt, schwer
IX. 20. B. 1.
Franz von Suppe, der berühmte Jünger seines
berühmteren Meisters Gaetano Donizetti, wurde am
18. April 1823, als Sprosse einer ursprünglich belgischen
Familie in Spalato in Dalmatien geboren und hat in
Wien das Zeitliche gesegnet. Durchaus ein Kind der
lachenden Zeitlichkeit, mit allen Fasern seiner reichen
Natur im Erdgeborenen wurzelnd, gehört sein Schafi'en
in eminentem Sinne der Gegenwart. Wie seine gelehrte
Erziehung durch seine sprudelnd joviale Laune gleich-
sam aufgehoben wurde, wurde sein künstlerischer Ernst
durch die Capriolen seiner burschikosen Phantasterei auf-
gelöst. Und diese bestimmen für uns und die Musik-
geschichte die Signatur des in seiner Art einzig sou-
verainen Suppe. Durch ein viertel Jahrhundert hat
er damit in allen seinen Schöpfungen den Geschmack
und die Stimmung seiner Zeit beherrscht; eine Dauer,
die das Ausreifen seiner musikalischen Persönlichkeit
im Wesen seiner Werke widerspiegelt. Wir sehen
ihn zu Jahren kommen, aber nimmer alt werden; der
sonnige Humor, die quellende Lebensfrische seiner
Jugend haben ihn bis zur letzten Notenzeile nicht
verlassen. Nur hat er schon lange keine Zeile mehr
geschrieben, wenigstens nicht für die Oeffentlichkeit.
Ausgenommen einen Chor „Die Waffen nieder“,
beim Berner Friedenscongress 92 erstmalig auf-
geführt, hat die musikalische Welt seit 88 — „Die
Jagd nach dem Glücke“ — nichts Neues von ihm
empfangen. Von 1834 an für die Oeffentlichkeit
schreibend — in diesem Jahre wurde seine erste
Operette „Der Apfel“ in Zara in Dalmatien und
ein Jahr darauf in der dortigen Franziskanerkirche
eine kleine Messe von ihm aufgeführt — hat Suppe
gegen 200 Operetten, Possen etc. componirt, von
denen etwa 30 seinen Ruhm durch die Welt trugen.
Darunter sind die erfolgreichsten: „Zehn Mädchen
und kein Mann (62), „Flotte Bursche“ (63), „Die
schöne Galathee“ (65), „Fatinitza“ (76), „Tricoche
und Cacolet“ (78), die Krone seiner Operetten
„Bocaccio“ (79) und „Donna Juanita“ (80), über
deren Entstehen unverkennbar der Geist Offenbach's
geschwebt hat. Vornehmlich in Beziehung auf
rhythmische Charakteristik ist dessen formender
Einfluss nicht zu überhören. Nicht immer so im-
pulsiv in der Erfindung, so berückend graziös in
der Melodie wie dieser, auch ohne den musikalischen
Witz, den Offenbach in absoluter Alleinherrschaft
„commandirte“ — im Goethe’schen Sinn — steht
, Suppe an musikalischer Tüchtigkeit, unversieglichem
Melodienflusse und künstlerischem Ernste weit tiber
Offenbach.
Wohingegen man Suppe beziehentlich des ver-
meintlichen „Gemüthgehalts“ seiner Musik officiell
zu hoch eingeschätzt hat — es müsste denn sein,
dass man auf der Tafel musikalischer Begriffe eme
spielerige, echt italienische Sentimentalität in die
höheren Werthe „Gemüth“ und „Empfindung“ umzu-
rechnen gedächte. Vielleicht haben übrigens die Päpste
der Musik-Kritik inzwischen ihre Meinung über diesen
Punkt gefunden. Interessant ist, dass Suppe zu seiner
eigentlichen Schaffensdomaine: der Operette, erst auf
dem Umweg über ernste Musik gekommen ist. Nur, dass
diese ernsten Arbeiten nie zu Ruf und Geltung gelangten;
so eine grosse Messe, ein Requiem, ein Psalm — inner-
lich abhängige Arbeiten im Stile der altitalienischen
Kirchenmusik - eine Symphonie, deren Themen die
quellende Melodik späterer Jahre, deren Themenführung
den erfindungsreichen Orchester-Techniker verrathen —
endlich eine Menge Ouverturen und mehrere reizende
Streichquartette. Alles in allem nahe an 1000, Andere
behaupten, weit über lOOONummern! Eine Summe von
Arbeit, die Bewunderung verdiente, auch wenn sie nicht
Zufällig so unendlich viele und köstliche Reize von un-
Verwüstlicher Frische enthielte. Ob Suppe für die Dauer
geschaffen? Man wird nicht allzuweit fehlgreifen mit
der Prognose: „So lange unserem musikalischen Gemein-
besitz ein in Stimmung und Begabung ebenwerthiger
Operetten-Componist versagt bleibt, wird Suppe immer
\vieder — von Zeit zu Zeit unsterblich werden.
-=*§*=~
3)ie Eröffnung der Emsferdamer Welfaussfeflung.
Von Georg Galland.
Sie ist natürlich nicht fertig geworden. In den weiten
^lallen des stolzen Ausstellungspalastes sah es am Er-
öftnungstage ungefähr aus wie in riesigen Tischlerwerk-
stätten. Die Fussböden, die schlanken Eisenconstructionen
^ er Wände, selbst ein Theil der stellenweise mit farbigen
Tüchern bedeckten Holzdecken — alles präsentirte sich,
wenn man von den hoch oben angebrachten Fahnen der
Nationen absah, den neugierigenBlicken derBesucher noch
in fast schmuckloser Nacktheit. Da zunächst erst einige
Dutzend Aussteller ihre Arrangements begonnen hatten,
so standen noch die unausgepackten Kisten und Kasten
in malerischer Unordnung überall herum. Vorn, in der
Kuppelhalle des Gebäudes, fand aber nichtsdestoweniger
schon die feierliche Ouverture des „Völkerwettstreites“
statt, eine im Kreise sehr zahlreich Geladener abgehaltene
Ceremonie, zu welcher auch der Oberbürgermeister von
Amsterdam, als Ehrenpräsident der Ausstellung, und der
Oberceremonienmeister der Königin-Wittwe, der hohen
Patronesse des Unternehmens, Baron du Tour van Bel-
linchave, erschienen waren. Diese Feierlichkeit, welche,
Franz von Suppe f.
Dank der Wortkargheit der beiden letztgenannten Persön-
lichkeiten, den Vorzug hatte, kaum länger als eine halbe
Stunde zu dauern, bestand in der Hauptsache aus einer
Rede des Präsidenten des Vorstandes, Herrn N. A. Kalisch.
Die Rede enthielt die bekannten Phrasen, die man bei
allen derartigen festlichen Anlässen zu hören bekommt
und gipfelte in der anmuthigen Bemerkung, dass nur
diejenigen Nationen auf die Sympathie Hollands rechnen
dürfen, die — wie besonders Frankreich und Belgien
— durch ihre umfangreiche Betheiligung an dieser
„Wereldtentoonstelling“ ihr lebhaftes Interesse für die
Hauptstadt des Landes bewiesen haben.
Das Terrain der Exposition, in deren Mitte das Hötel-
und Reisewesen steht, dehnt sich hinter dem berühmten
Rijksmuseum, das im Südwesten der Stadt liegt, aus.
Unter den Museumssälen, zur ebenen Erde, zieht sich
ein langer tunnelartiger Durchgang nach dem jenseitigen
Ausstellungsplatze hin. Dieses vorhandene Entree machte
ein monumentales Hauptportal überflüssig. Das lang-
gestreckte Gebäude der Ausstellung nimmt fast die ganze
Seite des Platzes ein; die Front wirkt sehr imposant
durch drei Triumphbögen, die als Eingänge dienen.
Plastische Gruppen stehen davor und zu beiden Seiten
der Portale erheben sich schlanke, durchbrochene Thurm-
pyramiden, die das architektonische Gepräge des alt-
holländischen Stils tragen. Ein farbiger Anstrich belebt
die reiche Holzarchitektur des Aeussern, und iiber dem
Hauptportal liest man weithin die holländischen Worte:
„Welkom“ und „Wereldtentoonstelling 1895“. Von den
plastischen Colossalgruppen stellen die mittelsten offenbar
die Schnelligkeit des modernen Verkehrs und die Lang-
samkeit früherer Zeiten vor. Im Innern des Gebäudes
entbehrt bis jetzt allein die Kuppelhalle nicht des cha-
rakteristischen Schmuckes durch Architektur und Ma-
lereien, die freilich etwas blass gerathen sind. Im Uebrigen
harrt, wie oben bemerkt. noch alles der Vollendung
durch die künstlerische Hand. Unter den leider ob-
waltenden Verhältnissen war e^ daher nur klug, die
Schaar der Gäste — die Damen waren in eleganten
Frühjahrsroben erschienen und wurden mit reizenden
Blumensträussen beschenkt — auf dem kürzesten Wega
durch die nördlich gelegene französische Abtheilung,
in der u.a.einigeCollectionen herrlichergetönterBroncen
auffielen, wieder hinaus in den sonnigen Park zu geleiten,
dessen Vegetation ebenfalls noch im frühesten Werden
begriffen ist.
Vorher hatte man schon einmal den Park betreten,
um dort vor dem offenen Musikpavillon Platz zu nehmen
und den zur Feier des Eröffnungstages componirten
Ausstellungsmarsch anzuhören; der greise
Componist, Herr Heinze, erhielt darauf als An-
erkennung einen mächtigen Kranz von Lorbeer
und Marschall Niel-Rosen . . . Später begab man
sich auf den grossen Dampfer „Prins Hendrik“,
dessen schwarzer Rumpf sich aus einem Bassin
inmitten des Terrains wie ein plumpes Ungeheuer
emporreckt. Dieser Indienfahrer, die piece de resi-
stance des an Ueberraschungen nicht armen Gan-
zen, ist mit allem neuzeitlichen Comfort, mit Speise-
sälen, Schlaf-, Lese- und Erholungsräumen, ausge-
stattet. Er wird von nun an das officifelle Empfangs-
lokal des Comite's bilden und sein ausgedehntes
Verdeck, auf dem am Eröffnungstage das Musikcorps
der Haarlemer Schütterei concertirte, wird bald den
Zwecken festlicher Tafelfreuden, bald den Bedürf-
nissen der tanzlustigen guten Gesellschaft dienst-
bar gemacht werden, wobei man als mitdienende
Geister — um so den exotischen Reiz des über-
seeischen Fahrzeuges zu erhöhen — die dunkel-
farbigen Sprossen Javas, jener bekannten colo-
aialen Milchkuh Hollands, ausersehen hat
Einen andern fesselnden Punkt der Ausstellung
bildet ein copirter alter holländischer Stadttheil.
Die Idee solcher architektonischen Huldigung, die
man , einem bestimmten interessanten Zeitabschnitt
der nationalen Geschichte darbringt, ist keines-
wegs originell. Aber hier tragen nämlich selbst
die Zimmereinrichtungen, die zum Verkauf ange-
botenen Drucksachen, die obrigkeitlichen Verfü-
gungen für die Bürgerschaft, die Musici und die
militärische Besatzung den historischen Stempel
der alten Prinz Moritz-Zeit. Am Eröffnungstage
führte im hintern Hofe ein Fähndel Landsknechte,
unter Leitung eines hiesigen Artillerie-Hauptmanns,
verschiederie militärische Exercitien genau nach
dem alten Reglement jenes oranischen Prmzen-
Statthalters aus. Die künstlerischen Entwürfe der
alten Giebelhäuser, die sich in höchst malerischer
Abwechslung zuerst um eine mit Bäumchen be-
setzte Gracht, dann um einen unregelmässigen
Platz herumziehen, stammen von dem talentvollen
Architekten der Ausstellungsgebäude, Herrn Evert,
Bremen, her.
Neben diesem reconstruirten altholländischen Stadt-
theil hat man einen „Weltbazär“ etablirt, weil im Innern
jenes Hauptgebäudes nichts verkauft und fortgeschafft
werden darf. Er besteht aus einem umfangreichen
Complex fest aneinandergefügter Buden, die nach dem
freien Platze zu durch eine Colonnadenfront verbunden
und durch einige schmale Passagen gegliedert sind.
Eine Strecke weiter verliert sich der parkartige
Charakter des Terrains. Abseits begegneten wir einem
länglichen Pavillon, in welchem eigenthümliche Maschinen
mit grossen Wiegemessern zu sehen waren; hier werden
von einer Dresdener Firma vor den Augen des Publikums
Würstehen fabricirt, die dann von jungen Mädchen gar
gekocht und (für 25 Ct. die Portion) verabreicht werden.
Dieser appetitlichen Lockung folgeri in demselben ent-
fernten Rayon verschiedene mehr oder minder respectable
Unternehmungen, welche die Schaulust des p. t.Publikums
reizen wollen und auf die wir hier begreiflicherweise
nicht näher eingehen können. Unter den vielen über
das ganze Teri'ain zerstreuten Restaurants und Cafes,
Pavillons und Kiosken, fällt besonders eine mächtige
indische P.agode auf dem Rücken eines ungeheuereri
Elephanten auf. Natürlich ist dieser Elephant künstlich
ausHolz, Mauerwerk und Leinwand hergestellt; in seinen
Beinen führen Wendeltreppen empoi'. Gegenwärtig
arbeitet man noch an der bunten Bemalung des braven
Riesenthieres, das seinen Rüssel hoch in die Lüfte streckt
und so den schwarzen Führer begrüsst, der auf seinem
Haupt, dicht vor der Restaurant-Pagode, gemächlich
Platz genommen hat.
Nach ungefähr zwei Stunden war der Rundgang der
Gäste, die unter der Sonnengluth eines der heissesten
Maitage, die ich in Amsterdam seit Jahren erlebt, schwer
IX. 20. B. 1.