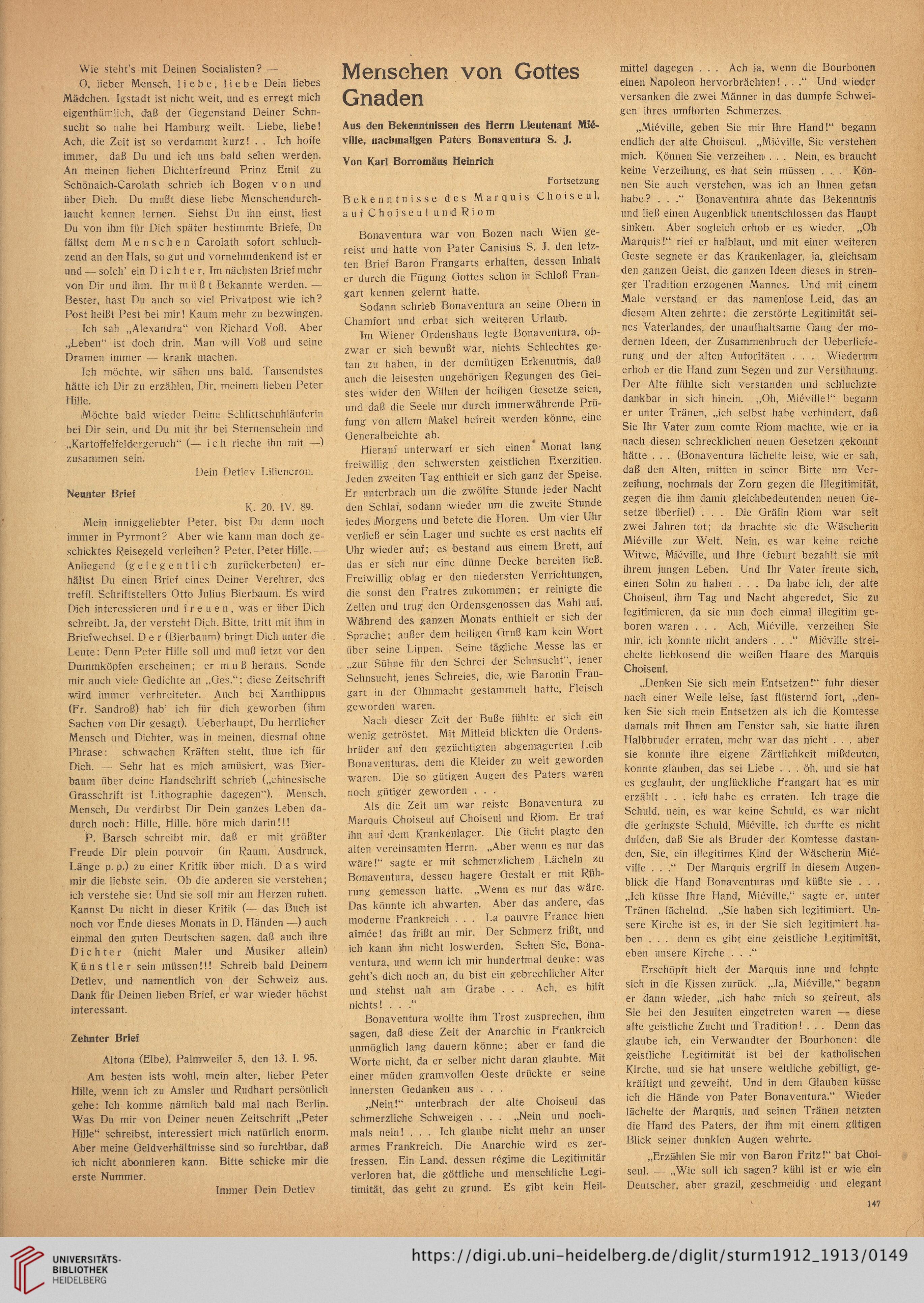Wie steht’s mit Deinen Socialisten? —
O, Heber Mensch, liebe, liebe Dein liebes
Mädchen. Igstadt ist nicht weit, und es erregt mich
eigenthümlich, daß der Gegenstand Deiner Sehn-
sucht so nahe bei Hamburg weilt. Liebe, liebe!
Ach, die Zeit ist so verdammt kurz! . . Ich hoffe
immer, daß Du und ich uns bald sehen werden.
An meinen lieben Dichterfreund Prinz Emil zu
Schönaich-Carolath schrieb ich Bogen von und
über Dich. Du mußt diese liebe Menschendurch-
laucht kennen lernen. Siehst Du ihn einst, liest
Du von ihm für Dich später bestimmte Briefe, Du
fällst dem Menschen Carolath sofort schluch-
zend an den Hals, so gut und vornehmdenkend ist er
und — solch’ ein D i c h t e r. Im nächsten Brief mehr
von Dir und ihm. Ihr müßt Bekannte werden. —
Bester, hast Du auch so viel Privatpost wie ich?
Post heißt Pest bei mir! Kaum mehr zu bezwingen.
— Ich sah ,,Alexandra“ von Richard Voß. Aber
„Leben“ ist doch drin. Man will Voß und seine
Dramen immer — krank machen.
Ich möchte, wir sähen uns bald. Tausendstes
hätte ich Dir zu erzählen, Dir. meinem lieben Peter
Hille.
Möchte bald wieder Deine Schlittschuhläuferin
bei Dir sein, und Du mit ihr bei Sternenschein und
„Kartoffelfeldergeruch“ (— ich rieche ihn mit —)
zusammen sein.
Dein Detlev Liliencron.
Neunter Brief
K. 20. IV. 89.
Mein inniggeliebter Peter, bist Du denn noch
immer in Pyrmont? Aber wie kann man doch ge-
schicktes Reisegeld verleihen? Peter, Peter Hille.—
Anliegend (gelegentlich zurückerbeten) er-
hältst Du einen Brief eines Deiner Verehrer, des
treffl. Schriftstellers Otto Julius Bierbaum. Es wird
Dich interessieren und freuen, was er über Dich
schreibt. Ja, der versteht Dich. Bitte, tritt mit ihm in
Briefwechsel. Der (Bierbaurn) bringt Dich unter die
Leute: Denn Peter Hille soll und muß jetzt vor den
Dummköpfen erscheinen; er muß heraus. Sende
mir auch viele Gedichte an „Ges.“; diese Zeitschrift
wird immer verbreiteter. Auch bei Xanthippus
(Fr. Sandroß) hab’ ich für dich geworben (ihm
Sachen von Dir gesagt). Ueberhaupt, Du herrlicher
Mensch und Dichter, was in meinen, diesmal ohne
Phrase: schwachen Kräften steht, thue ich für
Dich. — Sehr hat es mich amüsiert, was Bier-
baum über deine Handschrift schrieb („chinesische
Grasschrift ist Lithographie dagegen“). Mensch,
Mensch, Du verdirbst Dir Dein ganzes Leben da-
durch noch: Hille, Hille, höre mich darin!!!
P. Barsch schreibt mir, daß er mit größter
Freude Dir plein pouvoir (in Raum, Ausdruck,
Länge p. p.) zu einer Kritik über mich. Das wird
mir die liebste sein. Ob die anderen sie verstehen;
ich verstehe sie: Und sie soll mir am Herzen ruhen.
Kannst Du nicht in dieser Kritik (— das Buch ist
noch vor Ende dieses Monats in D. Händen —) auch
einmal den guten Deutschen sagen, daß auch ihre
Dichter (nicht Maler und Musiker allein)
Künstler sein müssen!!! Schreib bald Deinem
Detlev, und namentlich von der Schweiz aus.
Dank für Deinen lieben Brief, er war wieder höchst
interessant.
Zehnter Brief
Altona (Elbe), Palmweiler 5, den 13. I. 95.
Am besten ists wohl, mein alter, lieber Peter
Hille, wenn ich zu Amsler und Rudhart persönlich
gehe: Ich komme nämlich bald mal nach Berlin.
Was Du mir von Deiner neuen Zeitschrift „Peter
Hille“ schreibst, interessiert mich natürlich enorm.
Aber meine Geldverhältnisse sind so furchtbar, daß
ich nicht abonnieren kann. Bitte schicke mir die
erste Nummer.
Immer Dein Detlev
Menschen von Gottes
Gnaden
Aus den Bekenntnissen des Herrn Lieutenant Mi6-
ville, nachmaligen Paters Bonaventura S. J.
Von Karl Borromäus Heinrich
Fortsetzung
Bekenntnisse des Marquis Choiseul,
auf Choiseul und Riom
Bonaventura war von Bozen nach Wien ge-
reist und hatte von Pater Canisius S. J. den letz-
ten Brief Baron Frangarts erhalten, dessen Inhalt
er durch die Fügung Gottes schon in Schloß Fran-
gart kennen gelernt hatte.
Sodann schrieb Bonaventura an seine Obern in
Chamfort und erbat sich weiteren Urlaub.
Im Wiener Ordenshaus legte Bonaventura, ob-
zwar er sich bewußt war, nichts Schlechtes ge-
tan zu haben, in der demütigen Erkenntnis, daß
auch die leisesten ungehörigen Regungen des Gei-
stes wider den Willen der heiligen Gesetze seien,
und daß die Seele nur durch immerwährende Prü-
fung von allem Makel befreit werden könne, eine
Generalbeichte ab.
Hierauf unterwarf er sich einen Monat lang
freiwillig den schwersten geistlichen Exerzitien.
Jeden zweiten Tag enthielt er sich ganz der Speise.
Er unterbrach um die zwölfte Stunde jeder Nacht
den Schlaf, sodann wieder um die zweite Stunde
jedes Morgens und betete die Horen. Um vier Uhr
verließ er sein Lager und suchte es erst nachts elf
Uhr wieder auf; es bestand aus einem Brett, auf
das er sich nur eine dünne Decke bereiten ließ.
Freiwillig oblag er den niedersten Verrichtungen,
die sonst den Fratres zukommen; er reinigte die
Zellen und trug den Ordensgenossen das Mahl auf.
Während des ganzen Monats enthielt er sich der
Sprache; außer dem heiligen Gruß kam kein Wort
über seine Lippen. Seine tägliche Messe las er
„zur Sühne für den Schrei der Sehnsucht“, jener
Sehnsucht, jenes Schreies, die, wie Baronin Fran-
gart in der Ohnmacht gestammelt hatte, Fleisch
geworden waren.
Nach dieser Zeit der Buße fühlte er sich ein
wenig getröstet. Mit Mitleid blickten die Ordens-
brüder auf den gezüchtigten abgemagerten Leib
Bonaventuras, dem die Kleider zu weit geworden
waren. Die so gütigen Augen des Paters waren
noch gütiger geworden . . .
Als die Zeit um war reiste Bonaventura zu
Marquis Choiseul auf Choiseul und Riom. Er trat
ihn auf dem Krankenlager. Die Gicht plagte den
alten vereinsamten Herrn. „Aber wenn es nur das
wäre!“ sagte er mit schmerzlichem Lächeln zu
Bonaventura, dessen hagere Gestalt er mit Rüh-
rung gemessen hatte. „Wenn es nur das wäre.
Das könnte ich abwarten. Aber das andere, das
moderne Frankreich ... La pauvre France bien
aimee! das frißt an mir. Der Schmerz frißt, und
ich kann ihn nicht loswerden. Sehen Sie, Bona-
ventura, und wenn ich mir hundertmal denke: was
geht’s 'dich noch an, du bist ein gebrechlicher Alter
und stehst nah am Grabe . . . Ach. es hilft
nichts! . . .“
Bonaventura wollte ihm Trost zusprechen, ihm
sagen, daß diese Zeit der Anarchie in Frankreich
unmöglich lang dauern könne; aber er fand die
Worte nicht, da er selber nicht daran glaubte. Mit
einer müden gramvollen Geste drückte er seine
innersten Gedanken aus . . .
„Nein!“ unterbrach der alte Choiseul das
schmerzliche Schweigen . . . „Nein und noch-
mals nein! ... Ich glaube nicht mehr an unser
armes Frankreich. Die Anarchie wird es zer-
fressen. Ein Land, dessen rögime die Legitimitär
verloren hat, die göttliche und menschliche Legi-
timität, das geht zu gründ. Es gibt kein Heil-
mittel dagegen . . . Ach ja, wenn die Bourbonen
einen Napoleon hervorbrächten! . . Und wieder
versanken die zwei Männer in das dumpfe Schwei-
gen ihres umflorten Schmerzes.
„Mieville, geben Sie mir Ihre Hand!“ begann
endlich der alte Choiseul. „Mieville, Sie verstehen
mich. Können Sie verzeihen . . . Nein, es braucht
keine Verzeihung, es hat sein müssen . . . Kön-
nen Sie auch verstehen, was ich an Ihnen getan
habe? . . .“ Bonaventura ahnte das Bekenntnis
und ließ einen Augenblick unentschlossen das Haupt
sinken. Aber sogleich erhob er es wieder. „Oh
Marquis!“ rief er halblaut, und mit einer weiteren
Geste segnete er das Krankenlager, ja, gleichsam
den ganzen Geist, die ganzen Ideen dieses in stren-
ger Tradition erzogenen Mannes. Und mit einem
Male verstand er das namenlose Leid, das an
diesem Alten zehrte: die zerstörte Legitimität sei-
nes Vaterlandes, der unaufhaltsame Gang der mo-
dernen Ideen, der Zusammenbruch der Ueberliefe-
rung und der alten Autoritäten . . . Wiederum
erhob er die Hand zum Segen und zur Versühnung.
Der Alte fühlte sich verstanden und schluchzte
dankbar in sich hinein. „Oh, Mieville!“ begann
er unter Tränen, „ich selbst habe verhindert, daß'
Sie Ihr Vater zum comte Riom machte, wie er ja
nach diesen schrecklichen neuen Gesetzen gekonnt
hätte . . . (Bonaventura lächelte leise, wie er sah,
daß den Alten, mitten in seiner Bitte um Ver-
zeihung, nochmals der Zorn gegen die Illegitimität,
gegen die ihm damit gleichbedeutenden neuen Ge-
setze überfiel) . . . Die Gräfin Riom war seit
zwei Jahren tot; da brachte sie die Wäscherin
Mieville zur Welt. Nein, es war keine reiche
Witwe, Mieville, und Ihre Geburt bezahlt sie mit
ihrem jungen Leben. Und Ihr Vater freute sich,
einen Sohn zu haben ... Da habe ich, der alte
Choiseul, ihm Tag und Nacht abgeredet, Sie zu
legitimieren, da sie nun doch einmal illegitim ge-
boren Waren . . . Ach, Mieville, verzeihen Sie
mir, ich konnte nicht anders . . .“ Mieville strei-
chelte liebkosend die weißen Haare des Marquis
Choiseul.
„Denken Sie sich mein Entsetzen!“ fuhr dieser
nach einer Weile leise, fast flüsternd fort, „den-
ken Sie sich mein Entsetzen als ich die Komtesse
damals mit Ihnen am Fenster sah, sie hatte ihren
Halbbruder erraten, mehr war das nicht . . . aber
sie konnte ihre eigene Zärtlichkeit mißdeuten,
konnte glauben, das sei Liebe . . . öh, und sie hat
es geglaubt, der unglückliche Frangart hat es mir
erzählt . . . ich) habe es erraten. Ich trage die
Schuld, nein, es war keine Schuld, es war nicht
die geringste Schuld, Mieville, ich durfte es nicht
dulden, daß Sie als Bruder der Komtesse dastan-
den, Sie, ein illegitimes Kind der Wäscherin Mie-
ville . . .“ Der Marquis ergriff in diesem Augen-
blick die Hand Bonaventuras und küßte sie . . .
„Ich küsse Ihre Hand, Mieville,“ sagte er, unter
Tränen lächelnd. „Sie haben sich legitimiert. Un-
sere Kirche ist es, in der Sie sich legitimiert ha-
ben . . . denn es gibt eine geistliche Legitimität,
eben unsere Kirche . . .“
Erschöpft hielt der Marquis inne und lehnte
sich in die Kissen zurück. „Ja, Mieville,“ begann
er dann wieder, „ich habe mich so gefreut, als
Sie bei den Jesuiten eingetreten waren — diese
alte geistliche Zucht und Tradition! . . . Denn das
glaube ich, ein Verwandter der Bourbonen: die
geistliche Legitimität ist bei der katholischen
Kirche, und sie hat unsere weltliche gebilligt, ge-
kräftigt und geweiht. Und in dem Glauben küsse
ich die Hände von Pater Bonaventura.“ Wieder
lächelte der Marquis, und seinen Tränen netzten
die Hand des Paters, der ihm mit einem gütigen
Blick seiner dunklen Augen wehrte.
„Erzählen Sie mir von Baron Fritz!“ bat Choi-
seul. — „Wie soll ich sagen? kühl ist er wie ein
Deutscher, aber grazil, geschmeidig und elegant
147
O, Heber Mensch, liebe, liebe Dein liebes
Mädchen. Igstadt ist nicht weit, und es erregt mich
eigenthümlich, daß der Gegenstand Deiner Sehn-
sucht so nahe bei Hamburg weilt. Liebe, liebe!
Ach, die Zeit ist so verdammt kurz! . . Ich hoffe
immer, daß Du und ich uns bald sehen werden.
An meinen lieben Dichterfreund Prinz Emil zu
Schönaich-Carolath schrieb ich Bogen von und
über Dich. Du mußt diese liebe Menschendurch-
laucht kennen lernen. Siehst Du ihn einst, liest
Du von ihm für Dich später bestimmte Briefe, Du
fällst dem Menschen Carolath sofort schluch-
zend an den Hals, so gut und vornehmdenkend ist er
und — solch’ ein D i c h t e r. Im nächsten Brief mehr
von Dir und ihm. Ihr müßt Bekannte werden. —
Bester, hast Du auch so viel Privatpost wie ich?
Post heißt Pest bei mir! Kaum mehr zu bezwingen.
— Ich sah ,,Alexandra“ von Richard Voß. Aber
„Leben“ ist doch drin. Man will Voß und seine
Dramen immer — krank machen.
Ich möchte, wir sähen uns bald. Tausendstes
hätte ich Dir zu erzählen, Dir. meinem lieben Peter
Hille.
Möchte bald wieder Deine Schlittschuhläuferin
bei Dir sein, und Du mit ihr bei Sternenschein und
„Kartoffelfeldergeruch“ (— ich rieche ihn mit —)
zusammen sein.
Dein Detlev Liliencron.
Neunter Brief
K. 20. IV. 89.
Mein inniggeliebter Peter, bist Du denn noch
immer in Pyrmont? Aber wie kann man doch ge-
schicktes Reisegeld verleihen? Peter, Peter Hille.—
Anliegend (gelegentlich zurückerbeten) er-
hältst Du einen Brief eines Deiner Verehrer, des
treffl. Schriftstellers Otto Julius Bierbaum. Es wird
Dich interessieren und freuen, was er über Dich
schreibt. Ja, der versteht Dich. Bitte, tritt mit ihm in
Briefwechsel. Der (Bierbaurn) bringt Dich unter die
Leute: Denn Peter Hille soll und muß jetzt vor den
Dummköpfen erscheinen; er muß heraus. Sende
mir auch viele Gedichte an „Ges.“; diese Zeitschrift
wird immer verbreiteter. Auch bei Xanthippus
(Fr. Sandroß) hab’ ich für dich geworben (ihm
Sachen von Dir gesagt). Ueberhaupt, Du herrlicher
Mensch und Dichter, was in meinen, diesmal ohne
Phrase: schwachen Kräften steht, thue ich für
Dich. — Sehr hat es mich amüsiert, was Bier-
baum über deine Handschrift schrieb („chinesische
Grasschrift ist Lithographie dagegen“). Mensch,
Mensch, Du verdirbst Dir Dein ganzes Leben da-
durch noch: Hille, Hille, höre mich darin!!!
P. Barsch schreibt mir, daß er mit größter
Freude Dir plein pouvoir (in Raum, Ausdruck,
Länge p. p.) zu einer Kritik über mich. Das wird
mir die liebste sein. Ob die anderen sie verstehen;
ich verstehe sie: Und sie soll mir am Herzen ruhen.
Kannst Du nicht in dieser Kritik (— das Buch ist
noch vor Ende dieses Monats in D. Händen —) auch
einmal den guten Deutschen sagen, daß auch ihre
Dichter (nicht Maler und Musiker allein)
Künstler sein müssen!!! Schreib bald Deinem
Detlev, und namentlich von der Schweiz aus.
Dank für Deinen lieben Brief, er war wieder höchst
interessant.
Zehnter Brief
Altona (Elbe), Palmweiler 5, den 13. I. 95.
Am besten ists wohl, mein alter, lieber Peter
Hille, wenn ich zu Amsler und Rudhart persönlich
gehe: Ich komme nämlich bald mal nach Berlin.
Was Du mir von Deiner neuen Zeitschrift „Peter
Hille“ schreibst, interessiert mich natürlich enorm.
Aber meine Geldverhältnisse sind so furchtbar, daß
ich nicht abonnieren kann. Bitte schicke mir die
erste Nummer.
Immer Dein Detlev
Menschen von Gottes
Gnaden
Aus den Bekenntnissen des Herrn Lieutenant Mi6-
ville, nachmaligen Paters Bonaventura S. J.
Von Karl Borromäus Heinrich
Fortsetzung
Bekenntnisse des Marquis Choiseul,
auf Choiseul und Riom
Bonaventura war von Bozen nach Wien ge-
reist und hatte von Pater Canisius S. J. den letz-
ten Brief Baron Frangarts erhalten, dessen Inhalt
er durch die Fügung Gottes schon in Schloß Fran-
gart kennen gelernt hatte.
Sodann schrieb Bonaventura an seine Obern in
Chamfort und erbat sich weiteren Urlaub.
Im Wiener Ordenshaus legte Bonaventura, ob-
zwar er sich bewußt war, nichts Schlechtes ge-
tan zu haben, in der demütigen Erkenntnis, daß
auch die leisesten ungehörigen Regungen des Gei-
stes wider den Willen der heiligen Gesetze seien,
und daß die Seele nur durch immerwährende Prü-
fung von allem Makel befreit werden könne, eine
Generalbeichte ab.
Hierauf unterwarf er sich einen Monat lang
freiwillig den schwersten geistlichen Exerzitien.
Jeden zweiten Tag enthielt er sich ganz der Speise.
Er unterbrach um die zwölfte Stunde jeder Nacht
den Schlaf, sodann wieder um die zweite Stunde
jedes Morgens und betete die Horen. Um vier Uhr
verließ er sein Lager und suchte es erst nachts elf
Uhr wieder auf; es bestand aus einem Brett, auf
das er sich nur eine dünne Decke bereiten ließ.
Freiwillig oblag er den niedersten Verrichtungen,
die sonst den Fratres zukommen; er reinigte die
Zellen und trug den Ordensgenossen das Mahl auf.
Während des ganzen Monats enthielt er sich der
Sprache; außer dem heiligen Gruß kam kein Wort
über seine Lippen. Seine tägliche Messe las er
„zur Sühne für den Schrei der Sehnsucht“, jener
Sehnsucht, jenes Schreies, die, wie Baronin Fran-
gart in der Ohnmacht gestammelt hatte, Fleisch
geworden waren.
Nach dieser Zeit der Buße fühlte er sich ein
wenig getröstet. Mit Mitleid blickten die Ordens-
brüder auf den gezüchtigten abgemagerten Leib
Bonaventuras, dem die Kleider zu weit geworden
waren. Die so gütigen Augen des Paters waren
noch gütiger geworden . . .
Als die Zeit um war reiste Bonaventura zu
Marquis Choiseul auf Choiseul und Riom. Er trat
ihn auf dem Krankenlager. Die Gicht plagte den
alten vereinsamten Herrn. „Aber wenn es nur das
wäre!“ sagte er mit schmerzlichem Lächeln zu
Bonaventura, dessen hagere Gestalt er mit Rüh-
rung gemessen hatte. „Wenn es nur das wäre.
Das könnte ich abwarten. Aber das andere, das
moderne Frankreich ... La pauvre France bien
aimee! das frißt an mir. Der Schmerz frißt, und
ich kann ihn nicht loswerden. Sehen Sie, Bona-
ventura, und wenn ich mir hundertmal denke: was
geht’s 'dich noch an, du bist ein gebrechlicher Alter
und stehst nah am Grabe . . . Ach. es hilft
nichts! . . .“
Bonaventura wollte ihm Trost zusprechen, ihm
sagen, daß diese Zeit der Anarchie in Frankreich
unmöglich lang dauern könne; aber er fand die
Worte nicht, da er selber nicht daran glaubte. Mit
einer müden gramvollen Geste drückte er seine
innersten Gedanken aus . . .
„Nein!“ unterbrach der alte Choiseul das
schmerzliche Schweigen . . . „Nein und noch-
mals nein! ... Ich glaube nicht mehr an unser
armes Frankreich. Die Anarchie wird es zer-
fressen. Ein Land, dessen rögime die Legitimitär
verloren hat, die göttliche und menschliche Legi-
timität, das geht zu gründ. Es gibt kein Heil-
mittel dagegen . . . Ach ja, wenn die Bourbonen
einen Napoleon hervorbrächten! . . Und wieder
versanken die zwei Männer in das dumpfe Schwei-
gen ihres umflorten Schmerzes.
„Mieville, geben Sie mir Ihre Hand!“ begann
endlich der alte Choiseul. „Mieville, Sie verstehen
mich. Können Sie verzeihen . . . Nein, es braucht
keine Verzeihung, es hat sein müssen . . . Kön-
nen Sie auch verstehen, was ich an Ihnen getan
habe? . . .“ Bonaventura ahnte das Bekenntnis
und ließ einen Augenblick unentschlossen das Haupt
sinken. Aber sogleich erhob er es wieder. „Oh
Marquis!“ rief er halblaut, und mit einer weiteren
Geste segnete er das Krankenlager, ja, gleichsam
den ganzen Geist, die ganzen Ideen dieses in stren-
ger Tradition erzogenen Mannes. Und mit einem
Male verstand er das namenlose Leid, das an
diesem Alten zehrte: die zerstörte Legitimität sei-
nes Vaterlandes, der unaufhaltsame Gang der mo-
dernen Ideen, der Zusammenbruch der Ueberliefe-
rung und der alten Autoritäten . . . Wiederum
erhob er die Hand zum Segen und zur Versühnung.
Der Alte fühlte sich verstanden und schluchzte
dankbar in sich hinein. „Oh, Mieville!“ begann
er unter Tränen, „ich selbst habe verhindert, daß'
Sie Ihr Vater zum comte Riom machte, wie er ja
nach diesen schrecklichen neuen Gesetzen gekonnt
hätte . . . (Bonaventura lächelte leise, wie er sah,
daß den Alten, mitten in seiner Bitte um Ver-
zeihung, nochmals der Zorn gegen die Illegitimität,
gegen die ihm damit gleichbedeutenden neuen Ge-
setze überfiel) . . . Die Gräfin Riom war seit
zwei Jahren tot; da brachte sie die Wäscherin
Mieville zur Welt. Nein, es war keine reiche
Witwe, Mieville, und Ihre Geburt bezahlt sie mit
ihrem jungen Leben. Und Ihr Vater freute sich,
einen Sohn zu haben ... Da habe ich, der alte
Choiseul, ihm Tag und Nacht abgeredet, Sie zu
legitimieren, da sie nun doch einmal illegitim ge-
boren Waren . . . Ach, Mieville, verzeihen Sie
mir, ich konnte nicht anders . . .“ Mieville strei-
chelte liebkosend die weißen Haare des Marquis
Choiseul.
„Denken Sie sich mein Entsetzen!“ fuhr dieser
nach einer Weile leise, fast flüsternd fort, „den-
ken Sie sich mein Entsetzen als ich die Komtesse
damals mit Ihnen am Fenster sah, sie hatte ihren
Halbbruder erraten, mehr war das nicht . . . aber
sie konnte ihre eigene Zärtlichkeit mißdeuten,
konnte glauben, das sei Liebe . . . öh, und sie hat
es geglaubt, der unglückliche Frangart hat es mir
erzählt . . . ich) habe es erraten. Ich trage die
Schuld, nein, es war keine Schuld, es war nicht
die geringste Schuld, Mieville, ich durfte es nicht
dulden, daß Sie als Bruder der Komtesse dastan-
den, Sie, ein illegitimes Kind der Wäscherin Mie-
ville . . .“ Der Marquis ergriff in diesem Augen-
blick die Hand Bonaventuras und küßte sie . . .
„Ich küsse Ihre Hand, Mieville,“ sagte er, unter
Tränen lächelnd. „Sie haben sich legitimiert. Un-
sere Kirche ist es, in der Sie sich legitimiert ha-
ben . . . denn es gibt eine geistliche Legitimität,
eben unsere Kirche . . .“
Erschöpft hielt der Marquis inne und lehnte
sich in die Kissen zurück. „Ja, Mieville,“ begann
er dann wieder, „ich habe mich so gefreut, als
Sie bei den Jesuiten eingetreten waren — diese
alte geistliche Zucht und Tradition! . . . Denn das
glaube ich, ein Verwandter der Bourbonen: die
geistliche Legitimität ist bei der katholischen
Kirche, und sie hat unsere weltliche gebilligt, ge-
kräftigt und geweiht. Und in dem Glauben küsse
ich die Hände von Pater Bonaventura.“ Wieder
lächelte der Marquis, und seinen Tränen netzten
die Hand des Paters, der ihm mit einem gütigen
Blick seiner dunklen Augen wehrte.
„Erzählen Sie mir von Baron Fritz!“ bat Choi-
seul. — „Wie soll ich sagen? kühl ist er wie ein
Deutscher, aber grazil, geschmeidig und elegant
147