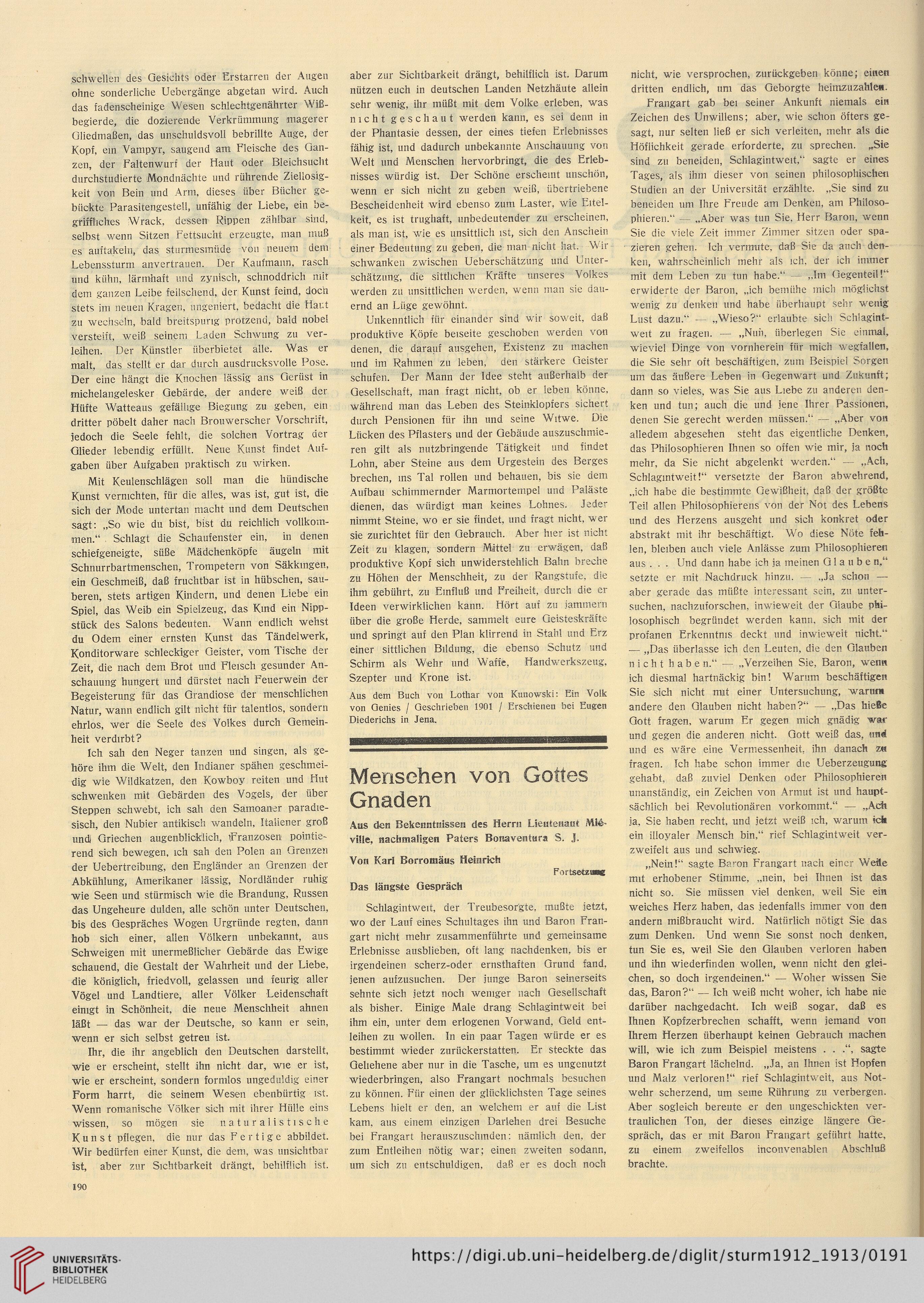schwellen des Gesichts oder Erstarren der Augen
ohne sonderliche Uebergänge abgetan wird. Auch
das fadenscheinige Wesen schlechtgenährter Wiß-
begier de, die dozierende Verkrümmung magerer
Gliedmaßen, das unschuldsvoll bebrillte Auge, der
Kopf, ein Vampyr, saugend am Fleische des Gan-
zen, der Faltenwurf der Haut oder Bleichsucht
durchstudierte Mondnächte und rührende Ziellosig-
keit von Bein und Arm, dieses über Bücher ge-
bückte Parasitengestell, unfähig der Liebe, ein be-
griffliches Wrack, dessen Rippen zählbar sind,
selbst wenn Sitzen Fettsucht erzeugte, man muß
es auftakeln, das sturmesmüde von neuem dem
Lebenssturm anvertrauen. Der Kaufmann, rasch
und kühn, lärmhaft und zynisch, schnoddrich mit
dem ganzen Leibe feilschend, der Kunst feind, doch
stets im neuen Kragen, ungeniert, bedacht die Haut
zu wechseln, bald breitspurig protzend, bald nobel
versteift, weiß seinem Laden Schwung zu ver-
leihen. Der Künstler überbietet alle. Was er
malt, das stellt er dar durch ausdrucksvolle Pose.
Der eine hängt die Knochen lässig ans Gerüst in
michelangelesker Gebärde, der andere weiß der
Hüfte Watteaus gefällige Biegung zu geben, ein
dritter pöbelt daher nach Brouwerscher Vorschrift,
jedoch die Seele fehlt, die solchen Vortrag der
Glieder lebendig erfüllt. Neue Kunst findet Auf-
gaben über Aufgaben praktisch zu wirken.
Mit Keulenschlägen soll man die hündische
Kunst vernichten, für die alles, was ist, gut ist, die
sich der Mode untertan macht und dem Deutschen
sagt: „So wie du bist, bist du reichlich vollkom-
men.“ Schlagt die Schaufenster ein, in denen
schiefgeneigte, süße Mädchenköpfe äugeln mit
Schnurrbartmenschen, Trompetern von Säkkingen,
ein Geschmeiß, daß fruchtbar ist in hübschen, sau-
beren, stets artigen Kindern, und denen Liebe ein
Spiel, das Weib ein Spielzeug, das Kind ein Nipp-
stück des Salons bedeuten. Wann endlich wehst
du Odem einer ernsten Kunst das Tändelwerk,
Konditorware schieckiger Geister, vom Tische der
Zeit, die nach dem Brot und Fleisch gesunder An-
schauung hungert und dürstet nach Feuerwein der
Begeisterung für das Grandiose der menschlichen
Natur, wann endlich gilt nicht für talentlos, sondern
ehrlos, wer die Seele des Volkes durch Gemein-
heit verdirbt?
Ich sah den Neger tanzen und singen, als ge-
höre ihm die Welt, den Indianer spähen geschmei-
dig wie Wildkatzen, den Kowboy reiten und Hut
schwenken mit Gebärden des Vogels, der über
Steppen schwebt, ich sah den Samoaner paradie-
sisch, den Nubier antikisch wandeln, Italiener groß
und Griechen augenblicklich, iFranzosen pointie-
rend sich bewegen, ich sah den Polen an Grenzen
der Uebertreibung, den Engländer an Grenzen der
Abkühlung, Amerikaner lässig, Nordländer ruhig
wie Seen und stürmisch wie die Brandung, Russen
das Ungeheure dulden, alle schön unter Deutschen,
bis des Gespräches Wogen Urgründe regten, dann
hob sich einer, allen Völkern unbekannt, aus
Schweigen mit unermeßlicher Gebärde das Ewige
schauend, die Gestalt der Wahrheit und der Liebe,
die königlich, friedvoll, gelassen und feurig aller
Vögel und Landtiere, aller Völker Leidenschaft
einigt in Schönheit, die neue Menschheit ahnen
läßt — das war der Deutsche, so kann er sein,
wenn er sich selbst getreu ist.
Ihr, die ihr angeblich den Deutschen darstellt,
wie er erscheint, stellt ihn nicht dar, wie er ist,
wie er erscheint, sondern formlos ungeduldig einer
Form harrt, die seinem Wesen ebenbürtig ist.
Wenn romanische Völker sich mit ihrer Hülle eins
wissen, so mögen sie naturalistische
Kunst pflegen, die nur das Fertige abbildet.
Wir bedürfen einer Kunst, die dem, was unsichtbar
ist, aber zur Sichtbarkeit drängt, behilflich ist.
aber zur Sichtbarkeit drängt, behilflich ist. Darum
nützen euch in deutschen Landen Netzhäute allein
sehr wenig, ihr müßt mit dem Volke erleben, was
nicht geschaut werden kann, es sei denn in
der Phantasie dessen, der eines tiefen Erlebnisses
fähig ist, und dadurch unbekannte Anschauung von
Welt und Menschen hervorbringt, die des Erleb-
nisses würdig ist. Der Schöne erscheint unschön,
wenn er sich nicht zu geben weiß, übertriebene
Bescheidenheit wird ebenso zum Laster, wie Eitel-
keit, es ist trughaft, unbedeutender zu erscheinen,
als man ist, wie es unsittlich ist, sich den Anschein
einer Bedeutung zu geben, die man nicht hat. Wir
schwanken zwischen Ueberschätzung und Unter-
schätzung, die sittlichen Kräfte unseres Volkes
werden zu unsittlichen werden, wenn man sie dau-
ernd an Lüge gewöhnt.
Unkenntlich für einander sind wir soweit, daß
produktive Köpfe beiseite geschoben werden von
denen, die darauf ausgehen, Existenz zu machen
und im Rahmen zu leben, den stärkere Geister
schufen. Der Mann der Idee steht außerhalb der
Gesellschaft, man fragt nicht, ob er leben könne,
während man das Leben des Steinklopfers sichert
durch Pensionen für ihn und seine Witwe. Die
Lücken des Pflasters und der Gebäude auszuschmie-
ren gilt als nutzbringende Tätigkeit und findet
Lohn, aber Steine aus dem Urgestein des Berges
brechen, ms Tal rollen und behauen, bis sie dem
Aufbau schimmernder Marmortempel und Paläste
dienen, das würdigt man keines Lohnes. Jeder
nimmt Steine, wo er sie findet, und fragt nicht, wer
sie zurichtet für den Gebrauch. Aber hier ist nicht
Zeit zu klagen, sondern Mittel zu erwägen, daß
produktive Kopf sich unwiderstehlich Bahn breche
zu Höhen der Menschheit, zu der Rangstufe, die
ihm gebührt, zu Einfluß und Freiheit, durch die er
Ideen verwirklichen kann. Hört auf zu jammern
über die große Herde, sammelt eure Geisteskräfte
und springt auf den Plan klirrend in Stahl und Erz
einer sittlichen Bildung, die ebenso Schutz und
Schirm als Wehr und Waffe. Handwerkszeug,
Szepter und Krone ist.
Aus dem Buch von Lothar von Kunowski: Ein Volk
von Genies / Geschrieben 1901 / Erschienen bei Eugen
Diederichs in Jena.
Menschen von Gottes
Gnaden
Aus den Bekenntnissen des Herrn Lieutenant MM-
ville, nachmaligen Paters Bonaventura S. J.
Von Kari Borromäus Heinrich
Fortsetzaac
Das längste Gespräch
Schlagintweit, der Treubesorgte, mußte jetzt,
wo der Lauf eines Schultages ihn und Baron Fran-
gart nicht mehr zusammenführte und gemeinsame
Erlebnisse ausblieben, oft lang nachdenken, bis er
irgendeinen scherz-oder ernsthaften Grund fand,
jenen aufzusuchen. Der junge Baron seinerseits
sehnte sich jetzt noch weniger nach Gesellschaft
als bisher. Einige Male drang Schlagintweit bei
ihm ein, unter dem erlogenen Vorwand, Geld ent-
leihen zu wollen. In ein paar Tagen würde er es
bestimmt wieder zurückerstatten. Er steckte das
Geliehene aber nur in die Tasche, um es ungenutzt
wiederbringen, also Frangart nochmals besuchen
zu können. Für einen der glücklichsten Tage seines
Lebens hielt er den, an welchem er auf die List
kam, aus einem einzigen Darlehen drei Besuche
bei Frangart herauszuschinden: nämlich den, der
zum Entleihen nötig war; einen zweiten sodann,
um sich zu entschuldigen, daß er es doch noch
nicht, wie versprochen, zurückgeben könne; einen
dritten endlich, um das Geborgte heimzuzahleu.
Frangart gab bei seiner Ankunft niemals ein
Zeichen des Unwillens; aber, wie schon öfters ge-
sagt, nur selten ließ er sich verleiten, mehr als die
Höflichkeit gerade erforderte, zu sprechen. „Sie
sind zu beneiden, Schlagintweit.“ sagte er eines
Tages, als ihm dieser von seinen philosophischen
Studien an der Universität erzählte. „Sie sind zu
beneiden um Ihre Freude am Denken, am Philoso-
phieren.“ — „Aber was tun Sie, Herr Baron, wenn
Sie die viele Zeit immer Zimmer sitzen oder spa-
zieren gehen. Ich vermute, daß Sie da auch den-
ken, wahrscheinlich mehr als ich. der ich immer
mit dem Leben zu tun habe.“ - „Im Gegenteil!“
erwiderte der Baron, „ich bemühe mich möglichst
wenig zu denken und habe überhaupt sehr wenig
Lust dazu.“ — „Wieso?“ erlaubte sich Schlagint-
weit zu fragen. — „Nun, überlegen Sie einmal,
wieviel Dinge von vornherein für mich wegfallen,
die Sie sehr oft beschäftigen, zum Beispiel Sorgen
um das äußere Leben in Gegenwart und Zukunft;
dann so vieles, was Sie aus Liebe zu anderen den-
ken und tun; auch die und jene Ihrer Passionen,
denen Sie gerecht werden müssen.“ — „Aber von
alledem abgesehen steht das eigentliche Denken,
das Philosophieren Ihnen so offen wie mir, ja noch
mehr, da Sie nicht abgelenkt werden.“ — „Ach,
Schlagintweit!“ versetzte der Baron abwehrend,
„ich habe die bestimmte Gewißheit, daß der größte
Teil allen Philosophierens von der Not des Lebens
und des Herzens ausgeht und sich konkret oder
abstrakt mit ihr beschäftigt. Wo diese Nöte feh-
len, bleiben auch viele Anlässe zum Philosophieren
aus . . . Und dann habe ich ja meinen Glaube n,“
setzte er mit Nachdruck hinzu. — „Ja schon —
aber gerade das müßte interessant sein, zu unter-
suchen, nachzuforschen, inwieweit der Glaube phi-
losophisch begründet werden kann, sich mit der
profanen Erkenntnis deckt und inwieweit nicht.“
— „Das überlasse ich den Leuten, die den Glauben
nicht haben.“ — „Verzeihen Sie, Baron, wenn
ich diesmal hartnäckig bin! Warum beschäftigen
Sie sich nicht mit einer Untersuchung, warum
andere den Glauben nicht haben?“ — „Das hieße
Gott fragen, warum Er gegen mich gnädig war
und gegen die anderen nicht. Gott weiß das, und
und es wäre eine Vermessenheit, ihn danach z«
fragen. Ich habe schon immer die Ueberzeugung
gehabt, daß zuviel Denken oder Philosophieren
unanständig, ein Zeichen von Armut ist und haupt-
sächlich bei Revolutionären vorkommt.“ — „Ach
ja, Sie haben recht, und jetzt weiß ich, warum ich
ein illoyaler Mensch bin,“ rief Schlagintweit ver-
zweifelt aus und schwieg.
„Nein!“ sagte Baron Frangart nach einer Weile
mit erhobener Stimme, „nein, bei Ihnen ist das
nicht so. Sie müssen viel denken, weil Sie ein
weiches Herz haben, das jedenfalls immer von den
andern mißbraucht wird. Natürlich nötigt Sie das
zum Denken. Und wenn Sie sonst noch denken,
tun Sie es, weil Sie den Glauben verloren haben
und ihn wiederfinden wollen, wenn nicht den glei-
chen, so doch irgendeinen.“ — Woher wissen Sie
das, Baron?“ — Ich weiß nicht woher, ich habe nie
darüber nachgedacht. Ich weiß sogar, daß es
Ihnen Kopfzerbrechen schafft, wenn jemand von
Ihrem Herzen überhaupt keinen Gebrauch machen
will, wie ich zum Beispiel meistens . . .“, sagte
Baron Frangart lächelnd. „Ja, an Ihnen ist Hopfen
und Malz verloren!“ rief Schlagintweit, aus Not-
wehr scherzend, um seine Rührung zu verbergen.
Aber sogleich bereute er den ungeschickten ver-
traulichen Ton, der dieses einzige längere Ge-
spräch, das er mit Baron Frangart geführt hatte,
zu einem zweifellos inconvenablen Abschluß
brachte.
190
ohne sonderliche Uebergänge abgetan wird. Auch
das fadenscheinige Wesen schlechtgenährter Wiß-
begier de, die dozierende Verkrümmung magerer
Gliedmaßen, das unschuldsvoll bebrillte Auge, der
Kopf, ein Vampyr, saugend am Fleische des Gan-
zen, der Faltenwurf der Haut oder Bleichsucht
durchstudierte Mondnächte und rührende Ziellosig-
keit von Bein und Arm, dieses über Bücher ge-
bückte Parasitengestell, unfähig der Liebe, ein be-
griffliches Wrack, dessen Rippen zählbar sind,
selbst wenn Sitzen Fettsucht erzeugte, man muß
es auftakeln, das sturmesmüde von neuem dem
Lebenssturm anvertrauen. Der Kaufmann, rasch
und kühn, lärmhaft und zynisch, schnoddrich mit
dem ganzen Leibe feilschend, der Kunst feind, doch
stets im neuen Kragen, ungeniert, bedacht die Haut
zu wechseln, bald breitspurig protzend, bald nobel
versteift, weiß seinem Laden Schwung zu ver-
leihen. Der Künstler überbietet alle. Was er
malt, das stellt er dar durch ausdrucksvolle Pose.
Der eine hängt die Knochen lässig ans Gerüst in
michelangelesker Gebärde, der andere weiß der
Hüfte Watteaus gefällige Biegung zu geben, ein
dritter pöbelt daher nach Brouwerscher Vorschrift,
jedoch die Seele fehlt, die solchen Vortrag der
Glieder lebendig erfüllt. Neue Kunst findet Auf-
gaben über Aufgaben praktisch zu wirken.
Mit Keulenschlägen soll man die hündische
Kunst vernichten, für die alles, was ist, gut ist, die
sich der Mode untertan macht und dem Deutschen
sagt: „So wie du bist, bist du reichlich vollkom-
men.“ Schlagt die Schaufenster ein, in denen
schiefgeneigte, süße Mädchenköpfe äugeln mit
Schnurrbartmenschen, Trompetern von Säkkingen,
ein Geschmeiß, daß fruchtbar ist in hübschen, sau-
beren, stets artigen Kindern, und denen Liebe ein
Spiel, das Weib ein Spielzeug, das Kind ein Nipp-
stück des Salons bedeuten. Wann endlich wehst
du Odem einer ernsten Kunst das Tändelwerk,
Konditorware schieckiger Geister, vom Tische der
Zeit, die nach dem Brot und Fleisch gesunder An-
schauung hungert und dürstet nach Feuerwein der
Begeisterung für das Grandiose der menschlichen
Natur, wann endlich gilt nicht für talentlos, sondern
ehrlos, wer die Seele des Volkes durch Gemein-
heit verdirbt?
Ich sah den Neger tanzen und singen, als ge-
höre ihm die Welt, den Indianer spähen geschmei-
dig wie Wildkatzen, den Kowboy reiten und Hut
schwenken mit Gebärden des Vogels, der über
Steppen schwebt, ich sah den Samoaner paradie-
sisch, den Nubier antikisch wandeln, Italiener groß
und Griechen augenblicklich, iFranzosen pointie-
rend sich bewegen, ich sah den Polen an Grenzen
der Uebertreibung, den Engländer an Grenzen der
Abkühlung, Amerikaner lässig, Nordländer ruhig
wie Seen und stürmisch wie die Brandung, Russen
das Ungeheure dulden, alle schön unter Deutschen,
bis des Gespräches Wogen Urgründe regten, dann
hob sich einer, allen Völkern unbekannt, aus
Schweigen mit unermeßlicher Gebärde das Ewige
schauend, die Gestalt der Wahrheit und der Liebe,
die königlich, friedvoll, gelassen und feurig aller
Vögel und Landtiere, aller Völker Leidenschaft
einigt in Schönheit, die neue Menschheit ahnen
läßt — das war der Deutsche, so kann er sein,
wenn er sich selbst getreu ist.
Ihr, die ihr angeblich den Deutschen darstellt,
wie er erscheint, stellt ihn nicht dar, wie er ist,
wie er erscheint, sondern formlos ungeduldig einer
Form harrt, die seinem Wesen ebenbürtig ist.
Wenn romanische Völker sich mit ihrer Hülle eins
wissen, so mögen sie naturalistische
Kunst pflegen, die nur das Fertige abbildet.
Wir bedürfen einer Kunst, die dem, was unsichtbar
ist, aber zur Sichtbarkeit drängt, behilflich ist.
aber zur Sichtbarkeit drängt, behilflich ist. Darum
nützen euch in deutschen Landen Netzhäute allein
sehr wenig, ihr müßt mit dem Volke erleben, was
nicht geschaut werden kann, es sei denn in
der Phantasie dessen, der eines tiefen Erlebnisses
fähig ist, und dadurch unbekannte Anschauung von
Welt und Menschen hervorbringt, die des Erleb-
nisses würdig ist. Der Schöne erscheint unschön,
wenn er sich nicht zu geben weiß, übertriebene
Bescheidenheit wird ebenso zum Laster, wie Eitel-
keit, es ist trughaft, unbedeutender zu erscheinen,
als man ist, wie es unsittlich ist, sich den Anschein
einer Bedeutung zu geben, die man nicht hat. Wir
schwanken zwischen Ueberschätzung und Unter-
schätzung, die sittlichen Kräfte unseres Volkes
werden zu unsittlichen werden, wenn man sie dau-
ernd an Lüge gewöhnt.
Unkenntlich für einander sind wir soweit, daß
produktive Köpfe beiseite geschoben werden von
denen, die darauf ausgehen, Existenz zu machen
und im Rahmen zu leben, den stärkere Geister
schufen. Der Mann der Idee steht außerhalb der
Gesellschaft, man fragt nicht, ob er leben könne,
während man das Leben des Steinklopfers sichert
durch Pensionen für ihn und seine Witwe. Die
Lücken des Pflasters und der Gebäude auszuschmie-
ren gilt als nutzbringende Tätigkeit und findet
Lohn, aber Steine aus dem Urgestein des Berges
brechen, ms Tal rollen und behauen, bis sie dem
Aufbau schimmernder Marmortempel und Paläste
dienen, das würdigt man keines Lohnes. Jeder
nimmt Steine, wo er sie findet, und fragt nicht, wer
sie zurichtet für den Gebrauch. Aber hier ist nicht
Zeit zu klagen, sondern Mittel zu erwägen, daß
produktive Kopf sich unwiderstehlich Bahn breche
zu Höhen der Menschheit, zu der Rangstufe, die
ihm gebührt, zu Einfluß und Freiheit, durch die er
Ideen verwirklichen kann. Hört auf zu jammern
über die große Herde, sammelt eure Geisteskräfte
und springt auf den Plan klirrend in Stahl und Erz
einer sittlichen Bildung, die ebenso Schutz und
Schirm als Wehr und Waffe. Handwerkszeug,
Szepter und Krone ist.
Aus dem Buch von Lothar von Kunowski: Ein Volk
von Genies / Geschrieben 1901 / Erschienen bei Eugen
Diederichs in Jena.
Menschen von Gottes
Gnaden
Aus den Bekenntnissen des Herrn Lieutenant MM-
ville, nachmaligen Paters Bonaventura S. J.
Von Kari Borromäus Heinrich
Fortsetzaac
Das längste Gespräch
Schlagintweit, der Treubesorgte, mußte jetzt,
wo der Lauf eines Schultages ihn und Baron Fran-
gart nicht mehr zusammenführte und gemeinsame
Erlebnisse ausblieben, oft lang nachdenken, bis er
irgendeinen scherz-oder ernsthaften Grund fand,
jenen aufzusuchen. Der junge Baron seinerseits
sehnte sich jetzt noch weniger nach Gesellschaft
als bisher. Einige Male drang Schlagintweit bei
ihm ein, unter dem erlogenen Vorwand, Geld ent-
leihen zu wollen. In ein paar Tagen würde er es
bestimmt wieder zurückerstatten. Er steckte das
Geliehene aber nur in die Tasche, um es ungenutzt
wiederbringen, also Frangart nochmals besuchen
zu können. Für einen der glücklichsten Tage seines
Lebens hielt er den, an welchem er auf die List
kam, aus einem einzigen Darlehen drei Besuche
bei Frangart herauszuschinden: nämlich den, der
zum Entleihen nötig war; einen zweiten sodann,
um sich zu entschuldigen, daß er es doch noch
nicht, wie versprochen, zurückgeben könne; einen
dritten endlich, um das Geborgte heimzuzahleu.
Frangart gab bei seiner Ankunft niemals ein
Zeichen des Unwillens; aber, wie schon öfters ge-
sagt, nur selten ließ er sich verleiten, mehr als die
Höflichkeit gerade erforderte, zu sprechen. „Sie
sind zu beneiden, Schlagintweit.“ sagte er eines
Tages, als ihm dieser von seinen philosophischen
Studien an der Universität erzählte. „Sie sind zu
beneiden um Ihre Freude am Denken, am Philoso-
phieren.“ — „Aber was tun Sie, Herr Baron, wenn
Sie die viele Zeit immer Zimmer sitzen oder spa-
zieren gehen. Ich vermute, daß Sie da auch den-
ken, wahrscheinlich mehr als ich. der ich immer
mit dem Leben zu tun habe.“ - „Im Gegenteil!“
erwiderte der Baron, „ich bemühe mich möglichst
wenig zu denken und habe überhaupt sehr wenig
Lust dazu.“ — „Wieso?“ erlaubte sich Schlagint-
weit zu fragen. — „Nun, überlegen Sie einmal,
wieviel Dinge von vornherein für mich wegfallen,
die Sie sehr oft beschäftigen, zum Beispiel Sorgen
um das äußere Leben in Gegenwart und Zukunft;
dann so vieles, was Sie aus Liebe zu anderen den-
ken und tun; auch die und jene Ihrer Passionen,
denen Sie gerecht werden müssen.“ — „Aber von
alledem abgesehen steht das eigentliche Denken,
das Philosophieren Ihnen so offen wie mir, ja noch
mehr, da Sie nicht abgelenkt werden.“ — „Ach,
Schlagintweit!“ versetzte der Baron abwehrend,
„ich habe die bestimmte Gewißheit, daß der größte
Teil allen Philosophierens von der Not des Lebens
und des Herzens ausgeht und sich konkret oder
abstrakt mit ihr beschäftigt. Wo diese Nöte feh-
len, bleiben auch viele Anlässe zum Philosophieren
aus . . . Und dann habe ich ja meinen Glaube n,“
setzte er mit Nachdruck hinzu. — „Ja schon —
aber gerade das müßte interessant sein, zu unter-
suchen, nachzuforschen, inwieweit der Glaube phi-
losophisch begründet werden kann, sich mit der
profanen Erkenntnis deckt und inwieweit nicht.“
— „Das überlasse ich den Leuten, die den Glauben
nicht haben.“ — „Verzeihen Sie, Baron, wenn
ich diesmal hartnäckig bin! Warum beschäftigen
Sie sich nicht mit einer Untersuchung, warum
andere den Glauben nicht haben?“ — „Das hieße
Gott fragen, warum Er gegen mich gnädig war
und gegen die anderen nicht. Gott weiß das, und
und es wäre eine Vermessenheit, ihn danach z«
fragen. Ich habe schon immer die Ueberzeugung
gehabt, daß zuviel Denken oder Philosophieren
unanständig, ein Zeichen von Armut ist und haupt-
sächlich bei Revolutionären vorkommt.“ — „Ach
ja, Sie haben recht, und jetzt weiß ich, warum ich
ein illoyaler Mensch bin,“ rief Schlagintweit ver-
zweifelt aus und schwieg.
„Nein!“ sagte Baron Frangart nach einer Weile
mit erhobener Stimme, „nein, bei Ihnen ist das
nicht so. Sie müssen viel denken, weil Sie ein
weiches Herz haben, das jedenfalls immer von den
andern mißbraucht wird. Natürlich nötigt Sie das
zum Denken. Und wenn Sie sonst noch denken,
tun Sie es, weil Sie den Glauben verloren haben
und ihn wiederfinden wollen, wenn nicht den glei-
chen, so doch irgendeinen.“ — Woher wissen Sie
das, Baron?“ — Ich weiß nicht woher, ich habe nie
darüber nachgedacht. Ich weiß sogar, daß es
Ihnen Kopfzerbrechen schafft, wenn jemand von
Ihrem Herzen überhaupt keinen Gebrauch machen
will, wie ich zum Beispiel meistens . . .“, sagte
Baron Frangart lächelnd. „Ja, an Ihnen ist Hopfen
und Malz verloren!“ rief Schlagintweit, aus Not-
wehr scherzend, um seine Rührung zu verbergen.
Aber sogleich bereute er den ungeschickten ver-
traulichen Ton, der dieses einzige längere Ge-
spräch, das er mit Baron Frangart geführt hatte,
zu einem zweifellos inconvenablen Abschluß
brachte.
190