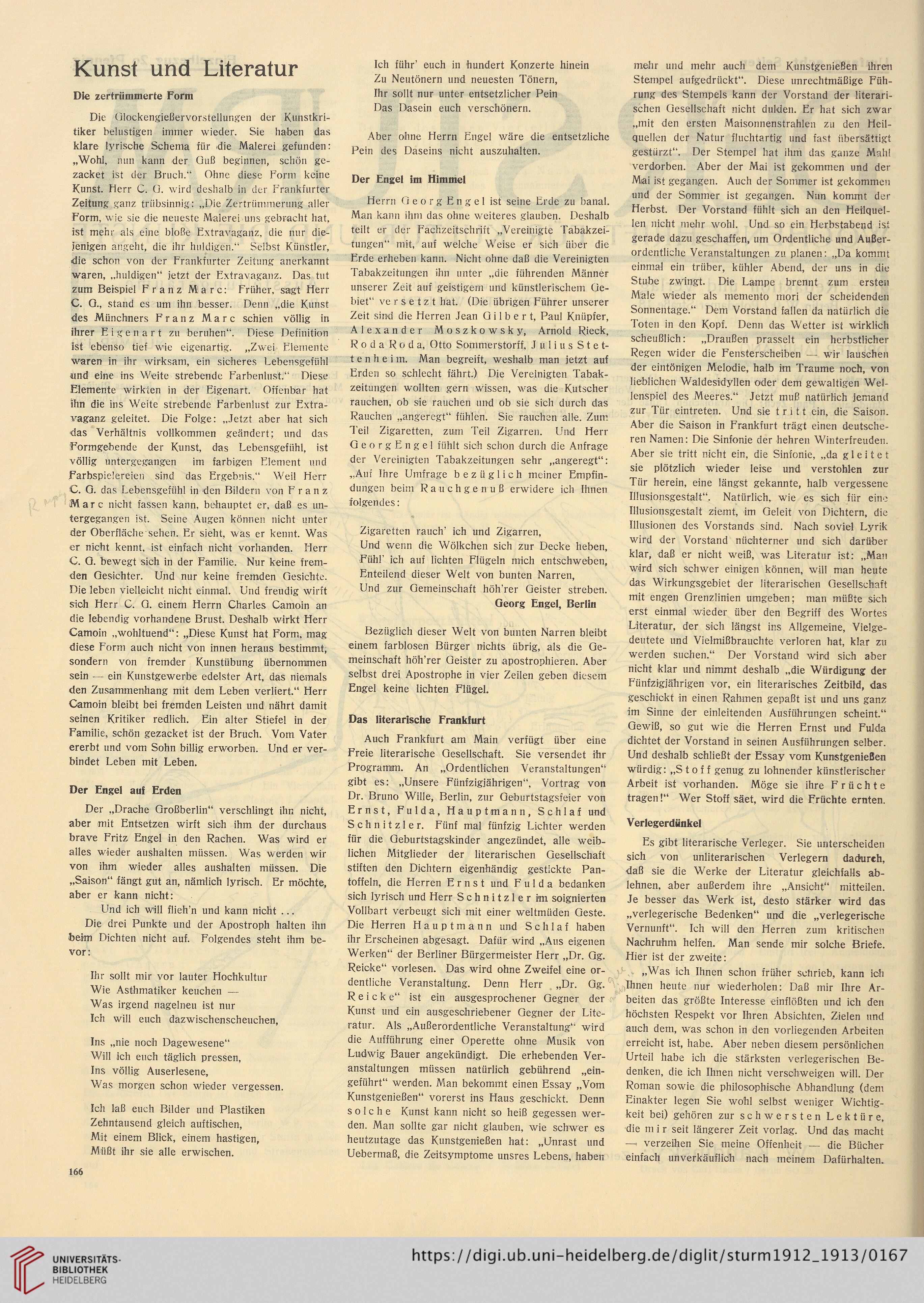Kunst und Literatur
Die zertrümmerte Form
Die Glockengießervorstellungen der Kunstkri-
tiker belustigen immer wieder. Sie haben das
klare lyrische Schema für die Malerei gefunden:
„Wohl, mm kann der Guß beginnen, schön ge-
zacket ist der Bruch.“ Ohne diese Form keine
Kunst. Herr C. G. wird deshalb in der Frankfurter
Zeitung ganz trübsinnig: „Die Zertrümmerung aller
Form, wie sie die neueste Malerei uns gebracht hat,
ist mehr als eine bloße Extravaganz, die nur die-
jenigen angeht, die ihr huldigen.“ Selbst Künstler,
die schon von der Frankfurter Zeitung anerkannt
waren, „huldigen“ jetzt der Extravaganz. Das tut
zum Beispiel Franz Mlarc: Früher, sagt Herr
C. G., stand es um ihn besser. Denn „die Kunst
des Münchners Franz Marc schien völlig in
ihrer Eigenart zu beruhen“. Diese Definition
ist ebenso tief wie eigenartig. „Zwei Elemente
waren in ihr wirksam, ein sicheres Lebensgefühl
und eine ins Weite strebende Farbenlust.“ Diese
Elemente wirkten in der Eigenart. Offenbar hat
ihn die ins Weite strebende Farbenhist zur Extra-
vaganz geleitet. Die Folge: „Jetzt aber hat sich
■das Verhältnis vollkommen geändert; und das
Formgebende der Kunst, das Lebensgefühl, ist
völlig untergegangen im farbigen Element und
Farbspielereien sind das Ergebnis.“ Weil Herr
C. G. das Lebensgefühl in den Bildern von Franz
Marc nicht fassen kann, behauptet er. daß es un-
tergegangen ist. Seine Augen können nicht unter
der Oberfläche sehen. Er sieht, was er kennt. Was
er nicht kennt, ist einfach nicht vorhanden. Herr
C. G. bewegt sich in der Familie. Nur keine frem-
den Gesichter. Und nur keine fremden Gesichte.
Die leben vielleicht nicht einmal. Und freudig wirft
sich Herr C. G. einem Herrn Charles Camoin an
die lebendig vorhandene Brust. Deshalb wirkt Herr
Camoin „wohltuend“: „Diese Kunst hat Form, mag
diese Form auch nicht von innen heraus bestimmt,
sondern von fremder Kunstübung übernommen
sein — ein Kunstgewerbe edelster Art, das niemals
den Zusammenhang mit dem Leben verliert.“ Herr
Camoin bleibt bei fremden Leisten und nährt damit
seinen Kritiker redlich. Ein alter Stiefel in der
Familie, schön gezacket ist der Bruch. Vom Vater
ererbt und vom Sohn billig erworben. Und er ver-
bindet Leben mit Leben.
Der Engel auf Erden
Der „Drache Großberlin“ verschlingt ihn nicht,
aber mit Entsetzen wirft sich ihm der durchaus
brave Fritz Engel in den Rachen. Was wind er
alles wieder aushalten müssen. Was werden wir
von ihm wieder alles aushalten müssen. Die
„Saison“ fängt gut an, nämlich lyrisch. Er möchte,
aber er kann nicht:
Und ich will flieh’n und kann nicht ...
Die drei Punkte und der Apostroph halten ihn
beim Dichten nicht auf. Folgendes steht ihm be-
vor:
Ihr sollt mir vor lauter Hochkultur
Wie Asthmatiker keuchen —
Was irgend nagelneu ist nur
Ich will euch dazwischenscheuchen,
Ins „nie noch Dagewesene“
Will ich euch täglich pressen,
Ins völlig Auserlesene,
Was morgen schon wieder vergessen.
Ich laß euch Bilder und Plastiken
Zehntausend gleich auftischen,
Mit einem Blick, einem hastigen,
Müßt ihr sie alle erwischen.
Ich führ’ euch in hundert Konzerte hinein
Zu Neutönern und neuesten Tönern,
Ihr sollt nur unter entsetzlicher Pein
Das Dasein euch verschönern.
Aber ohne Herrn Engel wäre die entsetzliche
Pein des Daseins nicht auszuhalten.
Der Engel im Himmel
Herrn G e o r g E n g e 1 ist seine Erde zu banal.
Man kann ihm das ohne weiteres glauben. Deshalb
teilt er der Fachzeitschrift „Vereinigte Tabakzei-
tungen“ mit, auf welche Weise er sich über die
Erde erheben kann. Nicht ohne daß die Vereinigten
Tabakzeitungen ihn unter „die führenden Männer
unserer Zeit auf geistigem und künstlerischem Ge-
biet“ ve r s e t z t hat. (Die übrigen Führer unserer
Zeit sind die Herren Jean Gilbert, Paul Knüpfer,
Alexander M o s z k o w s k y, Arnold Rieck,
Roda Roda, Otto Sommerstorff. JuliusStet-
t e n h e i m. Man begreift, weshalb man jetzt auf
Erden so schlecht fährt.) Die Vereinigten Tabak-
zeitungen wollten gern wissen, was die Kutscher
rauchen, ob sie rauchen und ob sie sich durch das
Rauchen „angeregt“ fühlen. Sie rauchen alle. Zum
Teil Zigaretten, zum Teil Zigarren. Und Herr
G e o r g E n g e 1 fühlt sich schon durch die Anfrage
der Vereinigten Tabakzeitungen sehr „angeregt“:
„Auf Ihre Umfrage bezüglich meiner Empfin-
dungen beim R a u c h g e n u ß erwidere ich Ihnen
folgendes:
Zigaretten rauch’ ich und Zigarren,
Und wenn die Wölkchen sich zur Decke heben,
Fühl' ich auf lichten Flügeln mich entschweben,
Enteilend dieser Welt von bunten Narren,
Und zur Gemeinschaft höh’rer Geister streben.
Georg Engel, Berlin
Bezüglich dieser Welt von bunten Narren bleibt
einem farblosen Bürger nichts übrig, als die Ge-
meinschaft höh’rer Geister zu apostrophieren. Aber
selbst drei Apostrophe in vier Zeilen geben diesem
Engel keine lichten Flügel.
Das literarische Frankfurt
Auch Frankfurt am Main verfügt über eine
Freie literarische Gesellschaft. Sie versendet ihr
Programm. An „Ordentlichen Veranstaltungen“
gibt es: „Unsere Fünfzigjährigen“, Vortrag von
Dr. Bruno Wille, Berlin, zur Geburtstagsfeier von
Ernst, Fulda, Hauptmann, Schlaf und
Schnitzler. Fünf mal fünfzig Lichter werden
für die Geburtstagskinder angezündet, alle weib-
lichen Mitglieder der literarischen Gesellschaft
stiften den Dichtern eigenhändig gestickte Pan-
toffeln, die Herren Ernst und Fulda bedanken
sich lyrisch und Herr Schnitzler im soignierten
Vollbart verbeugt sich mit einer weltmüden Geste.
Die Herren Hauptmann und Schlaf haben
ihr Erscheinen abgesagt. Dafür wind „Aus eigenen
Werken“ der Berliner Bürgermeister Herr „Dr. Gg.
Reicke“ vorlesen. Das wind ohne Zweifel eine or-
dentliche Veranstaltung. Denn Herr „Dr. Gg.
Reicke“ ist ein ausgesprochener Gegner der
Kunst und ein ausgeschriebener Gegner der Lite-
ratur. Als „Außerordentliche Veranstaltung“ wird
die Aufführung einer Operette ohne Musik von
Ludwig Bauer angekündigt. Die erhebenden Ver-
anstaltungen müssen natürlich gebührend „ein-
geführt“ werden. Man bekommt einen Essay „Vom
Kunstgenießen“ vorerst ins Haus geschickt. Denn
solche Kunst kann nicht so heiß gegessen wer-
den. Man sollte gar nicht glauben, wie schwer es
heutzutage das Kunstgenießen hat: „Unrast und
Uebermaß, die Zeitsymptome unsres Lebens, haben
mein und mehr auch dem Kunstgenießen ihren
Stempel aufgedrückt“. Diese unrechtmäßige Füh-
rung des Stempels kann der Vorstand der literari-
schen Gesellschaft nicht dulden. Er hat sich zwar
„mit den ersten Maisonnenstrahlen zu den Heil-
quellen der Natur fluchtartig und fast übersättigt
gestürzt“. Der Stempel hat ihm das ganze Mahl
verdorben. Aber der Mai ist gekommen und der
Mai ist gegangen. Auch der Sommer ist gekommen
und der Sommer ist gegangen. Nun kommt der
Herbst. Der Vorstand fühlt sich an den Heilquel-
len nicht mehr wohl. Und so ein Herbstabend ist
gerade dazu geschaffen, um Ordentliche und Außer-
ordentliche Veranstaltungen zu planen: „Da kommt
einmal ein trüber, kühler Abend, der uns in die
Stube zwingt. Die Lampe brennt zum ersten
Male wieder als memento mori der scheidenden
Sonnentage.“ Dem Vorstand fallen da natürlich die
Toten in den Kopf. Denn das Wetter ist wirklich
scheußlich: „Draußen prasselt ein herbstlicher
Regen wider die Fensterscheiben — wir lauschen
der eintönigen Melodie, halb im Traume noch, von
lieblichen Waldesidyllen oder dem gewaltigen Wel-
lenspiel des Meeres.“ Jetzt muß natürlich jemand
zur Tür eintreten. Und sie tritt ein, die Saison.
Aber die Saison in Frankfurt trägt einen deutsche-
ren Namen: Die Sinfonie der hehren Winterfreuden.
Aber sie tritt nicht ein, die Sinfonie, „da gleitet
sie plötzlich wieder leise und verstohlen zur
Tür herein, eine längst gekannte, halb vergessene
Illusionsgestalt“. Natürlich, wie es sich für eine
Illusionsgestalt ziemt, im Geleit von Dichtern, die
Illusionen des Vorstands sind. Nach soviel Lyrik
wird der Vorstand nüchterner und sich darüber
klar, daß er nicht weiß, was Literatur ist: „Man
wird sich schwer einigen können, will man heute
das Wirkungsgebiet der literarischen Gesellschaft
mit engen Grenzlinien umgeben; man müßte sich
erst einmal wieder über den Begriff des Wortes
Literatur, der sich längst ins Allgemeine, Vielge-
deutete und Vielmißbrauchte verloren hat, klar zu
werden suchen.“ Der Vorstand wird sich aber
nicht klar und nimmt deshalb „die Würdigung der
Fünfzigjährigen vor, ein literarisches Zeitbild, das
geschickt in einen Rahmen gepaßt ist und uns ganz
im Sinne der einleitenden Ausführungen scheint.“
Gewiß, so gut wie die Herren Ernst und Fulda
dichtet der Vorstand in seinen Ausführungen selber.
Und deshalb schließt der Essay vom Kunstgenießen
würdig: „Stoff genug zu lohnender künstlerischer
Arbeit ist vorhanden. Möge sie ihre Früchte
tragen!“ Wer Stoff säet, wird die Früchte ernten.
Verlegerdünkel
Es gibt literarische Verleger. Sie unterscheiden
sich von unliterarischen Verlegern dadurch,
daß sie die Werke der Literatur gleichfalls ab-
lehnen, aber außerdem ihre „Ansicht“ mitteilen.
Je besser das Werk ist, desto stärker wird das
„verlegerische Bedenken“ und die „verlegerische
Vernunft“. Ich will den Herren zum kritischen
Nachruhm helfen. Man sende mir solche Briefe.
Hier ist der zweite:
„Was ich Ihnen schon früher schrieb, kann ich
Ihnen heute nur wiederholen: Daß mir Ihre Ar-
beiten das größte Interesse einflößten und ich den
höchsten Respekt vor Ihren Absichten. Zielen und
auch dem, was schon in den vorliegenden Arbeiten
erreicht ist, habe. Aber neben diesem persönlichen
Urteil habe ich die stärksten verlegerischen Be-
denken, die ich Ihnen nicht verschweigen will. Der
Roman sowie die philosophische Abhandlung (dem
Einakter legen Sie wohl selbst weniger Wichtig-
keit bei) gehören zur schwersten Lektüre,
die m i r seit längerer Zeit vorlag. Und das macht
—r verzeihen Sie meine Offenheit — die Bücher
einfach unverkäuflich nach meinem Dafürhalten.
166
Die zertrümmerte Form
Die Glockengießervorstellungen der Kunstkri-
tiker belustigen immer wieder. Sie haben das
klare lyrische Schema für die Malerei gefunden:
„Wohl, mm kann der Guß beginnen, schön ge-
zacket ist der Bruch.“ Ohne diese Form keine
Kunst. Herr C. G. wird deshalb in der Frankfurter
Zeitung ganz trübsinnig: „Die Zertrümmerung aller
Form, wie sie die neueste Malerei uns gebracht hat,
ist mehr als eine bloße Extravaganz, die nur die-
jenigen angeht, die ihr huldigen.“ Selbst Künstler,
die schon von der Frankfurter Zeitung anerkannt
waren, „huldigen“ jetzt der Extravaganz. Das tut
zum Beispiel Franz Mlarc: Früher, sagt Herr
C. G., stand es um ihn besser. Denn „die Kunst
des Münchners Franz Marc schien völlig in
ihrer Eigenart zu beruhen“. Diese Definition
ist ebenso tief wie eigenartig. „Zwei Elemente
waren in ihr wirksam, ein sicheres Lebensgefühl
und eine ins Weite strebende Farbenlust.“ Diese
Elemente wirkten in der Eigenart. Offenbar hat
ihn die ins Weite strebende Farbenhist zur Extra-
vaganz geleitet. Die Folge: „Jetzt aber hat sich
■das Verhältnis vollkommen geändert; und das
Formgebende der Kunst, das Lebensgefühl, ist
völlig untergegangen im farbigen Element und
Farbspielereien sind das Ergebnis.“ Weil Herr
C. G. das Lebensgefühl in den Bildern von Franz
Marc nicht fassen kann, behauptet er. daß es un-
tergegangen ist. Seine Augen können nicht unter
der Oberfläche sehen. Er sieht, was er kennt. Was
er nicht kennt, ist einfach nicht vorhanden. Herr
C. G. bewegt sich in der Familie. Nur keine frem-
den Gesichter. Und nur keine fremden Gesichte.
Die leben vielleicht nicht einmal. Und freudig wirft
sich Herr C. G. einem Herrn Charles Camoin an
die lebendig vorhandene Brust. Deshalb wirkt Herr
Camoin „wohltuend“: „Diese Kunst hat Form, mag
diese Form auch nicht von innen heraus bestimmt,
sondern von fremder Kunstübung übernommen
sein — ein Kunstgewerbe edelster Art, das niemals
den Zusammenhang mit dem Leben verliert.“ Herr
Camoin bleibt bei fremden Leisten und nährt damit
seinen Kritiker redlich. Ein alter Stiefel in der
Familie, schön gezacket ist der Bruch. Vom Vater
ererbt und vom Sohn billig erworben. Und er ver-
bindet Leben mit Leben.
Der Engel auf Erden
Der „Drache Großberlin“ verschlingt ihn nicht,
aber mit Entsetzen wirft sich ihm der durchaus
brave Fritz Engel in den Rachen. Was wind er
alles wieder aushalten müssen. Was werden wir
von ihm wieder alles aushalten müssen. Die
„Saison“ fängt gut an, nämlich lyrisch. Er möchte,
aber er kann nicht:
Und ich will flieh’n und kann nicht ...
Die drei Punkte und der Apostroph halten ihn
beim Dichten nicht auf. Folgendes steht ihm be-
vor:
Ihr sollt mir vor lauter Hochkultur
Wie Asthmatiker keuchen —
Was irgend nagelneu ist nur
Ich will euch dazwischenscheuchen,
Ins „nie noch Dagewesene“
Will ich euch täglich pressen,
Ins völlig Auserlesene,
Was morgen schon wieder vergessen.
Ich laß euch Bilder und Plastiken
Zehntausend gleich auftischen,
Mit einem Blick, einem hastigen,
Müßt ihr sie alle erwischen.
Ich führ’ euch in hundert Konzerte hinein
Zu Neutönern und neuesten Tönern,
Ihr sollt nur unter entsetzlicher Pein
Das Dasein euch verschönern.
Aber ohne Herrn Engel wäre die entsetzliche
Pein des Daseins nicht auszuhalten.
Der Engel im Himmel
Herrn G e o r g E n g e 1 ist seine Erde zu banal.
Man kann ihm das ohne weiteres glauben. Deshalb
teilt er der Fachzeitschrift „Vereinigte Tabakzei-
tungen“ mit, auf welche Weise er sich über die
Erde erheben kann. Nicht ohne daß die Vereinigten
Tabakzeitungen ihn unter „die führenden Männer
unserer Zeit auf geistigem und künstlerischem Ge-
biet“ ve r s e t z t hat. (Die übrigen Führer unserer
Zeit sind die Herren Jean Gilbert, Paul Knüpfer,
Alexander M o s z k o w s k y, Arnold Rieck,
Roda Roda, Otto Sommerstorff. JuliusStet-
t e n h e i m. Man begreift, weshalb man jetzt auf
Erden so schlecht fährt.) Die Vereinigten Tabak-
zeitungen wollten gern wissen, was die Kutscher
rauchen, ob sie rauchen und ob sie sich durch das
Rauchen „angeregt“ fühlen. Sie rauchen alle. Zum
Teil Zigaretten, zum Teil Zigarren. Und Herr
G e o r g E n g e 1 fühlt sich schon durch die Anfrage
der Vereinigten Tabakzeitungen sehr „angeregt“:
„Auf Ihre Umfrage bezüglich meiner Empfin-
dungen beim R a u c h g e n u ß erwidere ich Ihnen
folgendes:
Zigaretten rauch’ ich und Zigarren,
Und wenn die Wölkchen sich zur Decke heben,
Fühl' ich auf lichten Flügeln mich entschweben,
Enteilend dieser Welt von bunten Narren,
Und zur Gemeinschaft höh’rer Geister streben.
Georg Engel, Berlin
Bezüglich dieser Welt von bunten Narren bleibt
einem farblosen Bürger nichts übrig, als die Ge-
meinschaft höh’rer Geister zu apostrophieren. Aber
selbst drei Apostrophe in vier Zeilen geben diesem
Engel keine lichten Flügel.
Das literarische Frankfurt
Auch Frankfurt am Main verfügt über eine
Freie literarische Gesellschaft. Sie versendet ihr
Programm. An „Ordentlichen Veranstaltungen“
gibt es: „Unsere Fünfzigjährigen“, Vortrag von
Dr. Bruno Wille, Berlin, zur Geburtstagsfeier von
Ernst, Fulda, Hauptmann, Schlaf und
Schnitzler. Fünf mal fünfzig Lichter werden
für die Geburtstagskinder angezündet, alle weib-
lichen Mitglieder der literarischen Gesellschaft
stiften den Dichtern eigenhändig gestickte Pan-
toffeln, die Herren Ernst und Fulda bedanken
sich lyrisch und Herr Schnitzler im soignierten
Vollbart verbeugt sich mit einer weltmüden Geste.
Die Herren Hauptmann und Schlaf haben
ihr Erscheinen abgesagt. Dafür wind „Aus eigenen
Werken“ der Berliner Bürgermeister Herr „Dr. Gg.
Reicke“ vorlesen. Das wind ohne Zweifel eine or-
dentliche Veranstaltung. Denn Herr „Dr. Gg.
Reicke“ ist ein ausgesprochener Gegner der
Kunst und ein ausgeschriebener Gegner der Lite-
ratur. Als „Außerordentliche Veranstaltung“ wird
die Aufführung einer Operette ohne Musik von
Ludwig Bauer angekündigt. Die erhebenden Ver-
anstaltungen müssen natürlich gebührend „ein-
geführt“ werden. Man bekommt einen Essay „Vom
Kunstgenießen“ vorerst ins Haus geschickt. Denn
solche Kunst kann nicht so heiß gegessen wer-
den. Man sollte gar nicht glauben, wie schwer es
heutzutage das Kunstgenießen hat: „Unrast und
Uebermaß, die Zeitsymptome unsres Lebens, haben
mein und mehr auch dem Kunstgenießen ihren
Stempel aufgedrückt“. Diese unrechtmäßige Füh-
rung des Stempels kann der Vorstand der literari-
schen Gesellschaft nicht dulden. Er hat sich zwar
„mit den ersten Maisonnenstrahlen zu den Heil-
quellen der Natur fluchtartig und fast übersättigt
gestürzt“. Der Stempel hat ihm das ganze Mahl
verdorben. Aber der Mai ist gekommen und der
Mai ist gegangen. Auch der Sommer ist gekommen
und der Sommer ist gegangen. Nun kommt der
Herbst. Der Vorstand fühlt sich an den Heilquel-
len nicht mehr wohl. Und so ein Herbstabend ist
gerade dazu geschaffen, um Ordentliche und Außer-
ordentliche Veranstaltungen zu planen: „Da kommt
einmal ein trüber, kühler Abend, der uns in die
Stube zwingt. Die Lampe brennt zum ersten
Male wieder als memento mori der scheidenden
Sonnentage.“ Dem Vorstand fallen da natürlich die
Toten in den Kopf. Denn das Wetter ist wirklich
scheußlich: „Draußen prasselt ein herbstlicher
Regen wider die Fensterscheiben — wir lauschen
der eintönigen Melodie, halb im Traume noch, von
lieblichen Waldesidyllen oder dem gewaltigen Wel-
lenspiel des Meeres.“ Jetzt muß natürlich jemand
zur Tür eintreten. Und sie tritt ein, die Saison.
Aber die Saison in Frankfurt trägt einen deutsche-
ren Namen: Die Sinfonie der hehren Winterfreuden.
Aber sie tritt nicht ein, die Sinfonie, „da gleitet
sie plötzlich wieder leise und verstohlen zur
Tür herein, eine längst gekannte, halb vergessene
Illusionsgestalt“. Natürlich, wie es sich für eine
Illusionsgestalt ziemt, im Geleit von Dichtern, die
Illusionen des Vorstands sind. Nach soviel Lyrik
wird der Vorstand nüchterner und sich darüber
klar, daß er nicht weiß, was Literatur ist: „Man
wird sich schwer einigen können, will man heute
das Wirkungsgebiet der literarischen Gesellschaft
mit engen Grenzlinien umgeben; man müßte sich
erst einmal wieder über den Begriff des Wortes
Literatur, der sich längst ins Allgemeine, Vielge-
deutete und Vielmißbrauchte verloren hat, klar zu
werden suchen.“ Der Vorstand wird sich aber
nicht klar und nimmt deshalb „die Würdigung der
Fünfzigjährigen vor, ein literarisches Zeitbild, das
geschickt in einen Rahmen gepaßt ist und uns ganz
im Sinne der einleitenden Ausführungen scheint.“
Gewiß, so gut wie die Herren Ernst und Fulda
dichtet der Vorstand in seinen Ausführungen selber.
Und deshalb schließt der Essay vom Kunstgenießen
würdig: „Stoff genug zu lohnender künstlerischer
Arbeit ist vorhanden. Möge sie ihre Früchte
tragen!“ Wer Stoff säet, wird die Früchte ernten.
Verlegerdünkel
Es gibt literarische Verleger. Sie unterscheiden
sich von unliterarischen Verlegern dadurch,
daß sie die Werke der Literatur gleichfalls ab-
lehnen, aber außerdem ihre „Ansicht“ mitteilen.
Je besser das Werk ist, desto stärker wird das
„verlegerische Bedenken“ und die „verlegerische
Vernunft“. Ich will den Herren zum kritischen
Nachruhm helfen. Man sende mir solche Briefe.
Hier ist der zweite:
„Was ich Ihnen schon früher schrieb, kann ich
Ihnen heute nur wiederholen: Daß mir Ihre Ar-
beiten das größte Interesse einflößten und ich den
höchsten Respekt vor Ihren Absichten. Zielen und
auch dem, was schon in den vorliegenden Arbeiten
erreicht ist, habe. Aber neben diesem persönlichen
Urteil habe ich die stärksten verlegerischen Be-
denken, die ich Ihnen nicht verschweigen will. Der
Roman sowie die philosophische Abhandlung (dem
Einakter legen Sie wohl selbst weniger Wichtig-
keit bei) gehören zur schwersten Lektüre,
die m i r seit längerer Zeit vorlag. Und das macht
—r verzeihen Sie meine Offenheit — die Bücher
einfach unverkäuflich nach meinem Dafürhalten.
166