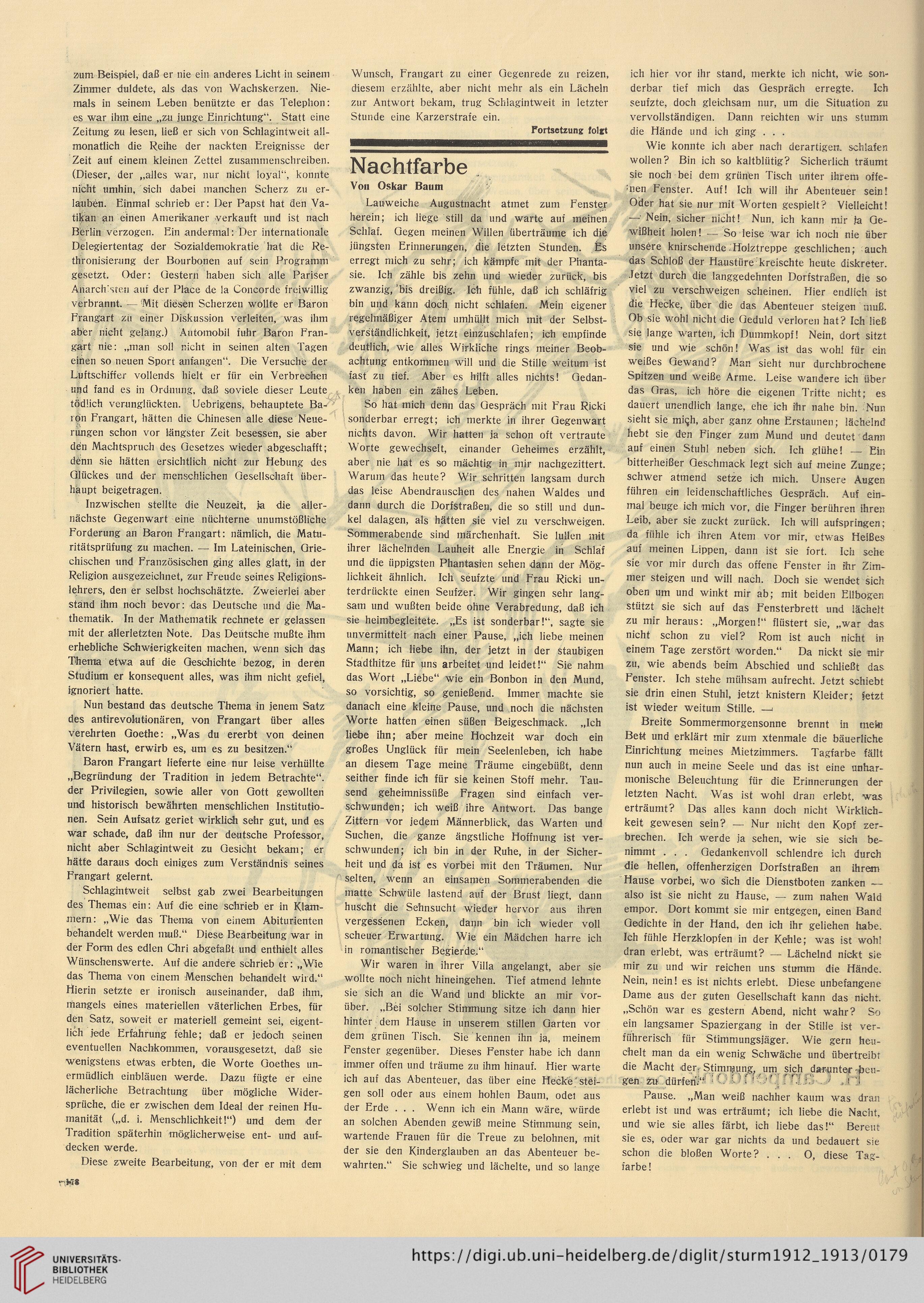zum Beispiel, daß er nie ein anderes Licht in seinem
Zimmer duldete, als das von Wachskerzen. Nie-
mals in seinem Leben benützte er das Telephon:
es war ihm eine „zu junge Einrichtung“. Statt eine
Zeitung zu lesen, ließ er sich von Schlagintweit all-
monatlich die Reihe der nackten Ereignisse der
Zeit auf einem kleinen Zettel zusammenschreiben.
(Dieser, der „alles war, nur nicht loyal“, konnte
nicht umhin, sich dabei manchen Scherz zu er-
lauben. Einmal schrieb er: Der Papst hat den Va-
tikan an einen Amerikaner verkauft und ist nach
Berlin verzogen. Ein andermal: Der internationale
Delegiertentag der Sozialdemokratie hat die Re-
thronisierung der Bourbonen auf sein Programm
gesetzt. Oder: Gestern haben sich alle Pariser
Anarchisten auf der Place de la Concorde freiwillig
verbrannt. — Mit diesen Scherzen wollte er Baron
Frangart zii einer Diskussion verleiten, was ihm
aber nicht gelang.) Automobil fuhr Baron Fran-
gart nie: „man soll nicht in seinen alten Tagen
einen so neuen Sport anfangen“. Die Versuche der
Luftschiffer vollends hielt er für ein Verbrechen
und fand es in Ordnung, daß soviele dieser Leute
tödlich verunglückten. Uebrigens, behauptete Ba-
ron Frangart, hätten die Chinesen alle diese Neue-
rungen schon vor längster Zeit besessen, sie aber
den Machtspruch des Gesetzes wieder abgeschafft;
denn sie hätten ersichtlich nicht zur Hebung des
Glückes und der menschlichen Gesellschaft über-
haupt beigetragen.
Inzwischen stellte die Neuzeit, ja die aller-
nächste Gegenwart eine nüchterne unumstößliche
Forderung an Baron Frangart: nämlich, die Matu-
ritätsprüfung zu machen. — Im Lateinischen, Grie-
chischen und Französischen ging alles glatt, in der
Religion ausgezeichnet, zur Freude seines Religions-
lehrers, den er selbst hochschätzte. Zweierlei aber
stand ihm noch bevor: das Deutsche und die Ma-
thematik. In der Mathematik rechnete er gelassen
mit der allerletzten Note. Das Deutsche mußte ihm
erhebliche Schwierigkeiten machen, wenn sich das
Thema etwa auf die Geschichte bezog, in deren
Studium er konsequent alles, was ihm nicht gefiel,
ignoriert hatte.
Nun bestand das deutsche Thema in jenem Satz
des antirevolutionären, von Frangart über alles
verehrten Goethe: „Was du ererbt von deinen
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“
Baron Frangart lieferte eine nur leise verhüllte
„Begründung der Tradition in jedem Betrachte“,
der Privilegien, sowie aller von Gott gewollten
und historisch bewährten menschlichen Institutio-
nen. Sein Aufsatz geriet wirklich sehr gut, und es
war schade, daß ihn nur der deutsche Professor,
nicht aber Schlagintweit zu Gesicht bekam; er
hätte daraus doch einiges zum Verständnis seines
Frangart gelernt.
Schlagintweit selbst gab zwei Bearbeitungen
des Themas ein: Auf die eine schrieb er in Klam-
mern: „Wie das Thema von einem Abiturienten
behandelt werden muß.“ Diese Bearbeitung war in
der Form des edlen Chri abgefaßt und enthielt alles
Wünschenswerte. Auf die andere schrieb er: „Wie
das Thema von einem Menschen behandelt wird.“
Hierin setzte er ironisch auseinander, daß ihm,
mangels eines materiellen väterlichen Erbes, für
den Satz, soweit er materiell gemeint sei, eigent-
lich jede Erfahrung fehle; daß er jedoch seinen
eventuellen Nachkommen, vorausgesetzt, daß sie
wenigstens etwas erbten, die Worte Goethes un-
ermüdlich einbläuen werde. Dazu fügte er eine
lächerliche Betrachtung über mögliche Wider-
sprüche, die er zwischen dem Ideal der reinen Hu-
manität („d. i. Menschlichkeit!“) und dem der
Tradition späterhin möglicherweise ent- und auf-
decken werde.
Diese zweite Bearbeitung, von der er mit dem
•-Ml
Wunsch, Frangart zu einer Gegenrede zu reizen,
diesem erzählte, aber nicht mehr als ein Lächeln
zur Antwort bekam, trug Schlagintweit in letzter
Stunde eine Karzerstrafe ein.
Fortsetzung folgt
Nachtfarbe
Von Oskar Baum
Lauweiche Augustnacht atmet zum Fenster
herein; ich liege still da und warte auf meinen
Schlaf. Gegen meinen Willen überträume ich die
jüngsten Erinnerungen, die letzten Stunden. Es
erregt mich zu sehr; ich kämpfe mit der Phanta-
sie. Ich zähle bis zehn und wieder zurück, bis
zwanzig, bis dreißig. Ich fühle, daß ich schläfrig
bin und kann doch nicht schlafen. Mein eigener
regelmäßiger Atem umhüllt mich mit der Selbst-
verständlichkeit, jetzt einzuschlafen; ich empfinde
deutlich, wie alles Wirkliche rings meiner Beob-
achtung entkommen will und die Stille weitum ist
fast zu tief. Aber es hilft alles nichts! Gedan-
ken haben ein zähes Leben.
So hat mich denn das Gespräch mit Frau Ricki
sonderbar erregt; ich merkte in ihrer Gegenwart
nichts davon. Wir hatten ja schon oft vertraute
Worte gewechselt, einander Geheimes erzählt,
aber nie hat es so mächtig in mir nachgezittert.
Warum das heute? Wir schritten langsam durch
das leise Abendrauschen des nahen Waldes und
dann durch die Dorfstraßen, die so still und dun-
kel dalagen, als hätten sie viel zu verschweigen.
Sommerabende sind märchenhaft. Sie lullen mit
ihrer lächelnden Lauheit alle Energie in Schlaf
und die üppigsten Phantasien sehen dann der Mög-
lichkeit ähnlich. Ich seufzte und Frau Ricki un-
terdrückte einen Seufzer. Wir gingen sehr lang-
sam und wußten beide ohne Verabredung, daß ich
sie heimbegleitete. „Es ist sonderbar!“, sagte sie
unvermittelt nach einer Pause, „ich liebe meinen
Mann; ich liebe ihn, der jetzt in der staubigen
Stadthitze für uns arbeitet und leidet!“ Sie nahm
das Wort „Liebe“ wie ein Bonbon in den Mund,
so vorsichtig, so genießend. Immer machte sie
danach eine kleine Pause, und noch die nächsten
Worte hatten einen süßen Beigeschmack. „Ich
liebe ihn; aber meine Hochzeit war doch ein
großes Unglück für mein Seelenleben, ich habe
an diesem Tage meine Träume eingebüßt, denn
seither finde ich für sie keinen Stoff mehr. Tau-
send geheimnissüße Fragen sind einfach ver-
schwunden; ich weiß ihre Antwort. Das bange
Zittern vor jedem Männerblick, das Warten und
Suchen, die ganze ängstliche Hoffnung ist ver-
schwunden; ich bin in der Ruhe, in der Sicher-
heit und da ist es vorbei mit den Träumen. Nur
selten, wenn an einsamen Sommerabenden die
matte Schwüle lastend auf der Brust liegt, dann
huscht die Sehnsucht wieder hervor aus ihren
vergessenen Ecken, dann bin ich wieder voll
scheuer Erwartung. Wie ein Mädchen harre ich
in romantischer Begierde.“
Wir waren in ihrer Villa angelangt, aber sie
wollte noch nicht hineingehen. Tief atmend lehnte
sie sich an die Wand und blickte an mir vor-
über. „Bei solcher Stimmung sitze ich dann hier
hinter dem Hause in unserem stillen Garten vor
dem grünen Tisch. Sie kennen ihn ja, meinem
Fenster gegenüber. Dieses Fenster habe ich dann
immer offen und träume zu ihm hinauf. Hier warte
ich auf das Abenteuer, das über eine Hecke'stei-
gen soll oder aus einem hohlen Baum, odei aus
der Erde . . . Wenn ich ein Mann wäre, würde
an solchen Abenden gewiß meine Stimmung sein,
wartende Frauen für die Treue zu belohnen, mit
der sie den Kinderglauben an das Abenteuer be-
wahrten.“ Sie schwieg und lächelte, und so lange
ich hier vor ihr stand, merkte ich nicht, wie son-
derbar tief mich das Gespräch erregte. Ich
seufzte, doch gleichsam nur, um die Situation zu
vervollständigen. Dann reichten wir uns stumm
die Hände und ich ging . . .
Wie konnte ich aber nach derartigem schlafen
wollen? Bin ich so kaltblütig? Sicherlich träumt
sie noch bei dem grünen Tisch unter ihrem offe-
nen Fenster. Auf! Ich will ihr Abenteuer sein!
Oder hat sie nur mit Worten gespielt? Vielleicht!
—■ Nein, sicher nicht! Nun, ich kann mir ja Ge-
wißheit holen! — So leise war ich noch nie über
unsere knirschende-Holztreppe geschlichen; auch
das Schloß der Haustüre kreischte heute diskreter.
Jetzt durch die langgedehnten Dorfstraßen, die so
viel zu verschweigen scheinen. Hier endlich ist
die Hecke, über die das Abenteuer steigen muß.
Ob sie wohl nicht die Geduld verloren hat? Ich ließ
sie lange warten, ich Dummkopf! Nein, dort sitzt
sie und wie schön! Was ist das wohl für ein
weißes Gewand? Man sieht nur durchbrochene
Spitzen und weiße Arme. Leise wandere ich über
das Gras, ich höre die eigenen Tritte nicht; es
dauert unendlich lange, ehe ich ihr nahe bin. Nun
sieht sie micjh, aber ganz ohne Erstaunen; lächelnd
hebt sie den Finger zum Mund und deutet dann
auf einen Stuhl neben sich. Ich glühe! — Ein
bitterheißer Geschmack legt sich auf meine Zunge;
schwer atmend setze ich mich. Unsere Augen
führen ein leidenschaftliches Gespräch. Auf ein-
mal beuge ich mich vor, die Finger berühren ihren
Leib, aber sie zuckt zurück. Ich will aufspringen;
da fühle ich ihren Atem vor mir, etwas Heißes
auf meinen Lippen, dann ist sie fort. Ich sehe
sie vor mir durch das offene Fenster in ihr Zim-
mer steigen und will nach. Doch sie wendet sich
oben um und winkt mir ab; mit beiden Ellbogen
stützt sie sich auf das Fensterbrett und lächelt
zu mir heraus: „Morgen!“ flüstert sie, „war das
nicht schon zu viel? Rom ist auch nicht in
einem Tage zerstört worden.“ Da nickt sie mir
zu, wie abends beim Abschied und schließt das
Fenster. Ich stehe mühsam aufrecht. Jetzt schiebt
sie drin einen Stuhl, jetzt knistern Kleider; fetzt
ist wieder weitum Stille. —>
Breite Sommermorgensonne brennt in mein
Bett und erklärt mir zum xtenmale die bäuerliche
Einrichtung meines Mietzimmers. Tagfarbe fällt
nun auch in meine Seele und das ist eine unhar-
monische Beleuchtung für die Erinnerungen der
letzten Nacht. Was ist wohl dran erlebt, was
erträumt? Das alles kann doch nicht Wirklich-
keit gewesen sein? — Nur nicht den Kopf zer-
brechen. Ich werde ja sehen, wie sie sich be-
nimmt . . . Gedankenvoll schlendre ich durch
die hellen, offenherzigen Dorfstraßen an ihrem
Hause vorbei, wo sich die Dienstboten zanken —
also ist sie nicht zu Hause, — zum nahen Wald
empor. Dort kommt sie mir entgegen, einen Band
Gedichte in der Hand, den ich ihr geliehen habe.
Ich fühle Herzklopfen in der Kehle; was ist wohl
dran erlebt, was erträumt? — Lächelnd nickt sie
mir zu und wir reichen uns stumm die Hände.
Nein, nein! es ist nichts erlebt. Diese unbefangene
Dame aus der guten Gesellschaft kann das nicht.
„Schön war es gestern Abend, nicht wahr? So
ein langsamer Spaziergang in der Stille ist ver-
führerisch für Stimmungsjäger. Wie gern heu-
chelt man da ein wenig Schwäche und übertreibt
Pause. „Man weiß nachher kaum was dran
erlebt ist und was erträumt; ich liebe die Nacht,
und wie sie alles färbt, ich liebe das!“ Berent
sie es, oder war gar nichts da und bedauert sie
schon die bloßen Worte? ... O, diese Tag-
farbe !
Zimmer duldete, als das von Wachskerzen. Nie-
mals in seinem Leben benützte er das Telephon:
es war ihm eine „zu junge Einrichtung“. Statt eine
Zeitung zu lesen, ließ er sich von Schlagintweit all-
monatlich die Reihe der nackten Ereignisse der
Zeit auf einem kleinen Zettel zusammenschreiben.
(Dieser, der „alles war, nur nicht loyal“, konnte
nicht umhin, sich dabei manchen Scherz zu er-
lauben. Einmal schrieb er: Der Papst hat den Va-
tikan an einen Amerikaner verkauft und ist nach
Berlin verzogen. Ein andermal: Der internationale
Delegiertentag der Sozialdemokratie hat die Re-
thronisierung der Bourbonen auf sein Programm
gesetzt. Oder: Gestern haben sich alle Pariser
Anarchisten auf der Place de la Concorde freiwillig
verbrannt. — Mit diesen Scherzen wollte er Baron
Frangart zii einer Diskussion verleiten, was ihm
aber nicht gelang.) Automobil fuhr Baron Fran-
gart nie: „man soll nicht in seinen alten Tagen
einen so neuen Sport anfangen“. Die Versuche der
Luftschiffer vollends hielt er für ein Verbrechen
und fand es in Ordnung, daß soviele dieser Leute
tödlich verunglückten. Uebrigens, behauptete Ba-
ron Frangart, hätten die Chinesen alle diese Neue-
rungen schon vor längster Zeit besessen, sie aber
den Machtspruch des Gesetzes wieder abgeschafft;
denn sie hätten ersichtlich nicht zur Hebung des
Glückes und der menschlichen Gesellschaft über-
haupt beigetragen.
Inzwischen stellte die Neuzeit, ja die aller-
nächste Gegenwart eine nüchterne unumstößliche
Forderung an Baron Frangart: nämlich, die Matu-
ritätsprüfung zu machen. — Im Lateinischen, Grie-
chischen und Französischen ging alles glatt, in der
Religion ausgezeichnet, zur Freude seines Religions-
lehrers, den er selbst hochschätzte. Zweierlei aber
stand ihm noch bevor: das Deutsche und die Ma-
thematik. In der Mathematik rechnete er gelassen
mit der allerletzten Note. Das Deutsche mußte ihm
erhebliche Schwierigkeiten machen, wenn sich das
Thema etwa auf die Geschichte bezog, in deren
Studium er konsequent alles, was ihm nicht gefiel,
ignoriert hatte.
Nun bestand das deutsche Thema in jenem Satz
des antirevolutionären, von Frangart über alles
verehrten Goethe: „Was du ererbt von deinen
Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.“
Baron Frangart lieferte eine nur leise verhüllte
„Begründung der Tradition in jedem Betrachte“,
der Privilegien, sowie aller von Gott gewollten
und historisch bewährten menschlichen Institutio-
nen. Sein Aufsatz geriet wirklich sehr gut, und es
war schade, daß ihn nur der deutsche Professor,
nicht aber Schlagintweit zu Gesicht bekam; er
hätte daraus doch einiges zum Verständnis seines
Frangart gelernt.
Schlagintweit selbst gab zwei Bearbeitungen
des Themas ein: Auf die eine schrieb er in Klam-
mern: „Wie das Thema von einem Abiturienten
behandelt werden muß.“ Diese Bearbeitung war in
der Form des edlen Chri abgefaßt und enthielt alles
Wünschenswerte. Auf die andere schrieb er: „Wie
das Thema von einem Menschen behandelt wird.“
Hierin setzte er ironisch auseinander, daß ihm,
mangels eines materiellen väterlichen Erbes, für
den Satz, soweit er materiell gemeint sei, eigent-
lich jede Erfahrung fehle; daß er jedoch seinen
eventuellen Nachkommen, vorausgesetzt, daß sie
wenigstens etwas erbten, die Worte Goethes un-
ermüdlich einbläuen werde. Dazu fügte er eine
lächerliche Betrachtung über mögliche Wider-
sprüche, die er zwischen dem Ideal der reinen Hu-
manität („d. i. Menschlichkeit!“) und dem der
Tradition späterhin möglicherweise ent- und auf-
decken werde.
Diese zweite Bearbeitung, von der er mit dem
•-Ml
Wunsch, Frangart zu einer Gegenrede zu reizen,
diesem erzählte, aber nicht mehr als ein Lächeln
zur Antwort bekam, trug Schlagintweit in letzter
Stunde eine Karzerstrafe ein.
Fortsetzung folgt
Nachtfarbe
Von Oskar Baum
Lauweiche Augustnacht atmet zum Fenster
herein; ich liege still da und warte auf meinen
Schlaf. Gegen meinen Willen überträume ich die
jüngsten Erinnerungen, die letzten Stunden. Es
erregt mich zu sehr; ich kämpfe mit der Phanta-
sie. Ich zähle bis zehn und wieder zurück, bis
zwanzig, bis dreißig. Ich fühle, daß ich schläfrig
bin und kann doch nicht schlafen. Mein eigener
regelmäßiger Atem umhüllt mich mit der Selbst-
verständlichkeit, jetzt einzuschlafen; ich empfinde
deutlich, wie alles Wirkliche rings meiner Beob-
achtung entkommen will und die Stille weitum ist
fast zu tief. Aber es hilft alles nichts! Gedan-
ken haben ein zähes Leben.
So hat mich denn das Gespräch mit Frau Ricki
sonderbar erregt; ich merkte in ihrer Gegenwart
nichts davon. Wir hatten ja schon oft vertraute
Worte gewechselt, einander Geheimes erzählt,
aber nie hat es so mächtig in mir nachgezittert.
Warum das heute? Wir schritten langsam durch
das leise Abendrauschen des nahen Waldes und
dann durch die Dorfstraßen, die so still und dun-
kel dalagen, als hätten sie viel zu verschweigen.
Sommerabende sind märchenhaft. Sie lullen mit
ihrer lächelnden Lauheit alle Energie in Schlaf
und die üppigsten Phantasien sehen dann der Mög-
lichkeit ähnlich. Ich seufzte und Frau Ricki un-
terdrückte einen Seufzer. Wir gingen sehr lang-
sam und wußten beide ohne Verabredung, daß ich
sie heimbegleitete. „Es ist sonderbar!“, sagte sie
unvermittelt nach einer Pause, „ich liebe meinen
Mann; ich liebe ihn, der jetzt in der staubigen
Stadthitze für uns arbeitet und leidet!“ Sie nahm
das Wort „Liebe“ wie ein Bonbon in den Mund,
so vorsichtig, so genießend. Immer machte sie
danach eine kleine Pause, und noch die nächsten
Worte hatten einen süßen Beigeschmack. „Ich
liebe ihn; aber meine Hochzeit war doch ein
großes Unglück für mein Seelenleben, ich habe
an diesem Tage meine Träume eingebüßt, denn
seither finde ich für sie keinen Stoff mehr. Tau-
send geheimnissüße Fragen sind einfach ver-
schwunden; ich weiß ihre Antwort. Das bange
Zittern vor jedem Männerblick, das Warten und
Suchen, die ganze ängstliche Hoffnung ist ver-
schwunden; ich bin in der Ruhe, in der Sicher-
heit und da ist es vorbei mit den Träumen. Nur
selten, wenn an einsamen Sommerabenden die
matte Schwüle lastend auf der Brust liegt, dann
huscht die Sehnsucht wieder hervor aus ihren
vergessenen Ecken, dann bin ich wieder voll
scheuer Erwartung. Wie ein Mädchen harre ich
in romantischer Begierde.“
Wir waren in ihrer Villa angelangt, aber sie
wollte noch nicht hineingehen. Tief atmend lehnte
sie sich an die Wand und blickte an mir vor-
über. „Bei solcher Stimmung sitze ich dann hier
hinter dem Hause in unserem stillen Garten vor
dem grünen Tisch. Sie kennen ihn ja, meinem
Fenster gegenüber. Dieses Fenster habe ich dann
immer offen und träume zu ihm hinauf. Hier warte
ich auf das Abenteuer, das über eine Hecke'stei-
gen soll oder aus einem hohlen Baum, odei aus
der Erde . . . Wenn ich ein Mann wäre, würde
an solchen Abenden gewiß meine Stimmung sein,
wartende Frauen für die Treue zu belohnen, mit
der sie den Kinderglauben an das Abenteuer be-
wahrten.“ Sie schwieg und lächelte, und so lange
ich hier vor ihr stand, merkte ich nicht, wie son-
derbar tief mich das Gespräch erregte. Ich
seufzte, doch gleichsam nur, um die Situation zu
vervollständigen. Dann reichten wir uns stumm
die Hände und ich ging . . .
Wie konnte ich aber nach derartigem schlafen
wollen? Bin ich so kaltblütig? Sicherlich träumt
sie noch bei dem grünen Tisch unter ihrem offe-
nen Fenster. Auf! Ich will ihr Abenteuer sein!
Oder hat sie nur mit Worten gespielt? Vielleicht!
—■ Nein, sicher nicht! Nun, ich kann mir ja Ge-
wißheit holen! — So leise war ich noch nie über
unsere knirschende-Holztreppe geschlichen; auch
das Schloß der Haustüre kreischte heute diskreter.
Jetzt durch die langgedehnten Dorfstraßen, die so
viel zu verschweigen scheinen. Hier endlich ist
die Hecke, über die das Abenteuer steigen muß.
Ob sie wohl nicht die Geduld verloren hat? Ich ließ
sie lange warten, ich Dummkopf! Nein, dort sitzt
sie und wie schön! Was ist das wohl für ein
weißes Gewand? Man sieht nur durchbrochene
Spitzen und weiße Arme. Leise wandere ich über
das Gras, ich höre die eigenen Tritte nicht; es
dauert unendlich lange, ehe ich ihr nahe bin. Nun
sieht sie micjh, aber ganz ohne Erstaunen; lächelnd
hebt sie den Finger zum Mund und deutet dann
auf einen Stuhl neben sich. Ich glühe! — Ein
bitterheißer Geschmack legt sich auf meine Zunge;
schwer atmend setze ich mich. Unsere Augen
führen ein leidenschaftliches Gespräch. Auf ein-
mal beuge ich mich vor, die Finger berühren ihren
Leib, aber sie zuckt zurück. Ich will aufspringen;
da fühle ich ihren Atem vor mir, etwas Heißes
auf meinen Lippen, dann ist sie fort. Ich sehe
sie vor mir durch das offene Fenster in ihr Zim-
mer steigen und will nach. Doch sie wendet sich
oben um und winkt mir ab; mit beiden Ellbogen
stützt sie sich auf das Fensterbrett und lächelt
zu mir heraus: „Morgen!“ flüstert sie, „war das
nicht schon zu viel? Rom ist auch nicht in
einem Tage zerstört worden.“ Da nickt sie mir
zu, wie abends beim Abschied und schließt das
Fenster. Ich stehe mühsam aufrecht. Jetzt schiebt
sie drin einen Stuhl, jetzt knistern Kleider; fetzt
ist wieder weitum Stille. —>
Breite Sommermorgensonne brennt in mein
Bett und erklärt mir zum xtenmale die bäuerliche
Einrichtung meines Mietzimmers. Tagfarbe fällt
nun auch in meine Seele und das ist eine unhar-
monische Beleuchtung für die Erinnerungen der
letzten Nacht. Was ist wohl dran erlebt, was
erträumt? Das alles kann doch nicht Wirklich-
keit gewesen sein? — Nur nicht den Kopf zer-
brechen. Ich werde ja sehen, wie sie sich be-
nimmt . . . Gedankenvoll schlendre ich durch
die hellen, offenherzigen Dorfstraßen an ihrem
Hause vorbei, wo sich die Dienstboten zanken —
also ist sie nicht zu Hause, — zum nahen Wald
empor. Dort kommt sie mir entgegen, einen Band
Gedichte in der Hand, den ich ihr geliehen habe.
Ich fühle Herzklopfen in der Kehle; was ist wohl
dran erlebt, was erträumt? — Lächelnd nickt sie
mir zu und wir reichen uns stumm die Hände.
Nein, nein! es ist nichts erlebt. Diese unbefangene
Dame aus der guten Gesellschaft kann das nicht.
„Schön war es gestern Abend, nicht wahr? So
ein langsamer Spaziergang in der Stille ist ver-
führerisch für Stimmungsjäger. Wie gern heu-
chelt man da ein wenig Schwäche und übertreibt
Pause. „Man weiß nachher kaum was dran
erlebt ist und was erträumt; ich liebe die Nacht,
und wie sie alles färbt, ich liebe das!“ Berent
sie es, oder war gar nichts da und bedauert sie
schon die bloßen Worte? ... O, diese Tag-
farbe !