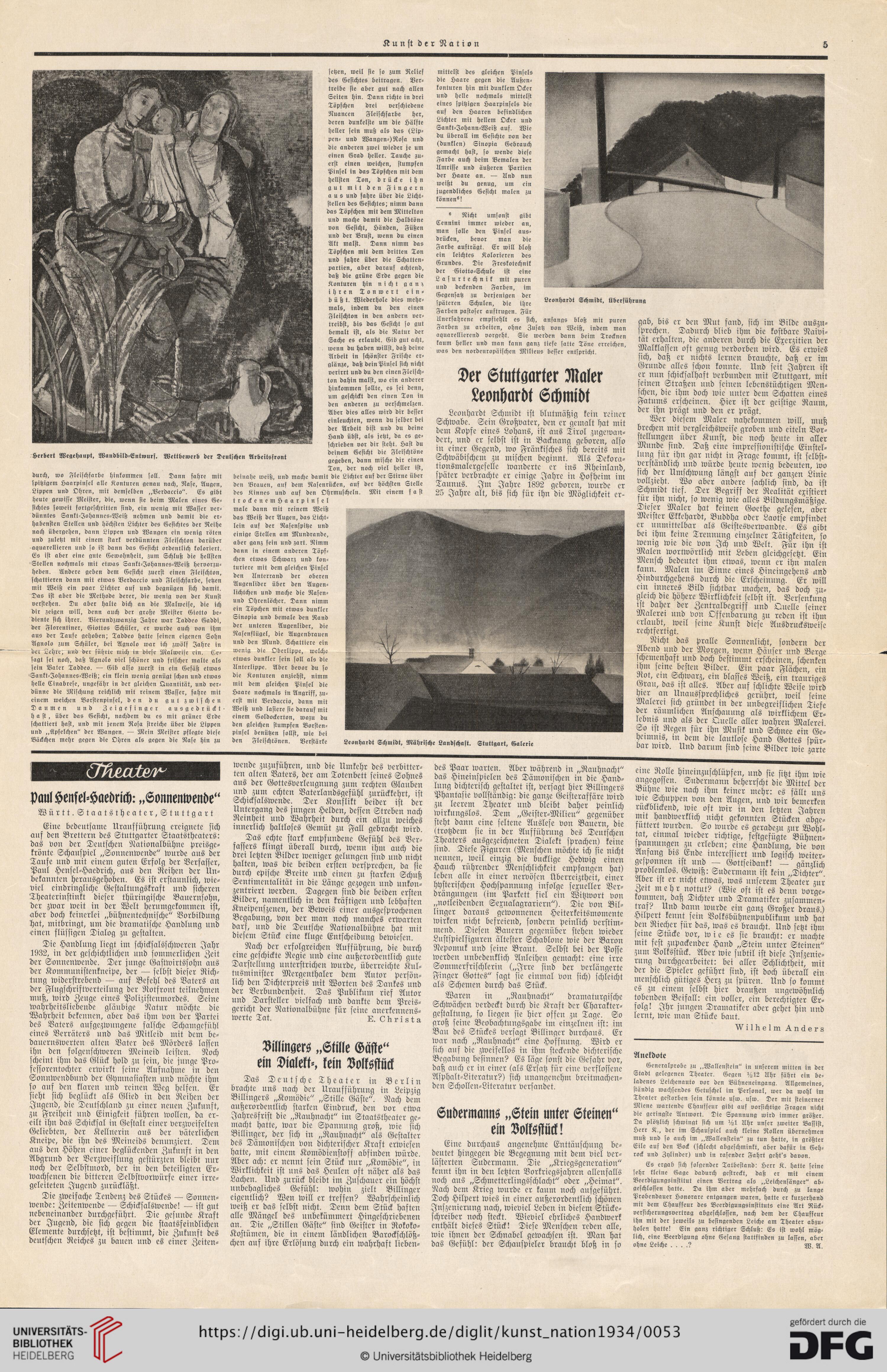Kunst der Nation
5
Herbert Wegehanpt, Wandbild-Entwurs. Wettbewerb der Deutschen Arbeitsfront
Leonhardt Schmidt, Überführung
durch, wo Fleischfarbe hinkommcn sott. Dann fahre mit
spitzigem Haarpinsel alle Konturen genau nach, Nase, Augen,
Lippen und Ohren, mit demselben „Verdaccio". Es gibt
heute gewisse Meister, die, wenn sie beim Malen eines Ge-
sichtes soweit fortgeschritten sind, ein wenig mit Wasser ver-
dünntes Sankt-Johannes-Weih nehmen und damit die er-
habensten Stellen und höchsten Lichter des Gesichtes der Reihe
nach übergehen, dann Lippen und Wangen ein wenig röten
und zuletzt mit einem stark verdünnten Fleischton darüber
aquarellieren und so ist dann das Gesicht ordentlich koloriert.
Es ist aber eine gute Gewohnheit, zum Schluß die hellsten
Stellen nochmals mit etwas Sankt-Johannes-Weiß hervorzu-
heben. Andere geben dem Gesicht zuerst einen Flcischton,
schattieren dann mit etwas Verdaccio und Fleischfarbe, setzen
mit Weih ein paar Lichter auf und begnügen sich damit.
Das ist aber die Methode derer, die wenig von der Kunst
verstehen. Du aber halte dich an die Malweise, die ich
dir zeigen will, denn auch der große Meister Giotto be-
diente sich ihrer. Vierundzwanzig Jahre war Taddeo Eaddi,
der Florentiner, Eiottos Schüler, er wurde auch von ihm
aus der Taufe gehoben; Taddeo hatte seinen eigenen Sohn
Agnolo zum Schüler, bei Agnolo war ich zwölf Jahre in
der Lehre, und der führte mich in diese Malweise ein. Ge-
sagt sei noch, daß Agnolo viel schöner und frischer malte als
sein Vater Taddeo. — Gib also zuerst in ein Gefäß etwas
<Sankt-Johannes-Weib; ein klein wenig genügt schon und etwas
Helle Cinabrese, ungefähr in der gleichen Quantität, und ver-
dünne die Mischung reichlich mit reinem Wasser, fahre mit
einem weichen Borstenpinsel, den du gut zwischen
Daumen und Zeigefinger ausgedrückt
h a st, über das Gesicht, nachdem du es mit grüner Erde
schattiert hast, und mit jenem Rosa streiche über die Lippen
und „Äpfelchen" der Wangen. — Mein Meister pflegte diese
Bäckchen mehr gegen die Ohren als gegen die Nase hin zu
setzen, weil sie so zum Relief
des Gesichtes beitragen. Ver-
treibe sie aber gut nach allen
Seiten hin. Dann richte in drei
Töpfchen drei verschiedene
Nuancen Fleischfarbe her,
deren dunkelste um die Hälfte
Heller sein muß als das (Lip-
pen- und Wangen-)Rosa und
die anderen zwei wieder je um
einen Grad Heller. Tauche zu-
erst einen weichen, stumpfen
Pinsel in das Töpfchen mit dem
hellsten Ton, drücke ihn
gut mit den Fingern
aus und fahre über die Licht-
stellen des Gesichtes; nimm dann
das Töpfchen mit dem Mittelton
und mache damit die Halbtöne
von Gesicht, Händen, Füßen
und der Brust, wenn du einen
Akt malst. Dann nimm das
Töpfchen mit dem dritten Ton
und fahre über die Schatten-
partien, aber darauf achtend,
daß die grüne Erde gegen die
Konturen hin nicht ganz
ihren Tonwert ein-
büßt. Wiederhole dies mehr-
mals, indem du den einen
Fleischton in den andern ver-
treibst, bis das Gesicht so gut
bemalt ist, als die Natur der
Sache es erlaubt. Gib gut acht,
wenn du haben willst, daß deine
Arbeit in schönster Frische er-
glänze, daß dein Pinsel sich nicht
verirrt und du den einen Fleisch-
ton dahin malst, wo ein anderer
hinkommen sollte, es sei denn,
um geschickt den einen Ton in
den anderen zu verschmelzen.
Aber dies alles wird dir besser
einleuchten, wenn du selber bei
der Arbeit bist und du deine
Hand übst, als jetzt, da es ge-
schrieben vor dir steht. Hast du
deinem Gesicht die Fleischtöne
gegeben, dann mische dir einen
Ton, der noch viel Heller ist,
beinahe weiß, und mache damit die Lichter auf der Stirne über
den Brauen, auf dem Nasenrücken, auf der höchsten Stelle
des Kinnes und auf den Ohrmuscheln. Mit einem f a st
trockenemHaarpinsel
male dann mit reinem Weiß
das Weiß der Augen, das Licht-
lein auf der Nasenspitze und
einige Stellen am Mundrande,
aber ganz fein und zart. Nimm
dann in einem anderen Töpf-
chen etwas Schwarz und kon-
turiere mit dem gleichen Pinsel
den Unterrand der oberen
Augenlider über den Augen-
lichtchen und mache die Nasen-
und Ohrenlöcher. Dann nimm
ein Töpchen mit etwas dunkler
Sinopia und bemale den Rand
der unteren Augenlider, die
Nasenflügel, die Augenbrauen
und den Mund. Schattiere ein
wenig die Oberlippe, welche
etwas dunkler sein soll als die
Unterlippe. Aber bevor du so
die Konturen anziehst, nimm
mit dem gleichen Pinsel die
Haare nochmals in Angriff, zu-
erst mit Verdaccio, dann mit
Weiß und lasiere sie darauf mit
einem Eoldockerton, wozu du
den gleichen stumpfen Borsten-
pinsel benützen sollst, wie bei
den Fleischtönen. Verstärke
mittelst des gleichen Pinsels
die Haare gegen die Außen-
konturen hin mit dunklem Ocker
und Helle nochmals mittelst
eines spitzigen Haarpinsels die
auf den Haaren befindlichen
Lichter mit Hellem Ocker und
Sankt-Johann-Weiß auf. Wie
du überall im Gesichte von der
(dunklen) Sinopia Gebrauch
gemacht hast, so wende diese
Farbe auch beim Bemalen der
Umrisse und äußeren Partien
der Haare an. — Und nun
weißt du genug, um ein
jugendliches Gesicht malen zu
können^!
° Nicht umsonst gibt
Cennini immer wieder an,
man solle den Pinsel aus-
drücken, bevor man die
Farbe aufträgt. Er will bloß
ein leichtes Kolorieren des
Grundes. Die Freskotechnik
der Giotto-Schule ist eine
Lasurtechnik mit puren
und deckenden Farben, im
Gegensatz zu derjenigen der
späteren Schulen, die ihre
Farben pastoser auftrugen. Für
Unerfahrene empfiehlt es sich, anfangs bloß mit puren
Farben zu arbeiten, ohne Zusatz von Weiß, indem man
aquarellierend vorgeht. Sie werden dann beim Trocknen
kaum Heller und man kann ganz tiefe satte Töne erreichen,
was den nordeuropäischen Milieus besser entspricht.
Der Stuttgarter Maler
Leonhardt Schmidt
Leonhardt Schmidt ist blntmäßig kein reiner
Schwabe. Sein Großvater, den er gemalt hat mit
dem Kopfe eines Lohans, ist aus Tirol zngewan-
dert, lind er selbst ist in Backnang geboren, also
in einer Gegend, wo Fränkisches sich bereits mit
Schwäbischem zu mischen beginnt. Als Dekoca-
tionsmalergeselle wanderte er ins Rheinland,
später verbrachte er einige Jahre in Hofheim im
Taunus. Im Jahre 1892 geboren, wurde er
25 Jahre alt, bis sich für ihn die Möglichkeit er-
gab, bis er den Mut fand, sich im Bilde auszu-
sprechen. Dadurch blieb ihm die kostbare Naivi-
tät erhalten, die anderen durch die Exerzitien der
Malklassen ost genug verdorben wird. Es erwies
sich, daß er nichts lernen brauchte, daß er im
Grunde alles schon konnte. Und seit Jahren ist
er nun schicksalhaft verbunden mit Stuttgart, mit
seinen Straßen und seinen lebenstüchtigen Men-
schen, die ihm doch wie unter dem Schatten eines
Fatums erscheinen. Hier ist der geistige Raum,
der ihn Prägt und den er Prägt.
Wer diesem Maler nahekommen will, muß
brechen mit vergleichsweise groben und eiteln Vor-
stellungen über Kunst, die noch heute in aller
Munde sind. Daß eine impressionistische Einstel-
lung für ihn gar nicht in Frage kommt, ist selbst-
verständlich und würde heute wenig bedeuten, wo
sich der Umschwung längst auf der ganzen Linie
vollzieht. Wo aber andere sachlich sind, da ist
Schmidt tief. Der Begriff der Realität existiert
für ihn nicht, so wenig wie alles Bildungsmäßige.
Dieser Maler hat keinen Goethe gelesen, aber
Meister Ekkehardt, Buddha oder Laotse empfindet
er unmittelbar als Geistesverwandte. Es gibt
bei ihm keine Trennung einzelner Tätigkeiten, so
wenig wie die von Ich und Welt. Für ihn ist
Malen wortwörtlich mit Leben gleichgesetzt. Ein
Mensch bedeutet ihm etwas, wenn er ihn malen
kann. Malen im Sinne eines Hineingehens und
Hindurchgehens durch die Erscheinung. Er will
ein inneres Bild sichtbar machen, das doch zu-
gleich die höhere Wirklichkeit selbst ist. Versenkung
ist daher der Zentralbegriff und Quelle seiner
Malerei und von Offenbarung zu reden ist ihm
erlaubt, weil seine Kunst diese Ausdrucksweise
rechtfertigt.
Nicht das pralle Sonnenlicht, sondern der
Abend und der Morgen, wenn Häuser und Berge
schemenhaft und doch bestimmt erscheinen, schenken
ihm seine besten Bilder. Ein paar Flächen, ein
Rot, ein Schwarz, ein blasses Weiß, ein trauriges
Grau, das ist alles. Aber auf schlichte Weise wird
hier an Unaussprechliches gerührt, weil seine
Malerei sich gründet in der unbegreiflichen Tiefe
der räumlichen Anschauung als wirklichem Er-
lebnis und als der Quelle aller wahren Malerei.
So ist Regen für ihn Musik und Schnee ein Ge-
heimnis, in dem die lautlose Hand Gottes spür-
bar wird. Und darum sind seine Bilder wie zarte
Leonhardt Schmidt, Mährische Landschaft. Stuttgart, Galerie
Paul Hensel-Haedrich: „Sonnenwende"
Württ. Staatstheater, Stuttgart
Eine bedeutsame Uraufführung ereignete sich
ans den Brettern des Stuttgarter Staatstheaters:
das voil der Deutscheu Nationalbühne preisge-
krönte Schauspiel „Souneuwende" wurde aus der
Taufe und mit eiuem guteu Erfolg der Verfasser,
Paul Heusel-Haedrich, aus den Reihen der Un-
bekannten herausgehoben. Es ist erstaunlich, wie-
viel eindringliche Gestaltungskraft und sicheren
Theaterinstinkt dieser thüringische Bailernsohn,
per zwar weit in der Welt herumgekommen ist,
aber doch keinerlei „bühnentechnische" Vorbildung
hat, mitbringt, um die dramatische Handlung und
einen flüssigen Dialog zu gestalten.
Die Handlung liegt im schicksalsschweren Jahr
1932, in der geschichtlichen und sommerlichen Zeit
der Sonnenwende. Der junge Gastwirtssohn ans
der Kommnnistenkneipe, der — selbst dieser Rich-
tung widerstrebend — auf Befehl des Vaters an
der Flugschriftverteiluug der Notsrout teilnehmen
muß, wird Zeuge eines Polizistenmordes. Seine
wahrheitsliebende gläubige Natur möchte die
Wahrheit bekennen, aber das ihm von der Partei
des Vaters anfgezwnngene falsche Schamgefühl
eines Verräters und das Mitleid mit dem be-
dauernswerten alten Vater des Mörders lassen
ihn den folgenschweren Meineid leisten. Noch
scheint ihm das Glück hold zu sein, die jnnge Pro-
fessorentochter erwirkt seine Ausnahme in den
Sonnwendbund der Gymnasiasten und möchte ihm
so ans den klaren und reinen Weg helfen. Er
sieht sich beglückt als Glied in den Reihen der
Jugend, die Deutschland zu einer neuen Zukunft,
zu Freiheit und Einigkeit führen wollen, da er-
eilt ihn das Schicksal in Gestalt einer verzweifelten
Geliebten, der Kellnerin ans der väterlichen
Kneipe, die ihn des Meineids denunziert. Dem
aus den Höhen einer beglückenden Zukunft in den
Abgrund der Verzweiflung gestürzten bleibt nur
noch der Selbstmord, der in den beteiligten Er-
wachsenen die bitteren Selbstvorwürfe einer irre-
geleiteten Jugend zurückläßt.
Die zweifache Tendenz des Stückes — Sonnen-
wende: Zeitenwende — Schicksalswende! — ist gut
nebeneinander durchgeführt. Die gcsuude Kraft
der Jugend, die sich gegen die staatsfeindlichen
Elemente durchsetzt, ist bestimmt, die Zukunft des
deutschen Reiches zu bauen und es einer Zeiten-
wende znzuführen, und die Umkehr des verbitter-
ten alten Vaters, der am Totenbett seines Sohnes
aus der Gottesverleugnung zum rechten Glauben
und zum echten Vaterlandsgefühl zurückkehrt, ist
Schicksalswende. Der Konflikt beider ist der
Untergang des jungen Helden, dessen Streben nach
Reinheit und Wahrheit durch ein allzn weiches
innerlich haltloses Gemüt zu Fall gebracht wird.
Das echte stark empfundene Gefühl des Ver-
fassers klingt überall dnrch, wenn ihm auch die
drei letzten Bilder weniger gelungen sind und nicht
halten, was die beiden ersten versprechen, da sie
durch epische Breite und einen zu starken Schuß
Sentimentalität in die Länge gezogen und unkon-
zentriert werden. Dagegen sind die beiden ersten
Bilder, namentlich in den kräftigen und lebhaften
Kneipenszenen, der Beweis einer ausgesprochenen
Begabung, von der man noch manches erwarten
darf, und die Deutsche Nationalbühne hat mit
diesem Stück eine kluge Entscheidung bewiesen.
Nach der erfolgreichen Aufführung, die durch
eine geschickte Regie und eine außerordentlich gute
Darstelluug unterstrichen wurde, überreichte Kul-
tusminister Mergenthaler dem Autor persön-
lich den Dichterpreis mit Worten des Dankes und
der Verbundenheit. Das Publikum rief Autor
und Darsteller vielfach und dankte dem Preis-
gericht der Nationalbühne für seine anerkennens-
werte Tat. 2. Obrista
Mingers „Stille Gäste"
ein Dialekt-, kein Volksstück
Das Deutsche Theater in Berlin
brachte uns nach der Uraufführung in Leipzig
Billingers „Komödie" „Stille Gäste". Nach dem
außerordentlich starken Eindruck, den vor etwa
Jahresfrist die „Rauhnacht" im Staatstheater ge-
macht hatte, war die Spannung groß, wie sich
Billinger, der sich in „Rauhnacht" als Gestalter
des Dämonischen von dichterischer Kraft erwiesen
hatte, mit einem Komödienstoff abfinden würde.
Aber ach: er nennt sein Stück nur „Komödie", iu
Wirklichkeit ist uus das Heulen oft näher als das
Lachen. Und zurück bleibt im Zuschauer ein höchst
unbehagliches Gefühl: wohin zielt Billinger
eigentlich? Wen will er treffen? Wahrscheinlich
weiß er das selbst nicht. Denn dem Stück haften
alle Mängel des unbekümmert Hingeschriebenen
an. Die „Stillen Gäste" sind Geister in Rokoko-
Kostümen, die in einem ländlichen Barockschlöß-
chen auf ihre Erlösung durch ein wahrhaft lieben-
des Paar warten. Aber während in „Rauhnacht"
das Hineinspielen des Dämonischen in die Hand-
lung dichterisch gestaltet ist, versagt hier Billingers
Phantasie vollständig: die ganze Geisteraffäre wird
zu leerem Theater und bleibt daher peinlich
wirkungslos. Dem „Geister-Milieu" gegenüber
steht dann eine seltene Auslese von Bauern, die
(trotzdem sie in der Aufführung des Deutschen
Theaters ausgezeichneten Dialekt sprachen) keine
sind. Diese Figuren (Menschen möchte ich sie nicht
nennen, weil einzig die bucklige Hedwig einen
Hauch rührender Menschlichkeit empfangen hat)
leben alle in einer nervösen Überreiztheit, einer
hysterischen Hochspannung infolge sexueller Ver-
drängungen (im Parkett fiel ein Witzwort von
„notleidenden Sexualagrariern"). Die von Bil-
linger daraus gewonnenen Heiterkeitsmomente
wirken nicht befreiend, sondern Peinlich verstim-
mend. Diesen Bauern gegenüber stehen wieder
Lustspielfiguren ältester Schablone wie der Baron
Nepomuk und seine Braut. Selbst bei der Posse
werden unbedenklich Anleihen gemacht: eine irre
Sommerfrischlern! („Irre sind der verlängerte
Finger Gottes" sagt sie einmal von sich) schleicht
als Schemen durch das Stück.
Wareu in „Rauhnacht" dramaturgische
Schwächen verdeckt durch die Kraft der Charakter-
gestaltung, so liegen sie hier offen zu Tage. So
groß seiue Beobachtungsgabe im einzelnen ist: im
Bau des Stückes versagt Billinger durchaus. Er
war uach „Rauhnacht" eine Hoffnung. Wird er
sich auf die zweifellos in ihm steckende dichterische
Begabung besinnen? Es läge sonst die Gefahr vor,
daß auch er in einer (als Ersatz für eine verflossene
Asphalt-Literatur?) sich unangenehm breitmachen-
den Schollen-Literatur versandet.
Sudermanns „Stein unter Steinen"
ein Volksstück!
Eine durchaus angenehme Enttäuschung be-
deutet hingegen die Begegnung mit dem viel ver-
lästerten Sudermann. Die „Kriegsgeneration"
kennt ihn in den letzten Vorkriegsjahren allenfalls
noch aus „Schmetterlingsschlacht" oder „Heimat".
Nach dem Krieg wurde er kaum noch aufgeführt.
Doch Hilpert wies in einer außerordentlich schönen
Inszenierung nach, wieviel Leben in diesem Stücke-
schreiber noch steckt. Wieviel ehrliches Handwerk
enthält dieses Stück! Diese Menschen reden alle,
wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Man hat
das Gefühl: der Schauspieler braucht bloß in so
eine Rolle hineinzuschlüpsen, und sie sitzt ihm wie
angegossen. Sudermann beherrscht die Mittel der
Bühne wie nach ihm keiner mehr: es fällt uns
wie Schuppen von den Augen, und wir bemerken
rückblickend, wie ost wir in den letzten Jahren
mit handwerklich nicht gekonnten Stücken abge-
füttert wurden. So wurde es geradezu zur Wohl-
tat, einmal wieder richtige, festgefügte Bühnen-
spannungen zu erleben; eine Handlung, die von
Anfang bis Ende interessiert und logisch weiter-
gesponnen ist und — Gottseidank! — gänzlich
problemlos. Gewiß: Sudermann ist kein „Dichter".
Aber ist er nicht etwas, was unserem Theater zur
Zeit mehr nottut? (Wie oft ist es denn vorge-
kommen, daß Dichter und Dramatiker zusammen-
traf? Und dann wurde ein ganz Großer draus.)
Hilpert kennt sein Volksbühnenpublikum und hat
den Riecher für das, was es braucht. Und setzt ihm
seine Stücke vor, w i e es sie braucht: er machte
mit fest zupackender Hand „Stein unter Steinen"
zum Volksstück. Aber wie subtil ist diese Inszenie-
rung durchgearbeitet: bei aller Schlichtheit, mit
der die Spieler geführt sind, ist doch überall ein
menschlich gütiges Herz zu spüren. Und so kommt
cs zu einem selbst hier draußen ungewöhnlich
tobenden Beifall: ein voller, ein berechtigter Er-
folg! Ihr jungen Dramatiker aber gehet hin und
lernt, wie man Stücke baut.
V/illlelrn Muckers
Anekdote
Generalprobe zu „Wallenstein" in unserem mitten in der
Stadt gelegenen Theater. Gegen ZL12 Uhr fährt ein be-
ladenes Leichenauto vor den Bühneneingang. Allgemeines,
ständig wachsendes Eetuschel im Personal, wer da wohl im
Theater gestorben sein könnte usw. usw. Der mit steinerner
Miene wartende Chauffeur gibt auf vorsichtige Fragen nicht
die geringste Antwort. Die Spannung wird immer größer.
Da plötzlich schwingt sich um schl Uhr unser zweiter Bassist,
Herr K., der im Schauspiel auch kleine Rollen übernehmen
muß und so auch im „Wallenstein" zu tun hatte, in größter
Eile auf den Bock (schlecht abgeschminkt, aber dafür in Geh-
rock und Zylinder) und in rasender Fahrt geht's davon.
Es ergab sich folgender Tatbestand: Herr K. hatte seine
sehr kleine Gage dadurch gestreckt, daß er mit einem
Beerdigungsinstitut einen Vertrag als „Leichensänger" ab-
geschlossen hatte. Da ihm aber mehrfach durch zu lange
Probendauer Honorare entgangen waren, hatte er kurzerhand
mit dem Chauffeur des Beerdigungsinstituts eine Art Rück-
versicherungsvertrag abgeschlossen, nach dem der Chauffeur
ihn mit der jeweils zu besingenden Leiche am Theater abzu-
holen hatte! Ein ganz richtiger Schluß: Es ist wohl mög-
lich, eine Beerdigung ohne Gesang stattfinden zu lasten, aber
ohne Leiche . . . .? W. A.
5
Herbert Wegehanpt, Wandbild-Entwurs. Wettbewerb der Deutschen Arbeitsfront
Leonhardt Schmidt, Überführung
durch, wo Fleischfarbe hinkommcn sott. Dann fahre mit
spitzigem Haarpinsel alle Konturen genau nach, Nase, Augen,
Lippen und Ohren, mit demselben „Verdaccio". Es gibt
heute gewisse Meister, die, wenn sie beim Malen eines Ge-
sichtes soweit fortgeschritten sind, ein wenig mit Wasser ver-
dünntes Sankt-Johannes-Weih nehmen und damit die er-
habensten Stellen und höchsten Lichter des Gesichtes der Reihe
nach übergehen, dann Lippen und Wangen ein wenig röten
und zuletzt mit einem stark verdünnten Fleischton darüber
aquarellieren und so ist dann das Gesicht ordentlich koloriert.
Es ist aber eine gute Gewohnheit, zum Schluß die hellsten
Stellen nochmals mit etwas Sankt-Johannes-Weiß hervorzu-
heben. Andere geben dem Gesicht zuerst einen Flcischton,
schattieren dann mit etwas Verdaccio und Fleischfarbe, setzen
mit Weih ein paar Lichter auf und begnügen sich damit.
Das ist aber die Methode derer, die wenig von der Kunst
verstehen. Du aber halte dich an die Malweise, die ich
dir zeigen will, denn auch der große Meister Giotto be-
diente sich ihrer. Vierundzwanzig Jahre war Taddeo Eaddi,
der Florentiner, Eiottos Schüler, er wurde auch von ihm
aus der Taufe gehoben; Taddeo hatte seinen eigenen Sohn
Agnolo zum Schüler, bei Agnolo war ich zwölf Jahre in
der Lehre, und der führte mich in diese Malweise ein. Ge-
sagt sei noch, daß Agnolo viel schöner und frischer malte als
sein Vater Taddeo. — Gib also zuerst in ein Gefäß etwas
<Sankt-Johannes-Weib; ein klein wenig genügt schon und etwas
Helle Cinabrese, ungefähr in der gleichen Quantität, und ver-
dünne die Mischung reichlich mit reinem Wasser, fahre mit
einem weichen Borstenpinsel, den du gut zwischen
Daumen und Zeigefinger ausgedrückt
h a st, über das Gesicht, nachdem du es mit grüner Erde
schattiert hast, und mit jenem Rosa streiche über die Lippen
und „Äpfelchen" der Wangen. — Mein Meister pflegte diese
Bäckchen mehr gegen die Ohren als gegen die Nase hin zu
setzen, weil sie so zum Relief
des Gesichtes beitragen. Ver-
treibe sie aber gut nach allen
Seiten hin. Dann richte in drei
Töpfchen drei verschiedene
Nuancen Fleischfarbe her,
deren dunkelste um die Hälfte
Heller sein muß als das (Lip-
pen- und Wangen-)Rosa und
die anderen zwei wieder je um
einen Grad Heller. Tauche zu-
erst einen weichen, stumpfen
Pinsel in das Töpfchen mit dem
hellsten Ton, drücke ihn
gut mit den Fingern
aus und fahre über die Licht-
stellen des Gesichtes; nimm dann
das Töpfchen mit dem Mittelton
und mache damit die Halbtöne
von Gesicht, Händen, Füßen
und der Brust, wenn du einen
Akt malst. Dann nimm das
Töpfchen mit dem dritten Ton
und fahre über die Schatten-
partien, aber darauf achtend,
daß die grüne Erde gegen die
Konturen hin nicht ganz
ihren Tonwert ein-
büßt. Wiederhole dies mehr-
mals, indem du den einen
Fleischton in den andern ver-
treibst, bis das Gesicht so gut
bemalt ist, als die Natur der
Sache es erlaubt. Gib gut acht,
wenn du haben willst, daß deine
Arbeit in schönster Frische er-
glänze, daß dein Pinsel sich nicht
verirrt und du den einen Fleisch-
ton dahin malst, wo ein anderer
hinkommen sollte, es sei denn,
um geschickt den einen Ton in
den anderen zu verschmelzen.
Aber dies alles wird dir besser
einleuchten, wenn du selber bei
der Arbeit bist und du deine
Hand übst, als jetzt, da es ge-
schrieben vor dir steht. Hast du
deinem Gesicht die Fleischtöne
gegeben, dann mische dir einen
Ton, der noch viel Heller ist,
beinahe weiß, und mache damit die Lichter auf der Stirne über
den Brauen, auf dem Nasenrücken, auf der höchsten Stelle
des Kinnes und auf den Ohrmuscheln. Mit einem f a st
trockenemHaarpinsel
male dann mit reinem Weiß
das Weiß der Augen, das Licht-
lein auf der Nasenspitze und
einige Stellen am Mundrande,
aber ganz fein und zart. Nimm
dann in einem anderen Töpf-
chen etwas Schwarz und kon-
turiere mit dem gleichen Pinsel
den Unterrand der oberen
Augenlider über den Augen-
lichtchen und mache die Nasen-
und Ohrenlöcher. Dann nimm
ein Töpchen mit etwas dunkler
Sinopia und bemale den Rand
der unteren Augenlider, die
Nasenflügel, die Augenbrauen
und den Mund. Schattiere ein
wenig die Oberlippe, welche
etwas dunkler sein soll als die
Unterlippe. Aber bevor du so
die Konturen anziehst, nimm
mit dem gleichen Pinsel die
Haare nochmals in Angriff, zu-
erst mit Verdaccio, dann mit
Weiß und lasiere sie darauf mit
einem Eoldockerton, wozu du
den gleichen stumpfen Borsten-
pinsel benützen sollst, wie bei
den Fleischtönen. Verstärke
mittelst des gleichen Pinsels
die Haare gegen die Außen-
konturen hin mit dunklem Ocker
und Helle nochmals mittelst
eines spitzigen Haarpinsels die
auf den Haaren befindlichen
Lichter mit Hellem Ocker und
Sankt-Johann-Weiß auf. Wie
du überall im Gesichte von der
(dunklen) Sinopia Gebrauch
gemacht hast, so wende diese
Farbe auch beim Bemalen der
Umrisse und äußeren Partien
der Haare an. — Und nun
weißt du genug, um ein
jugendliches Gesicht malen zu
können^!
° Nicht umsonst gibt
Cennini immer wieder an,
man solle den Pinsel aus-
drücken, bevor man die
Farbe aufträgt. Er will bloß
ein leichtes Kolorieren des
Grundes. Die Freskotechnik
der Giotto-Schule ist eine
Lasurtechnik mit puren
und deckenden Farben, im
Gegensatz zu derjenigen der
späteren Schulen, die ihre
Farben pastoser auftrugen. Für
Unerfahrene empfiehlt es sich, anfangs bloß mit puren
Farben zu arbeiten, ohne Zusatz von Weiß, indem man
aquarellierend vorgeht. Sie werden dann beim Trocknen
kaum Heller und man kann ganz tiefe satte Töne erreichen,
was den nordeuropäischen Milieus besser entspricht.
Der Stuttgarter Maler
Leonhardt Schmidt
Leonhardt Schmidt ist blntmäßig kein reiner
Schwabe. Sein Großvater, den er gemalt hat mit
dem Kopfe eines Lohans, ist aus Tirol zngewan-
dert, lind er selbst ist in Backnang geboren, also
in einer Gegend, wo Fränkisches sich bereits mit
Schwäbischem zu mischen beginnt. Als Dekoca-
tionsmalergeselle wanderte er ins Rheinland,
später verbrachte er einige Jahre in Hofheim im
Taunus. Im Jahre 1892 geboren, wurde er
25 Jahre alt, bis sich für ihn die Möglichkeit er-
gab, bis er den Mut fand, sich im Bilde auszu-
sprechen. Dadurch blieb ihm die kostbare Naivi-
tät erhalten, die anderen durch die Exerzitien der
Malklassen ost genug verdorben wird. Es erwies
sich, daß er nichts lernen brauchte, daß er im
Grunde alles schon konnte. Und seit Jahren ist
er nun schicksalhaft verbunden mit Stuttgart, mit
seinen Straßen und seinen lebenstüchtigen Men-
schen, die ihm doch wie unter dem Schatten eines
Fatums erscheinen. Hier ist der geistige Raum,
der ihn Prägt und den er Prägt.
Wer diesem Maler nahekommen will, muß
brechen mit vergleichsweise groben und eiteln Vor-
stellungen über Kunst, die noch heute in aller
Munde sind. Daß eine impressionistische Einstel-
lung für ihn gar nicht in Frage kommt, ist selbst-
verständlich und würde heute wenig bedeuten, wo
sich der Umschwung längst auf der ganzen Linie
vollzieht. Wo aber andere sachlich sind, da ist
Schmidt tief. Der Begriff der Realität existiert
für ihn nicht, so wenig wie alles Bildungsmäßige.
Dieser Maler hat keinen Goethe gelesen, aber
Meister Ekkehardt, Buddha oder Laotse empfindet
er unmittelbar als Geistesverwandte. Es gibt
bei ihm keine Trennung einzelner Tätigkeiten, so
wenig wie die von Ich und Welt. Für ihn ist
Malen wortwörtlich mit Leben gleichgesetzt. Ein
Mensch bedeutet ihm etwas, wenn er ihn malen
kann. Malen im Sinne eines Hineingehens und
Hindurchgehens durch die Erscheinung. Er will
ein inneres Bild sichtbar machen, das doch zu-
gleich die höhere Wirklichkeit selbst ist. Versenkung
ist daher der Zentralbegriff und Quelle seiner
Malerei und von Offenbarung zu reden ist ihm
erlaubt, weil seine Kunst diese Ausdrucksweise
rechtfertigt.
Nicht das pralle Sonnenlicht, sondern der
Abend und der Morgen, wenn Häuser und Berge
schemenhaft und doch bestimmt erscheinen, schenken
ihm seine besten Bilder. Ein paar Flächen, ein
Rot, ein Schwarz, ein blasses Weiß, ein trauriges
Grau, das ist alles. Aber auf schlichte Weise wird
hier an Unaussprechliches gerührt, weil seine
Malerei sich gründet in der unbegreiflichen Tiefe
der räumlichen Anschauung als wirklichem Er-
lebnis und als der Quelle aller wahren Malerei.
So ist Regen für ihn Musik und Schnee ein Ge-
heimnis, in dem die lautlose Hand Gottes spür-
bar wird. Und darum sind seine Bilder wie zarte
Leonhardt Schmidt, Mährische Landschaft. Stuttgart, Galerie
Paul Hensel-Haedrich: „Sonnenwende"
Württ. Staatstheater, Stuttgart
Eine bedeutsame Uraufführung ereignete sich
ans den Brettern des Stuttgarter Staatstheaters:
das voil der Deutscheu Nationalbühne preisge-
krönte Schauspiel „Souneuwende" wurde aus der
Taufe und mit eiuem guteu Erfolg der Verfasser,
Paul Heusel-Haedrich, aus den Reihen der Un-
bekannten herausgehoben. Es ist erstaunlich, wie-
viel eindringliche Gestaltungskraft und sicheren
Theaterinstinkt dieser thüringische Bailernsohn,
per zwar weit in der Welt herumgekommen ist,
aber doch keinerlei „bühnentechnische" Vorbildung
hat, mitbringt, um die dramatische Handlung und
einen flüssigen Dialog zu gestalten.
Die Handlung liegt im schicksalsschweren Jahr
1932, in der geschichtlichen und sommerlichen Zeit
der Sonnenwende. Der junge Gastwirtssohn ans
der Kommnnistenkneipe, der — selbst dieser Rich-
tung widerstrebend — auf Befehl des Vaters an
der Flugschriftverteiluug der Notsrout teilnehmen
muß, wird Zeuge eines Polizistenmordes. Seine
wahrheitsliebende gläubige Natur möchte die
Wahrheit bekennen, aber das ihm von der Partei
des Vaters anfgezwnngene falsche Schamgefühl
eines Verräters und das Mitleid mit dem be-
dauernswerten alten Vater des Mörders lassen
ihn den folgenschweren Meineid leisten. Noch
scheint ihm das Glück hold zu sein, die jnnge Pro-
fessorentochter erwirkt seine Ausnahme in den
Sonnwendbund der Gymnasiasten und möchte ihm
so ans den klaren und reinen Weg helfen. Er
sieht sich beglückt als Glied in den Reihen der
Jugend, die Deutschland zu einer neuen Zukunft,
zu Freiheit und Einigkeit führen wollen, da er-
eilt ihn das Schicksal in Gestalt einer verzweifelten
Geliebten, der Kellnerin ans der väterlichen
Kneipe, die ihn des Meineids denunziert. Dem
aus den Höhen einer beglückenden Zukunft in den
Abgrund der Verzweiflung gestürzten bleibt nur
noch der Selbstmord, der in den beteiligten Er-
wachsenen die bitteren Selbstvorwürfe einer irre-
geleiteten Jugend zurückläßt.
Die zweifache Tendenz des Stückes — Sonnen-
wende: Zeitenwende — Schicksalswende! — ist gut
nebeneinander durchgeführt. Die gcsuude Kraft
der Jugend, die sich gegen die staatsfeindlichen
Elemente durchsetzt, ist bestimmt, die Zukunft des
deutschen Reiches zu bauen und es einer Zeiten-
wende znzuführen, und die Umkehr des verbitter-
ten alten Vaters, der am Totenbett seines Sohnes
aus der Gottesverleugnung zum rechten Glauben
und zum echten Vaterlandsgefühl zurückkehrt, ist
Schicksalswende. Der Konflikt beider ist der
Untergang des jungen Helden, dessen Streben nach
Reinheit und Wahrheit durch ein allzn weiches
innerlich haltloses Gemüt zu Fall gebracht wird.
Das echte stark empfundene Gefühl des Ver-
fassers klingt überall dnrch, wenn ihm auch die
drei letzten Bilder weniger gelungen sind und nicht
halten, was die beiden ersten versprechen, da sie
durch epische Breite und einen zu starken Schuß
Sentimentalität in die Länge gezogen und unkon-
zentriert werden. Dagegen sind die beiden ersten
Bilder, namentlich in den kräftigen und lebhaften
Kneipenszenen, der Beweis einer ausgesprochenen
Begabung, von der man noch manches erwarten
darf, und die Deutsche Nationalbühne hat mit
diesem Stück eine kluge Entscheidung bewiesen.
Nach der erfolgreichen Aufführung, die durch
eine geschickte Regie und eine außerordentlich gute
Darstelluug unterstrichen wurde, überreichte Kul-
tusminister Mergenthaler dem Autor persön-
lich den Dichterpreis mit Worten des Dankes und
der Verbundenheit. Das Publikum rief Autor
und Darsteller vielfach und dankte dem Preis-
gericht der Nationalbühne für seine anerkennens-
werte Tat. 2. Obrista
Mingers „Stille Gäste"
ein Dialekt-, kein Volksstück
Das Deutsche Theater in Berlin
brachte uns nach der Uraufführung in Leipzig
Billingers „Komödie" „Stille Gäste". Nach dem
außerordentlich starken Eindruck, den vor etwa
Jahresfrist die „Rauhnacht" im Staatstheater ge-
macht hatte, war die Spannung groß, wie sich
Billinger, der sich in „Rauhnacht" als Gestalter
des Dämonischen von dichterischer Kraft erwiesen
hatte, mit einem Komödienstoff abfinden würde.
Aber ach: er nennt sein Stück nur „Komödie", iu
Wirklichkeit ist uus das Heulen oft näher als das
Lachen. Und zurück bleibt im Zuschauer ein höchst
unbehagliches Gefühl: wohin zielt Billinger
eigentlich? Wen will er treffen? Wahrscheinlich
weiß er das selbst nicht. Denn dem Stück haften
alle Mängel des unbekümmert Hingeschriebenen
an. Die „Stillen Gäste" sind Geister in Rokoko-
Kostümen, die in einem ländlichen Barockschlöß-
chen auf ihre Erlösung durch ein wahrhaft lieben-
des Paar warten. Aber während in „Rauhnacht"
das Hineinspielen des Dämonischen in die Hand-
lung dichterisch gestaltet ist, versagt hier Billingers
Phantasie vollständig: die ganze Geisteraffäre wird
zu leerem Theater und bleibt daher peinlich
wirkungslos. Dem „Geister-Milieu" gegenüber
steht dann eine seltene Auslese von Bauern, die
(trotzdem sie in der Aufführung des Deutschen
Theaters ausgezeichneten Dialekt sprachen) keine
sind. Diese Figuren (Menschen möchte ich sie nicht
nennen, weil einzig die bucklige Hedwig einen
Hauch rührender Menschlichkeit empfangen hat)
leben alle in einer nervösen Überreiztheit, einer
hysterischen Hochspannung infolge sexueller Ver-
drängungen (im Parkett fiel ein Witzwort von
„notleidenden Sexualagrariern"). Die von Bil-
linger daraus gewonnenen Heiterkeitsmomente
wirken nicht befreiend, sondern Peinlich verstim-
mend. Diesen Bauern gegenüber stehen wieder
Lustspielfiguren ältester Schablone wie der Baron
Nepomuk und seine Braut. Selbst bei der Posse
werden unbedenklich Anleihen gemacht: eine irre
Sommerfrischlern! („Irre sind der verlängerte
Finger Gottes" sagt sie einmal von sich) schleicht
als Schemen durch das Stück.
Wareu in „Rauhnacht" dramaturgische
Schwächen verdeckt durch die Kraft der Charakter-
gestaltung, so liegen sie hier offen zu Tage. So
groß seiue Beobachtungsgabe im einzelnen ist: im
Bau des Stückes versagt Billinger durchaus. Er
war uach „Rauhnacht" eine Hoffnung. Wird er
sich auf die zweifellos in ihm steckende dichterische
Begabung besinnen? Es läge sonst die Gefahr vor,
daß auch er in einer (als Ersatz für eine verflossene
Asphalt-Literatur?) sich unangenehm breitmachen-
den Schollen-Literatur versandet.
Sudermanns „Stein unter Steinen"
ein Volksstück!
Eine durchaus angenehme Enttäuschung be-
deutet hingegen die Begegnung mit dem viel ver-
lästerten Sudermann. Die „Kriegsgeneration"
kennt ihn in den letzten Vorkriegsjahren allenfalls
noch aus „Schmetterlingsschlacht" oder „Heimat".
Nach dem Krieg wurde er kaum noch aufgeführt.
Doch Hilpert wies in einer außerordentlich schönen
Inszenierung nach, wieviel Leben in diesem Stücke-
schreiber noch steckt. Wieviel ehrliches Handwerk
enthält dieses Stück! Diese Menschen reden alle,
wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Man hat
das Gefühl: der Schauspieler braucht bloß in so
eine Rolle hineinzuschlüpsen, und sie sitzt ihm wie
angegossen. Sudermann beherrscht die Mittel der
Bühne wie nach ihm keiner mehr: es fällt uns
wie Schuppen von den Augen, und wir bemerken
rückblickend, wie ost wir in den letzten Jahren
mit handwerklich nicht gekonnten Stücken abge-
füttert wurden. So wurde es geradezu zur Wohl-
tat, einmal wieder richtige, festgefügte Bühnen-
spannungen zu erleben; eine Handlung, die von
Anfang bis Ende interessiert und logisch weiter-
gesponnen ist und — Gottseidank! — gänzlich
problemlos. Gewiß: Sudermann ist kein „Dichter".
Aber ist er nicht etwas, was unserem Theater zur
Zeit mehr nottut? (Wie oft ist es denn vorge-
kommen, daß Dichter und Dramatiker zusammen-
traf? Und dann wurde ein ganz Großer draus.)
Hilpert kennt sein Volksbühnenpublikum und hat
den Riecher für das, was es braucht. Und setzt ihm
seine Stücke vor, w i e es sie braucht: er machte
mit fest zupackender Hand „Stein unter Steinen"
zum Volksstück. Aber wie subtil ist diese Inszenie-
rung durchgearbeitet: bei aller Schlichtheit, mit
der die Spieler geführt sind, ist doch überall ein
menschlich gütiges Herz zu spüren. Und so kommt
cs zu einem selbst hier draußen ungewöhnlich
tobenden Beifall: ein voller, ein berechtigter Er-
folg! Ihr jungen Dramatiker aber gehet hin und
lernt, wie man Stücke baut.
V/illlelrn Muckers
Anekdote
Generalprobe zu „Wallenstein" in unserem mitten in der
Stadt gelegenen Theater. Gegen ZL12 Uhr fährt ein be-
ladenes Leichenauto vor den Bühneneingang. Allgemeines,
ständig wachsendes Eetuschel im Personal, wer da wohl im
Theater gestorben sein könnte usw. usw. Der mit steinerner
Miene wartende Chauffeur gibt auf vorsichtige Fragen nicht
die geringste Antwort. Die Spannung wird immer größer.
Da plötzlich schwingt sich um schl Uhr unser zweiter Bassist,
Herr K., der im Schauspiel auch kleine Rollen übernehmen
muß und so auch im „Wallenstein" zu tun hatte, in größter
Eile auf den Bock (schlecht abgeschminkt, aber dafür in Geh-
rock und Zylinder) und in rasender Fahrt geht's davon.
Es ergab sich folgender Tatbestand: Herr K. hatte seine
sehr kleine Gage dadurch gestreckt, daß er mit einem
Beerdigungsinstitut einen Vertrag als „Leichensänger" ab-
geschlossen hatte. Da ihm aber mehrfach durch zu lange
Probendauer Honorare entgangen waren, hatte er kurzerhand
mit dem Chauffeur des Beerdigungsinstituts eine Art Rück-
versicherungsvertrag abgeschlossen, nach dem der Chauffeur
ihn mit der jeweils zu besingenden Leiche am Theater abzu-
holen hatte! Ein ganz richtiger Schluß: Es ist wohl mög-
lich, eine Beerdigung ohne Gesang stattfinden zu lasten, aber
ohne Leiche . . . .? W. A.