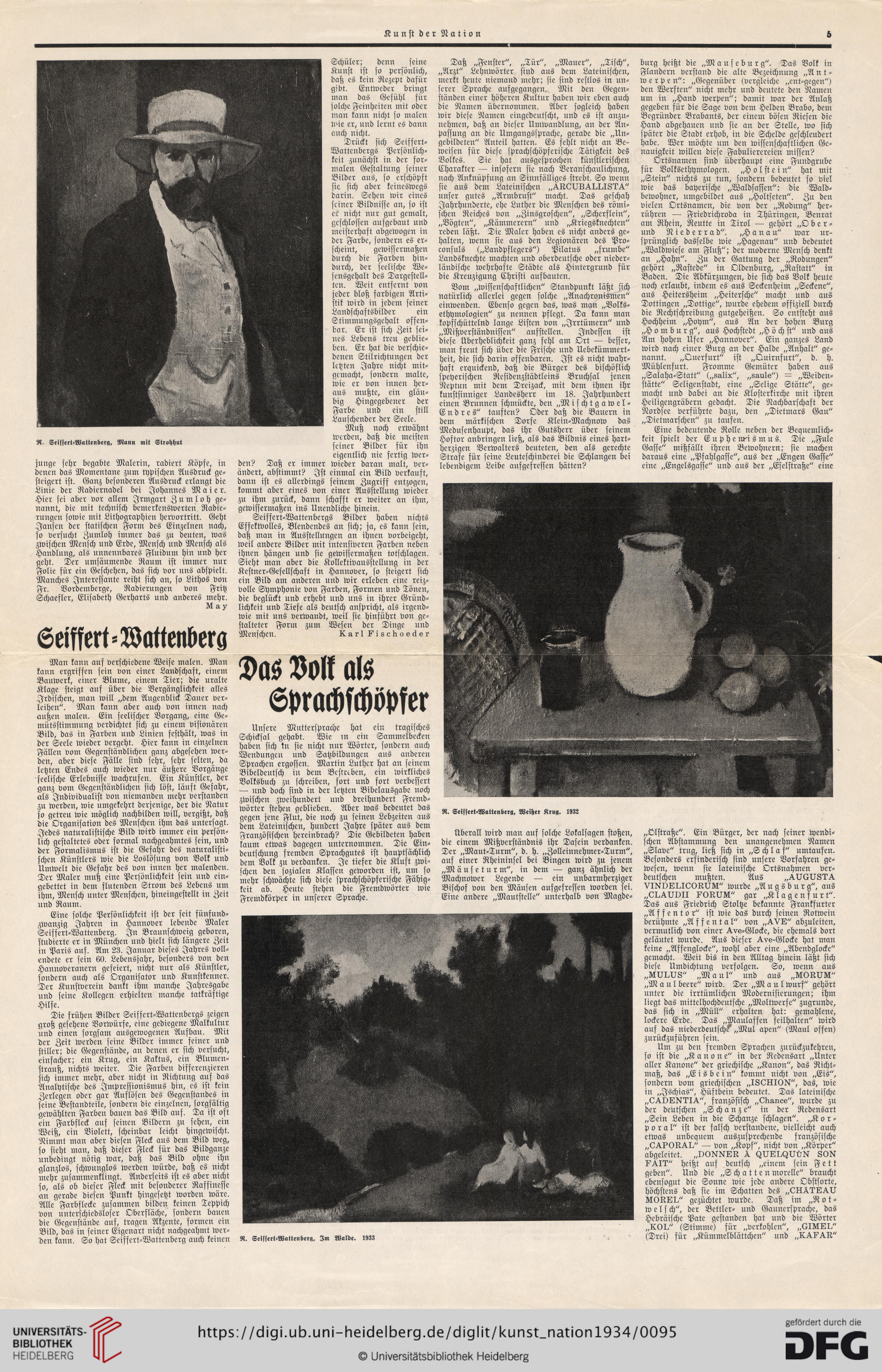Kunst der Nation
ü
R. Seiffert-Wattenberg, Mann mit Strohhut
junge sehr begabte Malerin, radiert Köpfe, in
denen das Momentane zum typischen Ausdruck ge-
steigert ist. Ganz besonderen Ausdruck erlangt die
Linie der Radiernadel bei Johannes Maier.
Hier sei aber vor allem Jrmgart Zum loh ge-
nannt, die mit technisch bemerkenswerten Radie-
rungen sowie mit Lithographien hervortritt. Geht
Jansen der statischen Form des Einzelnen nach,
so versucht Zumloh immer das zu deuten, was
zwischen Mensch und Erde, Mensch und Mensch als
Handlung, als unnennbares Fluidum hin und her
geht. Der umsäumende Raum ist immer nur
Folie für ein Geschehen, das sich vor uns abspielt.
Manches Interessante reiht sich an, so Lithos von
Fr. Vordemberge, Radierungen von Fritz
Schaefler, Elisabeth Gerharts und anderes mehr.
Seiffert-Wattenberg
Schüler; denn seine
Kunst ist so persönlich,
daß es kein Rezept dafür
gibt. Entweder bringt
man das Gefühl für
solche Feinheiten mit oder
man kann nicht so malen
wie er, und lernt es dann
auch nicht.
Drückt sich Seiffert-
Wattenbergs Persönlich-
keit zunächst in der for-
malen Gestaltung seiner
Bilder aus, so erschöpft
sie sich aber keineswegs
darin. Sehen wir eines
seiner Bildnisse an, so ist
es nicht nur gut gemalt,
geschlossen aufgebaut und
meisterhaft abgewogen in
der Farbe, sondern es er-
scheint, gewissermaßen
durch die Farben hin-
durch, der seelische We-
sensgehalt des Dargestell-
ten. Weit entfernt von
jeder bloß farbigen Arti-
stik wird in jedem seiner
Landschaftsbilder ein
Stimmungsgehalt offen-
bar. Er ist sich Zeit sei-
nes Lebens treu geblie-
ben. Er hat die verschie-
denen Stilrichtungen der
letzten Jahre nicht mit-
gcmacht, sondern malte,
wie er von innen her-
aus mußte, ein gläu-
big Hingegebener der
Farbe und ein still
Lauschender der Seele.
Muß noch erwähnt
werden, daß die meisten
seiner Bilder für ihn
eigentlich nie fertig wer-
den? Daß er immer wieder daran malt, ver-
ändert, abstimmt? Ist einmal ein Bild verkauft,
dann ist es allerdings seinem Zugriff entzogen,
kommt aber eines von einer Ausstellung wieder
zu ihm zurück, dann schafft er weiter an ihm,
gewissermaßen ins Unendliche hinein.
Seiffert-Wattenbergs Bilder haben nichts
Effektvolles, Blendendes an sich; ja, es kann sein,
daß man in Ausstellungen an ihnen vorbeigeht,
weil andere Bilder mit intensiveren Farben neben
ihnen hängen und sie gewissermaßen totschlagen.
Sieht man aber die Kollektivausstellung in der
Kestner-Gesellschaft in Hannover, so steigert sich
ein Bild am anderen und wir erleben eine reiz-
volle Symphonie von Farben, Formen und Tönen,
die beglückt und erhebt und uns in ihrer Gründ-
lichkeit und Tiefe als deutsch anspricht, als irgend-
wie mit uns verwandt, weil sie hinführt von ge-
stalteter Form zum Wesen der Dinge und
Menschen. Lari Liselloackar
Man kann auf verschiedene Weise malen. Man
kann ergriffen sein von einer Landschaft, einem
Bauwerk, einer Blume, einem Tier; die uralte
Klage steigt aus über die Vergänglichkeit alles
Irdischen, man will „dem Augenblick Dauer ver-
leihen". Man kann aber auch von innen nach
außen malen. Ein seelischer Vorgang, eine Ge-
mütsstimmung verdichtet sich zu einem visionären
Bild, das in Farben und Linien festhält, was in
der Seele wieder vergeht. Hier kann in einzelnen
Fällen vom Gegenständlichen ganz abgesehen wer-
den, aber diese Fälle sind sehr, sehr selten, da
letzten Endes auch wieder nur äußere Vorgänge
seelische Erlebnisse wachrufen. Ein Künstler, der
ganz vom Gegenständlichen sich löst, läuft Gefahr,
als Individualist von niemanden mehr verstanden
zu werden, wie umgekehrt derjenige, der die Natur
so getreu wie möglich nachbilden will, vergißt, daß
die Organisation des Menschen ihm das untersagt.
Jedes naturalistische Bild wird immer ein persön-
lich gestaltetes oder formal nachgeahmtes sein, und
der Formalismus ist die Gefahr des naturalisti-
schen Künstlers wie die Loslösung von Volk und
Umwelt die Gefahr des von innen her malenden.
Der Maler muß eine Persönlichkeit sein und ein-
gebettet in dem flutenden Strom des Lebens um
ihm, Mensch unter Menschen, hineingestellt in Zeit
und Raum.
Das Volk als
Sprachschöpfer
Unsere Muttersprache hat ein tragisches
Schicksal gehabt. Wie in ein Sammelbecken
haben sich kn sie nicht nur Wörter, sondern auch
Wendungen und Satzbildungcn aus anderen
Sprachen ergossen. Martin Luther hat an seinem
Bibeldeutsch in dem Bestreben, ein wirkliches
Volksbuch zu schreiben, fort und fort verbessert
— und doch sind in der letzten Bibelausgabe noch
zwischen zweihundert und dreihundert Fremd-
wörter stehen geblieben. Aber was bedeutet das
gegen jene Flut, die noch zu seinen Lebzeiten aus
dem Lateinischen, hundert Jahre später aus dem
Französischen hereinbrach? Die Gebildeten haben
kaum etwas dagegen unternommen. Die Ein-
deutschung fremden Sprachgutes ist hauptsächlich
dem Volk zu verdanken. Je tiefer die Kluft zwi-
schen den sozialen Klassen geworden ist, um so
mehr schwächte sich diese sprachschöpferische Fähig-
keit ab. Heute stehen die Fremdwörter wie
Fremdkörper in unserer Sprache.
Daß „Fenster", „Tür", „Mauer", „Tisch",
„Arzt" Lehnwörter sind aus dem Lateinischen,
merkt heute niemand mehr; sie sind restlos in un-
serer Sprache ausgegangen. Mit den Gegen-
ständen einer höheren Kultur haben wir eben auch
die Namen übernommen. Aber sogleich haben
wir diese Namen eingedeutscht, und es ist anzu-
nehmen, daß an dieser Umwandlung, an der An-
passung an die Umgangssprache, gerade die „Un-
gebildeten" Anteil hatten. Es fehlt nicht an Be-
weisen für diese sprachschöpferische Tätigkeit des
Volkes. Sie hat ausgesprochen künstlerischen
Charakter — insofern sie nach Veranschaulichung,
nach Anknüpfung an Sinnfälliges strebt. So wenn
sie aus dem Lateinischen
unser gutes „Armbrust" macht. Das geschah
Jahrhunderte, ehe Luther die Menschen des römi-
schen Reiches von „Zinsgroschen", „Scherflein",
„Vögten", „Kämmerern" und „Kriegsknechten"
reden läßt. Die Maler haben es nicht anders ge-
halten, wenn sie aus den Legionären des Pro-
consuls („Landpflegers") Pilatus „srumbe"
Landsknechte machten und oberdeutsche oder nieder-
ländische wehrhafte Städte als Hintergrund für
die Kreuzigung Christi aufbauten.
Vom „wissenschaftlichen" Standpunkt läßt sich
natürlich allerlei gegen solche „Anachronismen"
einwenden. Ebenso gegen das, was man „Volks-
ethymologien" zu nennen Pflegt. Da kann man
kopfschüttelnd lange Listen von „Irrtümern" und
„Mißverständnissen" aufstellen. Indessen ist
diese Überheblichkeit ganz fehl am Ort — besser,
man freut sich über die Frische und Uebekümmert-
heit, die sich darin offenbaren. Ist es nicht wahr-
haft erquickend, daß die Bürger des bischöflich
speyerischen Residenzstädtleins Bruchsal jenen
Neptun mit dem Dreizack, mit dem ihnen ihr
kunstsinniger Landesherr im 18. Jahrhundert
einen Brunnen schmückte, den „M ischtgawel -
Endres" tauften? Oder daß die Bauern in
dem märkischen Dorfe Klein-Machnow das
Medusenhaupt, das ihr Gutsherr über seinem
Hoftor anbringen ließ, als das Bildnis eines hart-
herzigen Verwalters deuteten, den als gerechte
Strafe für seine Leuteschinderei die Schlangen bei
lebendigem Leibe aufgefressen hätten?
bürg heißt die „M a u s e b u r g". Das Volk in
Flandern verstand die alte Bezeichnung „Ant-
werpen": „Gegenüber (vergleiche „ent-gegen")
den Werften" nicht mehr und deutete den Namen
um in „Hand werpen"; damit war der Anlaß
gegeben für die Sage von dem Helden Brabo, dem
Begründer Brabants, der einem bösen Riesen die
Hand abgehauen und sie an der Stelle, wo sich
später die Stadt erhob, in die Schelde geschleudert
habe. Wer möchte um den wissenschaftlichen Ge-
nauigkeit willen diese Fabulierereien missen?
Ortsnamen sind überhaupt eine Fundgrube
für Volksethymologen. „Holstein" hat mit
„Stein" nichts zu tun, sondern bedeutet so viel
wie das bayerische „Waldsassen": die Wald-
bewohner, umgebildet aus „Holtseten". Zu den
vielen Ortsnamen, die von der „Rodung" her-
rühren — Friedrichroda in Thüringen, Benrat
am Rhein, Reutte in Tirol — gehört „Ober-
und Niederra d". „Hana u" war ur-
sprünglich dasselbe wie „Hagenau" und bedeutet
„Waldwiese am Fluß"; der moderne Mensch denkt
an „Hahn". Zu der Gattung der „Rodungen"
gehört „Rastede" in Oldenburg, „Rastatt" in
Baden. Die Abkürzungen, die sich das Volk heute
noch erlaubt, indem es aus Seckenheim „Seckene",
aus Heitersheim „Heitersche" macht und aus
Döttingen „Dottige", wurde ehedem offiziell durch
die Rechtschreibung gutgeheißen. So entsteht aus
Hochheim „Hoym", aus An der hohen Burg
„Hombur g", aus Hochstedt „H ö ch st" und aus
Am hohen Ufer „Hannover". Ein ganzes Land
wird nach einer Burg an der Halde „Anhalt" ge-
nannt. „Querfurt" ist „Quirnfurt", d. h.
Mühlenfurt. Fromme Gemüter haben aus
„Salaha-Statt" („salix", „saule") — „Weiden-
stätte" Seligenstadt, eine „Selige Stätte", ge-
macht und dabei an die Klosterkirche mit ihren
Heiligengräbern gedacht. Die Nachbarschaft der
Nordsee verführte dazu, den „Dietmars Gau"
„Dietmarschen" zu taufen.
Eine bedeutende Rolle neben der Bequemlich-
keit spielt der Euphemismus. Die „Fule
Gasse" mißfällt ihren Bewohnern; sie machen
daraus eine „Pfahlgasse", aus der „Engen Gasse"
eine „Engelsgasse" und aus der „Eselstraße" eine
R. Seiffert-Wattenberg, Weitzer Krug. 1932
Überall wird man auf solche Lokalsagen stoßen,
die einem Mißverständnis ihr Dasein verdanken.
Der „Maut-Turm", d. h. „Zolleinnehmer-Turm",
aus einer Rheininsel bei Bingen wird zu jenem
„Mäuse türm", in dem — ganz ähnlich der
Machnower Legende — ein unbarmherziger
Bischof von den Mäusen ausgefressen worden sei.
Eine andere „Mautstelle" unterhalb von Magde-
„Ölstraße". Ein Bürger, der nach seiner wendi-
schen Abstammung den unangenehmen Namen
„Slave" trug, ließ sich in „Schlaf" umtaufen.
Besonders erfinderisch find unsere Vorfahren ge-
wesen, wenn sie lateinische Ortsnahmen ver-
deutschen mußten. Aus ,AH6II8'I'^
VINVLUI60UHU" wurde „Augsbur g", aus
LOUIIN" gar „Klagenfurt".
Das aus Friedrich Stoltze bekannte Frankfurter
Eine solche Persönlichkeit ist der seit fünfund-
zwanzig Jahren in Hannover lebende Maler
Seiffert-Wattenberg. In Braunschweig geboren,
studierte er in München und hielt sich längere Zeit
in Paris aus. Am 23. Januar dieses Jahres voll-
endete er sein 60. Lebensjahr, besonders von den
Hannoveranern gefeiert, nicht nur als Künstler,
sondern auch als Organisator und Kunstkenner.
Der Kunstverein dankt ihm manche Jahresgabe
und seine Kollegen erhielten manche tatkräftige
Hilfe.
Die frühen Bilder Seiffert-Wattenbergs zeigen
groß gesehene Vorwürfe, eine gediegene Malkultur
und einen sorgsam ausgewogenen Aufbau. Mit
der Zeit werden seine Bilder immer feiner und
stiller; die Gegenstände, an denen er sich versucht,
einfacher; ein' Krug, ein Kaktus, ein Blumen-
strauß, nichts weiter. Die Farben differenzieren
sich immer mehr, aber nicht in Richtung auf das
Analytische des Impressionismus hin, es ist kein
Zerlegen oder gar Auflösen des Gegenstandes in
seine Bestandteile, sondern die einzelnen, sorgfältig
gewählten Farben bauen das Bild auf. Da ist oft
ein Farbfleck auf seinen Bildern zu sehen, ein
Weiß, ein Violett, scheinbar leicht hingewischt.
Nimmt man aber diesen Fleck aus dem Bild weg,
so sieht man, daß dieser Fleck für das Bildganze
unbedingt nötig war, daß das Bild ohne ihn
glanzlos, schwunglos werden würde, daß es nicht
mehr zusammenklingt. Anderseits ist es aber nicht
so, als ob dieser Fleck mit besonderer Raffinesse
an gerade diesen Punkt hingesetzt worden wäre.
Alle' Farbflecke zusammen bilden keinen Teppich
von unterschiedsloser Oberfläche, sondern bauen
die Gegenstände auf, tragen Akzente, formen ein
Bild, das in seiner Eigenart nicht nachgeahmt wer-
den kann. So hat Seiffert-Wattenberg auch keinen
R. Seiffert-Wattenberg, Zm Walde. 1933
„Affentor" ist wie das durch seinen Rotwein
berühmte „Affental" von ,AVL" abzuleiten,
vermutlich von einer ^.ve-Glocke, die ehemals dort
geläutet wurde. Aus dieser ^.va-Glocke hat man
keine „Affenglocke", Wohl aber eine „Abendglocke"
gemacht. Weit bis in den Alltag hinein läßt sich
diese Umdichtung verfolgen. So, wenn aus
„NIITII8" „Maul" und aus
„Maulbeere" wird. Der „Maulwurf" gehört
unter die irrtümlichen Modernisierungen; ihm
liegt das mittelhochdeutsche „Moltwerfe" zugrunde,
das sich in „Müll" erhalten hat: gemahlene,
lockere Erde. Das „Maulaffen feilhalten" wird
aus das niederdeutsche „Mul apen" (Maul offen)
zurückzuführen sein.
Um zu den fremden Sprachen zurückzukehren,
so ist die „Kanone" in der Redensart „Unter
aller Kanone" der griechische „Kanon", das Richt-
maß, das „Eisbein" kommt nicht von „Eis",
sondern vom griechischen „I86HI(M", das, wie
in „Ischias", Hüftbein bedeutet. Das lateinische
französisch „Ollanea", wurde zu
der deutschen „Schanze" in der Redensart
„Sein Leben in die Schanze schlagen". „Kor-
poral" ist der falsch verstandene, vielleicht auch
etwas unbequem auszusprechende französische
— von „Kopf", nicht von „Körper"
abgeleitet. „VONNLU T HULUHIIVN 80N
heißt auf deutsch „einem sein Fett
geben". Und die „S ch a t t e n morelle" braucht
ebensogut die Sonne wie jede andere Obstsorte,
höchstens daß sie im Schatten des
N0RLU" gezüchtet wurde. Daß im „Rot-
welsch", der Bettler- und Gaunersprache, das
Hebräische Pate gestanden hat und die Wörter
„LOU" (Stimme) für „verkohlen", „OliVlLU"
(Drei) für „Kümmelblättchen" und
ü
R. Seiffert-Wattenberg, Mann mit Strohhut
junge sehr begabte Malerin, radiert Köpfe, in
denen das Momentane zum typischen Ausdruck ge-
steigert ist. Ganz besonderen Ausdruck erlangt die
Linie der Radiernadel bei Johannes Maier.
Hier sei aber vor allem Jrmgart Zum loh ge-
nannt, die mit technisch bemerkenswerten Radie-
rungen sowie mit Lithographien hervortritt. Geht
Jansen der statischen Form des Einzelnen nach,
so versucht Zumloh immer das zu deuten, was
zwischen Mensch und Erde, Mensch und Mensch als
Handlung, als unnennbares Fluidum hin und her
geht. Der umsäumende Raum ist immer nur
Folie für ein Geschehen, das sich vor uns abspielt.
Manches Interessante reiht sich an, so Lithos von
Fr. Vordemberge, Radierungen von Fritz
Schaefler, Elisabeth Gerharts und anderes mehr.
Seiffert-Wattenberg
Schüler; denn seine
Kunst ist so persönlich,
daß es kein Rezept dafür
gibt. Entweder bringt
man das Gefühl für
solche Feinheiten mit oder
man kann nicht so malen
wie er, und lernt es dann
auch nicht.
Drückt sich Seiffert-
Wattenbergs Persönlich-
keit zunächst in der for-
malen Gestaltung seiner
Bilder aus, so erschöpft
sie sich aber keineswegs
darin. Sehen wir eines
seiner Bildnisse an, so ist
es nicht nur gut gemalt,
geschlossen aufgebaut und
meisterhaft abgewogen in
der Farbe, sondern es er-
scheint, gewissermaßen
durch die Farben hin-
durch, der seelische We-
sensgehalt des Dargestell-
ten. Weit entfernt von
jeder bloß farbigen Arti-
stik wird in jedem seiner
Landschaftsbilder ein
Stimmungsgehalt offen-
bar. Er ist sich Zeit sei-
nes Lebens treu geblie-
ben. Er hat die verschie-
denen Stilrichtungen der
letzten Jahre nicht mit-
gcmacht, sondern malte,
wie er von innen her-
aus mußte, ein gläu-
big Hingegebener der
Farbe und ein still
Lauschender der Seele.
Muß noch erwähnt
werden, daß die meisten
seiner Bilder für ihn
eigentlich nie fertig wer-
den? Daß er immer wieder daran malt, ver-
ändert, abstimmt? Ist einmal ein Bild verkauft,
dann ist es allerdings seinem Zugriff entzogen,
kommt aber eines von einer Ausstellung wieder
zu ihm zurück, dann schafft er weiter an ihm,
gewissermaßen ins Unendliche hinein.
Seiffert-Wattenbergs Bilder haben nichts
Effektvolles, Blendendes an sich; ja, es kann sein,
daß man in Ausstellungen an ihnen vorbeigeht,
weil andere Bilder mit intensiveren Farben neben
ihnen hängen und sie gewissermaßen totschlagen.
Sieht man aber die Kollektivausstellung in der
Kestner-Gesellschaft in Hannover, so steigert sich
ein Bild am anderen und wir erleben eine reiz-
volle Symphonie von Farben, Formen und Tönen,
die beglückt und erhebt und uns in ihrer Gründ-
lichkeit und Tiefe als deutsch anspricht, als irgend-
wie mit uns verwandt, weil sie hinführt von ge-
stalteter Form zum Wesen der Dinge und
Menschen. Lari Liselloackar
Man kann auf verschiedene Weise malen. Man
kann ergriffen sein von einer Landschaft, einem
Bauwerk, einer Blume, einem Tier; die uralte
Klage steigt aus über die Vergänglichkeit alles
Irdischen, man will „dem Augenblick Dauer ver-
leihen". Man kann aber auch von innen nach
außen malen. Ein seelischer Vorgang, eine Ge-
mütsstimmung verdichtet sich zu einem visionären
Bild, das in Farben und Linien festhält, was in
der Seele wieder vergeht. Hier kann in einzelnen
Fällen vom Gegenständlichen ganz abgesehen wer-
den, aber diese Fälle sind sehr, sehr selten, da
letzten Endes auch wieder nur äußere Vorgänge
seelische Erlebnisse wachrufen. Ein Künstler, der
ganz vom Gegenständlichen sich löst, läuft Gefahr,
als Individualist von niemanden mehr verstanden
zu werden, wie umgekehrt derjenige, der die Natur
so getreu wie möglich nachbilden will, vergißt, daß
die Organisation des Menschen ihm das untersagt.
Jedes naturalistische Bild wird immer ein persön-
lich gestaltetes oder formal nachgeahmtes sein, und
der Formalismus ist die Gefahr des naturalisti-
schen Künstlers wie die Loslösung von Volk und
Umwelt die Gefahr des von innen her malenden.
Der Maler muß eine Persönlichkeit sein und ein-
gebettet in dem flutenden Strom des Lebens um
ihm, Mensch unter Menschen, hineingestellt in Zeit
und Raum.
Das Volk als
Sprachschöpfer
Unsere Muttersprache hat ein tragisches
Schicksal gehabt. Wie in ein Sammelbecken
haben sich kn sie nicht nur Wörter, sondern auch
Wendungen und Satzbildungcn aus anderen
Sprachen ergossen. Martin Luther hat an seinem
Bibeldeutsch in dem Bestreben, ein wirkliches
Volksbuch zu schreiben, fort und fort verbessert
— und doch sind in der letzten Bibelausgabe noch
zwischen zweihundert und dreihundert Fremd-
wörter stehen geblieben. Aber was bedeutet das
gegen jene Flut, die noch zu seinen Lebzeiten aus
dem Lateinischen, hundert Jahre später aus dem
Französischen hereinbrach? Die Gebildeten haben
kaum etwas dagegen unternommen. Die Ein-
deutschung fremden Sprachgutes ist hauptsächlich
dem Volk zu verdanken. Je tiefer die Kluft zwi-
schen den sozialen Klassen geworden ist, um so
mehr schwächte sich diese sprachschöpferische Fähig-
keit ab. Heute stehen die Fremdwörter wie
Fremdkörper in unserer Sprache.
Daß „Fenster", „Tür", „Mauer", „Tisch",
„Arzt" Lehnwörter sind aus dem Lateinischen,
merkt heute niemand mehr; sie sind restlos in un-
serer Sprache ausgegangen. Mit den Gegen-
ständen einer höheren Kultur haben wir eben auch
die Namen übernommen. Aber sogleich haben
wir diese Namen eingedeutscht, und es ist anzu-
nehmen, daß an dieser Umwandlung, an der An-
passung an die Umgangssprache, gerade die „Un-
gebildeten" Anteil hatten. Es fehlt nicht an Be-
weisen für diese sprachschöpferische Tätigkeit des
Volkes. Sie hat ausgesprochen künstlerischen
Charakter — insofern sie nach Veranschaulichung,
nach Anknüpfung an Sinnfälliges strebt. So wenn
sie aus dem Lateinischen
unser gutes „Armbrust" macht. Das geschah
Jahrhunderte, ehe Luther die Menschen des römi-
schen Reiches von „Zinsgroschen", „Scherflein",
„Vögten", „Kämmerern" und „Kriegsknechten"
reden läßt. Die Maler haben es nicht anders ge-
halten, wenn sie aus den Legionären des Pro-
consuls („Landpflegers") Pilatus „srumbe"
Landsknechte machten und oberdeutsche oder nieder-
ländische wehrhafte Städte als Hintergrund für
die Kreuzigung Christi aufbauten.
Vom „wissenschaftlichen" Standpunkt läßt sich
natürlich allerlei gegen solche „Anachronismen"
einwenden. Ebenso gegen das, was man „Volks-
ethymologien" zu nennen Pflegt. Da kann man
kopfschüttelnd lange Listen von „Irrtümern" und
„Mißverständnissen" aufstellen. Indessen ist
diese Überheblichkeit ganz fehl am Ort — besser,
man freut sich über die Frische und Uebekümmert-
heit, die sich darin offenbaren. Ist es nicht wahr-
haft erquickend, daß die Bürger des bischöflich
speyerischen Residenzstädtleins Bruchsal jenen
Neptun mit dem Dreizack, mit dem ihnen ihr
kunstsinniger Landesherr im 18. Jahrhundert
einen Brunnen schmückte, den „M ischtgawel -
Endres" tauften? Oder daß die Bauern in
dem märkischen Dorfe Klein-Machnow das
Medusenhaupt, das ihr Gutsherr über seinem
Hoftor anbringen ließ, als das Bildnis eines hart-
herzigen Verwalters deuteten, den als gerechte
Strafe für seine Leuteschinderei die Schlangen bei
lebendigem Leibe aufgefressen hätten?
bürg heißt die „M a u s e b u r g". Das Volk in
Flandern verstand die alte Bezeichnung „Ant-
werpen": „Gegenüber (vergleiche „ent-gegen")
den Werften" nicht mehr und deutete den Namen
um in „Hand werpen"; damit war der Anlaß
gegeben für die Sage von dem Helden Brabo, dem
Begründer Brabants, der einem bösen Riesen die
Hand abgehauen und sie an der Stelle, wo sich
später die Stadt erhob, in die Schelde geschleudert
habe. Wer möchte um den wissenschaftlichen Ge-
nauigkeit willen diese Fabulierereien missen?
Ortsnamen sind überhaupt eine Fundgrube
für Volksethymologen. „Holstein" hat mit
„Stein" nichts zu tun, sondern bedeutet so viel
wie das bayerische „Waldsassen": die Wald-
bewohner, umgebildet aus „Holtseten". Zu den
vielen Ortsnamen, die von der „Rodung" her-
rühren — Friedrichroda in Thüringen, Benrat
am Rhein, Reutte in Tirol — gehört „Ober-
und Niederra d". „Hana u" war ur-
sprünglich dasselbe wie „Hagenau" und bedeutet
„Waldwiese am Fluß"; der moderne Mensch denkt
an „Hahn". Zu der Gattung der „Rodungen"
gehört „Rastede" in Oldenburg, „Rastatt" in
Baden. Die Abkürzungen, die sich das Volk heute
noch erlaubt, indem es aus Seckenheim „Seckene",
aus Heitersheim „Heitersche" macht und aus
Döttingen „Dottige", wurde ehedem offiziell durch
die Rechtschreibung gutgeheißen. So entsteht aus
Hochheim „Hoym", aus An der hohen Burg
„Hombur g", aus Hochstedt „H ö ch st" und aus
Am hohen Ufer „Hannover". Ein ganzes Land
wird nach einer Burg an der Halde „Anhalt" ge-
nannt. „Querfurt" ist „Quirnfurt", d. h.
Mühlenfurt. Fromme Gemüter haben aus
„Salaha-Statt" („salix", „saule") — „Weiden-
stätte" Seligenstadt, eine „Selige Stätte", ge-
macht und dabei an die Klosterkirche mit ihren
Heiligengräbern gedacht. Die Nachbarschaft der
Nordsee verführte dazu, den „Dietmars Gau"
„Dietmarschen" zu taufen.
Eine bedeutende Rolle neben der Bequemlich-
keit spielt der Euphemismus. Die „Fule
Gasse" mißfällt ihren Bewohnern; sie machen
daraus eine „Pfahlgasse", aus der „Engen Gasse"
eine „Engelsgasse" und aus der „Eselstraße" eine
R. Seiffert-Wattenberg, Weitzer Krug. 1932
Überall wird man auf solche Lokalsagen stoßen,
die einem Mißverständnis ihr Dasein verdanken.
Der „Maut-Turm", d. h. „Zolleinnehmer-Turm",
aus einer Rheininsel bei Bingen wird zu jenem
„Mäuse türm", in dem — ganz ähnlich der
Machnower Legende — ein unbarmherziger
Bischof von den Mäusen ausgefressen worden sei.
Eine andere „Mautstelle" unterhalb von Magde-
„Ölstraße". Ein Bürger, der nach seiner wendi-
schen Abstammung den unangenehmen Namen
„Slave" trug, ließ sich in „Schlaf" umtaufen.
Besonders erfinderisch find unsere Vorfahren ge-
wesen, wenn sie lateinische Ortsnahmen ver-
deutschen mußten. Aus ,AH6II8'I'^
VINVLUI60UHU" wurde „Augsbur g", aus
LOUIIN" gar „Klagenfurt".
Das aus Friedrich Stoltze bekannte Frankfurter
Eine solche Persönlichkeit ist der seit fünfund-
zwanzig Jahren in Hannover lebende Maler
Seiffert-Wattenberg. In Braunschweig geboren,
studierte er in München und hielt sich längere Zeit
in Paris aus. Am 23. Januar dieses Jahres voll-
endete er sein 60. Lebensjahr, besonders von den
Hannoveranern gefeiert, nicht nur als Künstler,
sondern auch als Organisator und Kunstkenner.
Der Kunstverein dankt ihm manche Jahresgabe
und seine Kollegen erhielten manche tatkräftige
Hilfe.
Die frühen Bilder Seiffert-Wattenbergs zeigen
groß gesehene Vorwürfe, eine gediegene Malkultur
und einen sorgsam ausgewogenen Aufbau. Mit
der Zeit werden seine Bilder immer feiner und
stiller; die Gegenstände, an denen er sich versucht,
einfacher; ein' Krug, ein Kaktus, ein Blumen-
strauß, nichts weiter. Die Farben differenzieren
sich immer mehr, aber nicht in Richtung auf das
Analytische des Impressionismus hin, es ist kein
Zerlegen oder gar Auflösen des Gegenstandes in
seine Bestandteile, sondern die einzelnen, sorgfältig
gewählten Farben bauen das Bild auf. Da ist oft
ein Farbfleck auf seinen Bildern zu sehen, ein
Weiß, ein Violett, scheinbar leicht hingewischt.
Nimmt man aber diesen Fleck aus dem Bild weg,
so sieht man, daß dieser Fleck für das Bildganze
unbedingt nötig war, daß das Bild ohne ihn
glanzlos, schwunglos werden würde, daß es nicht
mehr zusammenklingt. Anderseits ist es aber nicht
so, als ob dieser Fleck mit besonderer Raffinesse
an gerade diesen Punkt hingesetzt worden wäre.
Alle' Farbflecke zusammen bilden keinen Teppich
von unterschiedsloser Oberfläche, sondern bauen
die Gegenstände auf, tragen Akzente, formen ein
Bild, das in seiner Eigenart nicht nachgeahmt wer-
den kann. So hat Seiffert-Wattenberg auch keinen
R. Seiffert-Wattenberg, Zm Walde. 1933
„Affentor" ist wie das durch seinen Rotwein
berühmte „Affental" von ,AVL" abzuleiten,
vermutlich von einer ^.ve-Glocke, die ehemals dort
geläutet wurde. Aus dieser ^.va-Glocke hat man
keine „Affenglocke", Wohl aber eine „Abendglocke"
gemacht. Weit bis in den Alltag hinein läßt sich
diese Umdichtung verfolgen. So, wenn aus
„NIITII8" „Maul" und aus
„Maulbeere" wird. Der „Maulwurf" gehört
unter die irrtümlichen Modernisierungen; ihm
liegt das mittelhochdeutsche „Moltwerfe" zugrunde,
das sich in „Müll" erhalten hat: gemahlene,
lockere Erde. Das „Maulaffen feilhalten" wird
aus das niederdeutsche „Mul apen" (Maul offen)
zurückzuführen sein.
Um zu den fremden Sprachen zurückzukehren,
so ist die „Kanone" in der Redensart „Unter
aller Kanone" der griechische „Kanon", das Richt-
maß, das „Eisbein" kommt nicht von „Eis",
sondern vom griechischen „I86HI(M", das, wie
in „Ischias", Hüftbein bedeutet. Das lateinische
französisch „Ollanea", wurde zu
der deutschen „Schanze" in der Redensart
„Sein Leben in die Schanze schlagen". „Kor-
poral" ist der falsch verstandene, vielleicht auch
etwas unbequem auszusprechende französische
— von „Kopf", nicht von „Körper"
abgeleitet. „VONNLU T HULUHIIVN 80N
heißt auf deutsch „einem sein Fett
geben". Und die „S ch a t t e n morelle" braucht
ebensogut die Sonne wie jede andere Obstsorte,
höchstens daß sie im Schatten des
N0RLU" gezüchtet wurde. Daß im „Rot-
welsch", der Bettler- und Gaunersprache, das
Hebräische Pate gestanden hat und die Wörter
„LOU" (Stimme) für „verkohlen", „OliVlLU"
(Drei) für „Kümmelblättchen" und