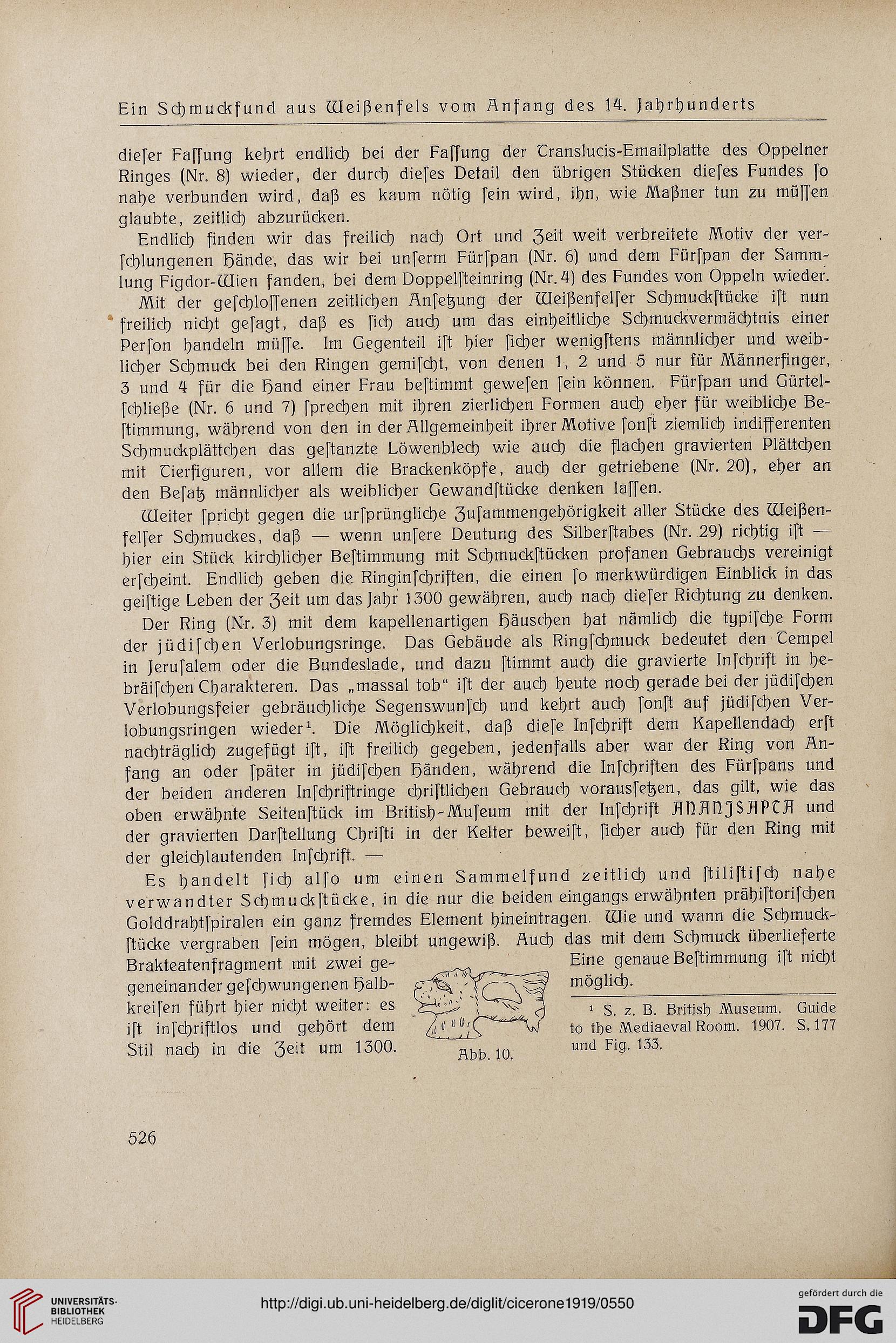Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0550
DOI Heft:
Heft 16
DOI Artikel:Sauerlandt, Max: Ein Schmuckfund aus Weißenfels vom Anfang des 14. Jahrhunderts
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0550
Ein Schmuckfund aus (Heißenfels vom Anfang des 14. Jahrhunderts
diefer Faffung kehrt endlich) bei der Faffung der Eranslucis-Emailplatte des Oppelner
Ringes (Nr. 8) wieder, der durch) diefes Detail den übrigen Stücken diefes Fundes fo
nahe verbunden wird, daß es kaum nötig fein wird, ihn, wie Maßner tun zu müffen
glaubte, zeitlich) abzurücken.
Endlich) finden wir das freilich) nach) Ort und 3eit weit verbreitete Motiv der ver-
fcßlungenen Bände, das wir bei unferm Fürfpan (Nr. 6) und dem Fürfpan der Samm-
lung Figdor-HIien fanden, bei dem Doppelfteinring (Nr. 4) des Fundes von Oppeln wieder.
Mit der gefcßloffenen zeitlichen Anfettung der (Heißenfelfer Scßmuckftücke ift nun
freilich) nicht gefagt, daß es fiel) auch) um das einheitliche Schmuckvermächtnis einer
Perfon handeln müffe. Im Gegenteil ift hier Hehler wenigftens männlicher und weib-
licher Schmuck bei den Ringen gemifd)t, von denen 1, 2 und 5 nur für Männerfinger,
3 und 4 für die Band einer Frau beftimmt gewefen fein können. Fürfpan und Gürtel-
fchließe (Nr. 6 und 7) fprechjen mit ihren zierlichen Formen auch eher für weibliche Be-
ftimmung, während von den in der Allgemeinheit ihrer Motive fonft ziemlich indifferenten
Schmuckplättchen das geftanzte Löwenblech wie auch die flachen gravierten Plättchen
mit Cierfiguren, vor allem die Brackenköpfe, auch der getriebene (Nr. 20), eher an
den Befat^ männlicher als weiblicher Gewandftücke denken laffen.
(Heiter fprich)t gegen die urfprüng!ich)e 3ufammengehörigkeit aller Stücke des (Heißen-
felfer Schmuckes, daß —■ wenn unfere Deutung des Silberftabes (Nr. 29) richtig ift ■—
hier ein Stück kirchlicher Beftimmung mit Schmuckftücken profanen Gebrauchs vereinigt
erfchjeint. Endlich geben die Ringinfchriften, die einen fo merkwürdigen Einblick in das
geiftige Leben der 3eit um das Jahr 1300 gewähren, auch nach diefer Richtung zu denken.
Der Ring (Nr. 3) mit dem kapellenartigen Bäuschen hat nämlich die typifdje Form
der jüdifchen Verlobungsringe. Das Gebäude als Ringfchmuck bedeutet den Fempel
in Jerufalem oder die Bundeslade, und dazu ftimmt auch die gravierte Infchrift in he-
bräifchen Charakteren. Das „massal tob“ ift der auch heute noch gerade bei der jüdifchen
Verlobungsfeier gebräuchliche Segenswunfd) und kehrt auch [onft auf jüdifchen Ver-
lobungsringen wieder1. Die Möglichkeit, daß diefe Infchrift dem Kapellendach erft
nachträglich zugefügt ift, ift freilich gegeben, jedenfalls aber war der Ring von An-
fang an oder fpäter in jüdifchen Bänden, während die Infchriften des Fürfpans und
der beiden anderen Infchriftringe chriftlichen Gebrauch vorausfetjen, das gilt, wie das
oben erwähnte Seitenftück im British-Mufeum m't der Infchrift ADAD3$APtA und
der gravierten Darftellung Chrifti in der Kelter beweift, ficher auch für den Ring mit
der gleichlautenden Infchrift. —
Es handelt [ich alfo um einen Sammelfund zeitlich und ftiliftifd) nahe
verwandter Schmuckftücke, in die nur die beiden eingangs erwähnten prähiftorifchen
Golddrahtfpiralen ein ganz fremdes Element hineintragen. (Hie und wann die Schmuck-
ftücke vergraben fein mögen, bleibt ungewiß. Auch das mit dem Schmuck überlieferte
Brakteatenfragment mit zwei ge-
geneinander gefchwungenen Balb-
kreifen führt hier nicht weiter: es
ift infchriftlos und gehört dem
Stil nach in die 3eit um 1300.
Uv
ti «[£**~*\J
Abb. 10.
Eine genaue Beftimmung ift nicht
möglich.
1 S. z. B. British Museum. Guide
to the Mediaeval Room. 1907. S, 177
und Fig. 133.
526
diefer Faffung kehrt endlich) bei der Faffung der Eranslucis-Emailplatte des Oppelner
Ringes (Nr. 8) wieder, der durch) diefes Detail den übrigen Stücken diefes Fundes fo
nahe verbunden wird, daß es kaum nötig fein wird, ihn, wie Maßner tun zu müffen
glaubte, zeitlich) abzurücken.
Endlich) finden wir das freilich) nach) Ort und 3eit weit verbreitete Motiv der ver-
fcßlungenen Bände, das wir bei unferm Fürfpan (Nr. 6) und dem Fürfpan der Samm-
lung Figdor-HIien fanden, bei dem Doppelfteinring (Nr. 4) des Fundes von Oppeln wieder.
Mit der gefcßloffenen zeitlichen Anfettung der (Heißenfelfer Scßmuckftücke ift nun
freilich) nicht gefagt, daß es fiel) auch) um das einheitliche Schmuckvermächtnis einer
Perfon handeln müffe. Im Gegenteil ift hier Hehler wenigftens männlicher und weib-
licher Schmuck bei den Ringen gemifd)t, von denen 1, 2 und 5 nur für Männerfinger,
3 und 4 für die Band einer Frau beftimmt gewefen fein können. Fürfpan und Gürtel-
fchließe (Nr. 6 und 7) fprechjen mit ihren zierlichen Formen auch eher für weibliche Be-
ftimmung, während von den in der Allgemeinheit ihrer Motive fonft ziemlich indifferenten
Schmuckplättchen das geftanzte Löwenblech wie auch die flachen gravierten Plättchen
mit Cierfiguren, vor allem die Brackenköpfe, auch der getriebene (Nr. 20), eher an
den Befat^ männlicher als weiblicher Gewandftücke denken laffen.
(Heiter fprich)t gegen die urfprüng!ich)e 3ufammengehörigkeit aller Stücke des (Heißen-
felfer Schmuckes, daß —■ wenn unfere Deutung des Silberftabes (Nr. 29) richtig ift ■—
hier ein Stück kirchlicher Beftimmung mit Schmuckftücken profanen Gebrauchs vereinigt
erfchjeint. Endlich geben die Ringinfchriften, die einen fo merkwürdigen Einblick in das
geiftige Leben der 3eit um das Jahr 1300 gewähren, auch nach diefer Richtung zu denken.
Der Ring (Nr. 3) mit dem kapellenartigen Bäuschen hat nämlich die typifdje Form
der jüdifchen Verlobungsringe. Das Gebäude als Ringfchmuck bedeutet den Fempel
in Jerufalem oder die Bundeslade, und dazu ftimmt auch die gravierte Infchrift in he-
bräifchen Charakteren. Das „massal tob“ ift der auch heute noch gerade bei der jüdifchen
Verlobungsfeier gebräuchliche Segenswunfd) und kehrt auch [onft auf jüdifchen Ver-
lobungsringen wieder1. Die Möglichkeit, daß diefe Infchrift dem Kapellendach erft
nachträglich zugefügt ift, ift freilich gegeben, jedenfalls aber war der Ring von An-
fang an oder fpäter in jüdifchen Bänden, während die Infchriften des Fürfpans und
der beiden anderen Infchriftringe chriftlichen Gebrauch vorausfetjen, das gilt, wie das
oben erwähnte Seitenftück im British-Mufeum m't der Infchrift ADAD3$APtA und
der gravierten Darftellung Chrifti in der Kelter beweift, ficher auch für den Ring mit
der gleichlautenden Infchrift. —
Es handelt [ich alfo um einen Sammelfund zeitlich und ftiliftifd) nahe
verwandter Schmuckftücke, in die nur die beiden eingangs erwähnten prähiftorifchen
Golddrahtfpiralen ein ganz fremdes Element hineintragen. (Hie und wann die Schmuck-
ftücke vergraben fein mögen, bleibt ungewiß. Auch das mit dem Schmuck überlieferte
Brakteatenfragment mit zwei ge-
geneinander gefchwungenen Balb-
kreifen führt hier nicht weiter: es
ift infchriftlos und gehört dem
Stil nach in die 3eit um 1300.
Uv
ti «[£**~*\J
Abb. 10.
Eine genaue Beftimmung ift nicht
möglich.
1 S. z. B. British Museum. Guide
to the Mediaeval Room. 1907. S, 177
und Fig. 133.
526