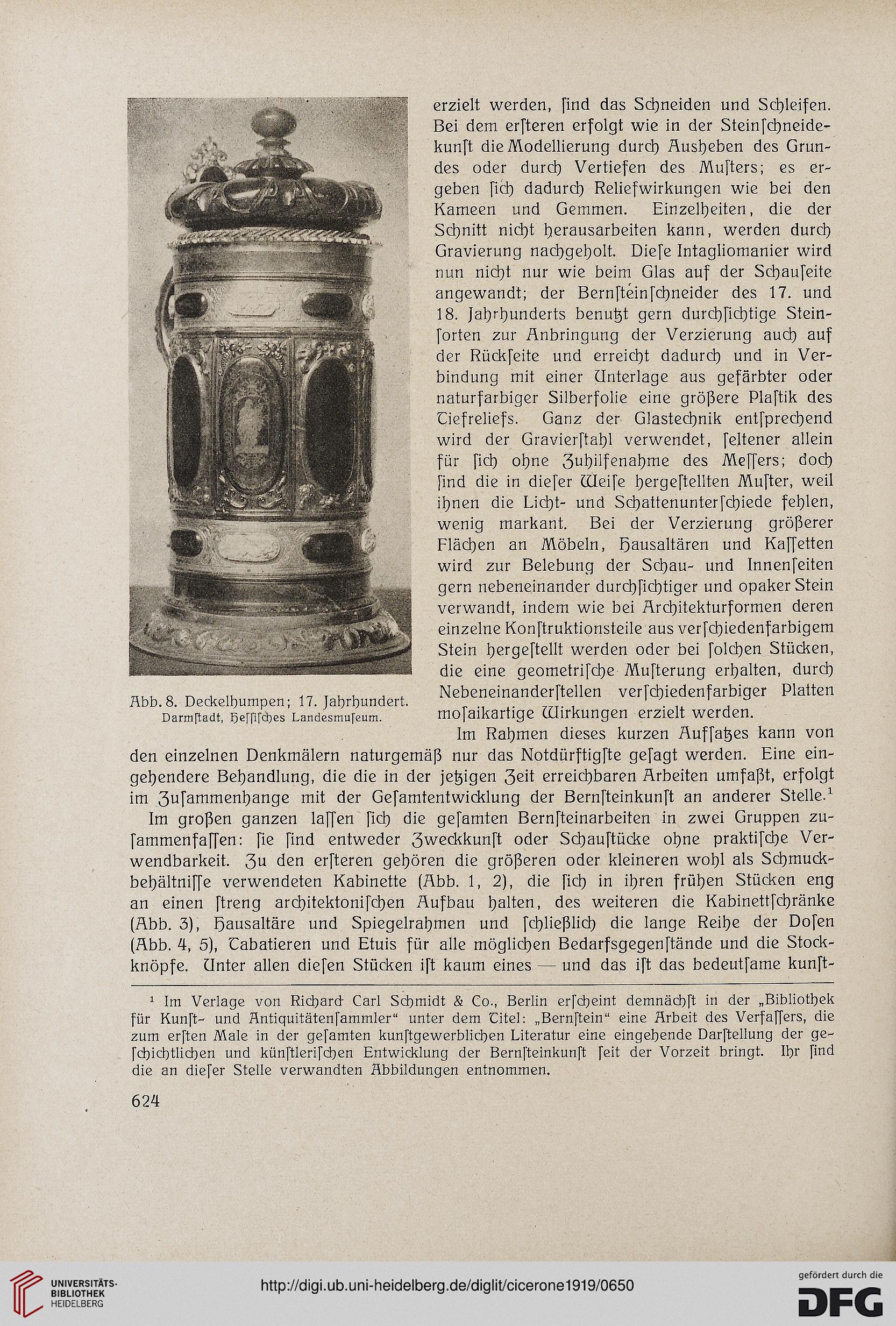Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0650
DOI Heft:
Heft 19
DOI Artikel:Pelka, Otto: Ältere Bersteinarbeiten
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0650
erzielt werden, find das Schneiden und Schleifen.
Bei dem erfteren erfolgt wie in der Steinfctjneide-
kunft die Modellierung durch) Ausheben des Grun-
des oder durch) Vertiefen des Mufters; es er-
geben [ich) dadurch) Reliefwirkungen wie bei den
Kameen und Gemmen. Einzelheiten, die der
Schnitt nicht herausarbeiten kann, werden durch
Gravierung nachgeholt. Diefe Intagliomanier wird
nun nicht nur wie beim Glas auf der Schaufeite
angewandt; der Bernfteinfctjneider des 17. und
18. Jahrhunderts benutzt gern durchsichtige Stein-
forten zur Anbringung der Verzierung auch auf
der Rückfeite und erreicht dadurch und in Ver-
bindung mit einer Unterlage aus gefärbter oder
naturfarbiger Silberfolie eine größere Plaftik des
Ciefreliefs. Ganz der Glastechnik entfprecßend
wird der Gravierftahl verwendet, feltener allein
für [ich ohne 3ufüSenah)me des Meffers; doch
find die in diefer Uleife hjergeftellten Mufter, weil
ihnen die Licht- und Sd)attenunterfch)iede fehlen,
wenig markant. Bei der Verzierung größerer
Flächen an Möbeln, ßausaltären und Kaffetten
wird zur Belebung der Schau- und Innenfeiten
gern nebeneinander durchsichtiger und opaker Stein
verwandt, indem wie bei Architekturformen deren
einzelne Konftruktionsteile aus verfch)iedenfarbigem
Stein hergeftellt werden oder bei folchjen Stücken,
die eine geometrifchje Mufterung erhalten, durch
Nebeneinanderftellen verfchpedenfarbiger Platten
mofaikartige Wirkungen erzielt werden.
Im Rahmen dieses kurzen Auffaßes kann von
den einzelnen Denkmälern naturgemäß nur das Notdürftigfte gefagt werden. Eine ein-
gehendere Behandlung, die die in der jetzigen geit erreichbaren Arbeiten umfaßt, erfolgt
im 3ufammenhange mit der Gefamtentwicklung der Bernfteinkunft an anderer Stelle.1
Im großen ganzen laSen fiel) die gefamten Bernfteinarbeiten in zwei Gruppen zu-
fammenfaSen: fie find entweder 3weckkunft oder Scßauftücke ol)ne praktifchje Ver-
wendbarkeit. 3u den erfteren gehören die größeren oder kleineren woßl als Scßmuck-
beßältniSe verwendeten Kabinette (Abb. 1, 2), die fiel) in ihren frühen Stücken eng
an einen ftreng ard)itektonifch)en Aufbau halten, des weiteren die Kabinettfehränke
(Abb. 3), FJausaltäre und Spiegelral)men und fchSießlich) die lange Reihe der Dofen
(Abb. 4, 5), Cabatieren und Etuis für alle möglichen Bedarfsgegenftände und die Stock-
knöpfe. Unter allen diefen Stücken ift kaum eines — und das ift das bedeutfame kunft-
Äbb. 8. Deckelhumpen; 17. Jahrhundert
Darmftadt, peffifdjes Landesmufeum.
1 Im Verlage von Richard Carl Schmidt & Co., Berlin erfchieint demnächst in der „Bibliothek
für Kunft- und Äntiquitätenfammler“ unter dem Eitel: „Bernftein“ eine Arbeit des Verfaffers, die
zum erften Male in der gefamten kunftgewerblicben Literatur eine eingehende Darftellung der ge-
fch)ich)tlicben und kiinftlerifcben Entwicklung der Bernfteinkunft feit der Vorzeit bringt. Ihr find
die an diefer Stelle verwandten Abbildungen entnommen.
624