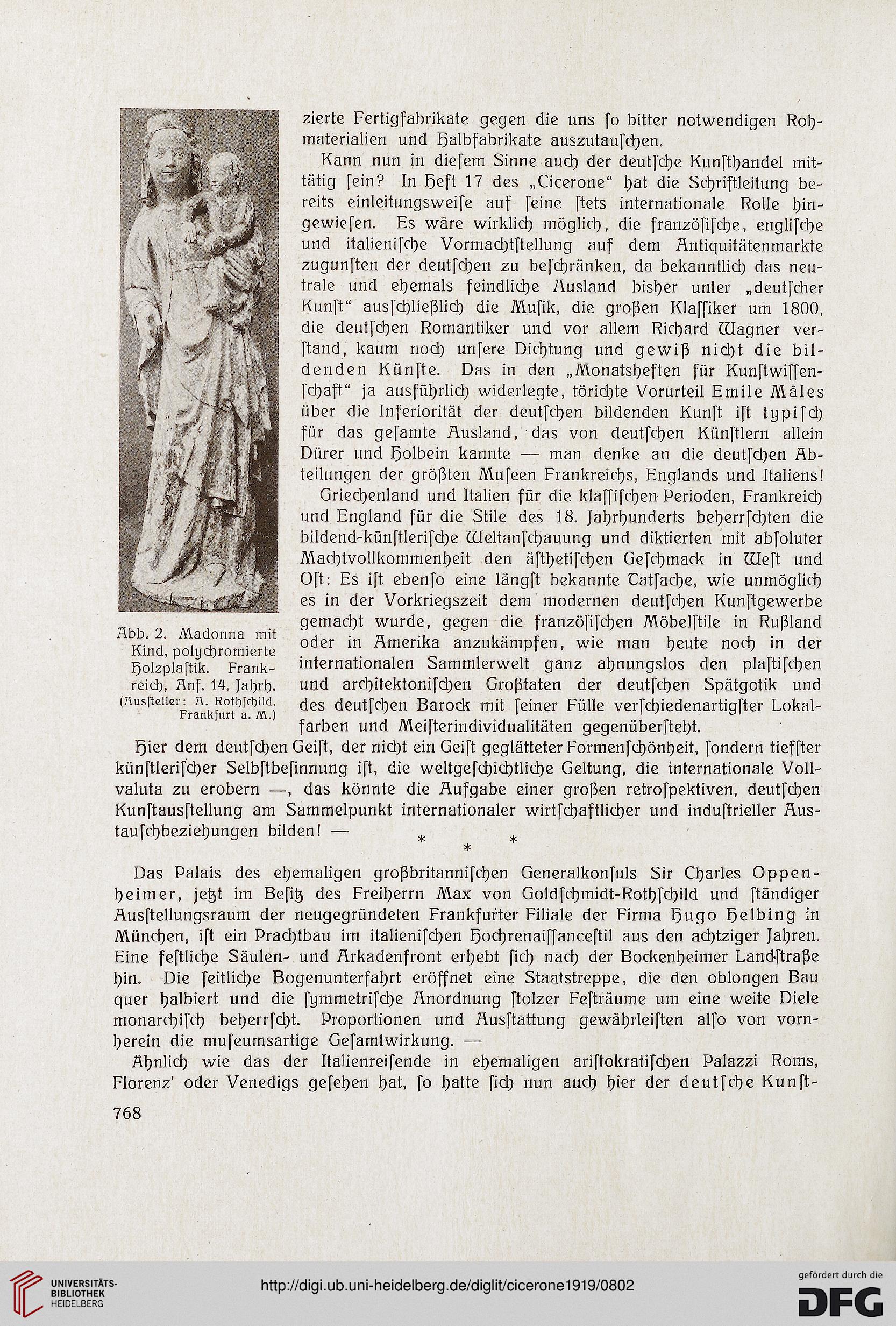Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0802
DOI Heft:
Heft 23
DOI Artikel:Hoeber, Fritz: Deutsche Kunstmesse: zur Ausstellung des deutschen Kunsthandels auf der internationalen Einfuhrmesse zu Frankfurt a. M.
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0802
zierte Fertigfabrikate gegen die uns fo bitter notwendigen Roh-
materialien und Halbfabrikate auszutaufcßen.
Kann nun in diefem Sinne auch» der deutfcße Kunftßandel mit-
tätig fein? In Heft 17 des „Cicerone“ hat die Schriftleitung be-
reits einleitungsweife auf feine ftets internationale Rolle ßin-
gewiefen. Es wäre wirklich möglich, die franzöfifche, englifche
i , '1 und italienifche Vormachtftellung auf dem Antiquitätenmarkte
\ \. - .1 zugunften der deutfchen zu befchränken, da bekanntlich das neu-
AkiwnH frale uncj e^emais feindliche Ausland bisher unter „deutfeher
Kunft“ ausfchließlich die Mufik, die großen Klaffiker um 1800,
die deutfeßen Romantiker und vor allem Richard (Uagner ver-
band, kaum noch unfere Dichtung und gewiß nicht die bil-
denden Künfte. Das in den „Monatsheften für Kunftwiffen-
feßaft“ ja ausführlich widerlegte, törichte Vorurteil Emile Mäles
über die Inferiorität der deutfchen bildenden Kunft ift typifcß
für das gefamte Ausland, das von deutfchen Künftlern allein
Dürer und Holbein kannte — man denke an die deutfchen Ab-
teilungen der größten Mufeen Frankreichs, Englands und Italiens!
Griechenland und Italien für die klaffifcßen Perioden, Frankreich
und England für die Stile des 18. Jahrhunderts beßerrfeßten die
bildend-künftlerifcße üleltanfcßauung und diktierten mit abfoluter
Machtvollkommenheit den äftßetifcßen Gefchmack in Kleft und
Oft: Es ift ebenfo eine längft bekannte Catfache, wie unmöglich
es in der Vorkriegszeit dem modernen deutfchen Kunftgewerbe
gemacht wurde, gegen die franzöfifchen Möbelftile in Rußland
oder in Amerika anzukämpfen, wie man heute noch in der
internationalen Sammlerwelt ganz ahnungslos den plaftifchen
und areßitektonifeßen Großtaten der deutfeßen Spätgotik und
des deutfeßen Barock mit feiner Fülle verfeßiedenartigfter Lokal-
farben und Meifterindividualitäten gegenüberfteßt.
Hier dem deutfeßen Geift, der nicht ein Geift geglätteter Formenfcßönßeit, fondern tieffter
künftlerifcßer Selbftbefinnung ift, die weltgefcßicßtliche Geltung, die internationale Voll-
valuta zu erobern —, das könnte die Aufgabe einer großen retrofpektiven, deutfeßen
Kunftausftellung am Sammelpunkt internationaler wirtfcßaftlicßer und induftrieller Aus-
taufeßbezießungen bilden! —
Äbb. 2. Madonna mit
Kind, polyebromierte
Holzplaftik. Frank-
reich, Anf. 14. Jaßrß.
(Ausfteller: R. Rotpfcpild,
Frankfurt a. M.)
Das Palais des ehemaligen großbritannifeßen Generalkonfuls Sir Charles Oppen-
heimer, jefet im Befife des Freiherrn Max von Goldfchmidt-Rothfcßild und ftändiger
Ausftellungsraum der neugegründeten Frankfurter Filiale der Firma Hugo Helbing in
Müncßen, ift ein Prachtbau im italienifcßen Hocßrenaiffanceftil aus den achtziger Jaßren.
Eine feftlicße Säulen- und Arkadenfront erhebt fieß nach der Bockenßeimer Landftraße
hin. Die feitlicße Bogenunterfaßrt eröffnet eine Staatstreppe, die den oblongen Bau
quer halbiert und die fymmetrifeße Anordnung ftolzer Fefträume um eine weite Diele
monarcßifcß beßerrfeßt. Proportionen und Ausftattung gewäßrleiften alfo von vorn-
herein die mufeumsartige Gefamtwirkung. —
Ähnlich wie das der Italienreifende in ehemaligen ariftokratifeßen Palazzi Roms,
Florenz’ oder Venedigs gefeßen hat, fo hatte fieß nun auch hier der deutfeße Kunft-
768
materialien und Halbfabrikate auszutaufcßen.
Kann nun in diefem Sinne auch» der deutfcße Kunftßandel mit-
tätig fein? In Heft 17 des „Cicerone“ hat die Schriftleitung be-
reits einleitungsweife auf feine ftets internationale Rolle ßin-
gewiefen. Es wäre wirklich möglich, die franzöfifche, englifche
i , '1 und italienifche Vormachtftellung auf dem Antiquitätenmarkte
\ \. - .1 zugunften der deutfchen zu befchränken, da bekanntlich das neu-
AkiwnH frale uncj e^emais feindliche Ausland bisher unter „deutfeher
Kunft“ ausfchließlich die Mufik, die großen Klaffiker um 1800,
die deutfeßen Romantiker und vor allem Richard (Uagner ver-
band, kaum noch unfere Dichtung und gewiß nicht die bil-
denden Künfte. Das in den „Monatsheften für Kunftwiffen-
feßaft“ ja ausführlich widerlegte, törichte Vorurteil Emile Mäles
über die Inferiorität der deutfchen bildenden Kunft ift typifcß
für das gefamte Ausland, das von deutfchen Künftlern allein
Dürer und Holbein kannte — man denke an die deutfchen Ab-
teilungen der größten Mufeen Frankreichs, Englands und Italiens!
Griechenland und Italien für die klaffifcßen Perioden, Frankreich
und England für die Stile des 18. Jahrhunderts beßerrfeßten die
bildend-künftlerifcße üleltanfcßauung und diktierten mit abfoluter
Machtvollkommenheit den äftßetifcßen Gefchmack in Kleft und
Oft: Es ift ebenfo eine längft bekannte Catfache, wie unmöglich
es in der Vorkriegszeit dem modernen deutfchen Kunftgewerbe
gemacht wurde, gegen die franzöfifchen Möbelftile in Rußland
oder in Amerika anzukämpfen, wie man heute noch in der
internationalen Sammlerwelt ganz ahnungslos den plaftifchen
und areßitektonifeßen Großtaten der deutfeßen Spätgotik und
des deutfeßen Barock mit feiner Fülle verfeßiedenartigfter Lokal-
farben und Meifterindividualitäten gegenüberfteßt.
Hier dem deutfeßen Geift, der nicht ein Geift geglätteter Formenfcßönßeit, fondern tieffter
künftlerifcßer Selbftbefinnung ift, die weltgefcßicßtliche Geltung, die internationale Voll-
valuta zu erobern —, das könnte die Aufgabe einer großen retrofpektiven, deutfeßen
Kunftausftellung am Sammelpunkt internationaler wirtfcßaftlicßer und induftrieller Aus-
taufeßbezießungen bilden! —
Äbb. 2. Madonna mit
Kind, polyebromierte
Holzplaftik. Frank-
reich, Anf. 14. Jaßrß.
(Ausfteller: R. Rotpfcpild,
Frankfurt a. M.)
Das Palais des ehemaligen großbritannifeßen Generalkonfuls Sir Charles Oppen-
heimer, jefet im Befife des Freiherrn Max von Goldfchmidt-Rothfcßild und ftändiger
Ausftellungsraum der neugegründeten Frankfurter Filiale der Firma Hugo Helbing in
Müncßen, ift ein Prachtbau im italienifcßen Hocßrenaiffanceftil aus den achtziger Jaßren.
Eine feftlicße Säulen- und Arkadenfront erhebt fieß nach der Bockenßeimer Landftraße
hin. Die feitlicße Bogenunterfaßrt eröffnet eine Staatstreppe, die den oblongen Bau
quer halbiert und die fymmetrifeße Anordnung ftolzer Fefträume um eine weite Diele
monarcßifcß beßerrfeßt. Proportionen und Ausftattung gewäßrleiften alfo von vorn-
herein die mufeumsartige Gefamtwirkung. —
Ähnlich wie das der Italienreifende in ehemaligen ariftokratifeßen Palazzi Roms,
Florenz’ oder Venedigs gefeßen hat, fo hatte fieß nun auch hier der deutfeße Kunft-
768