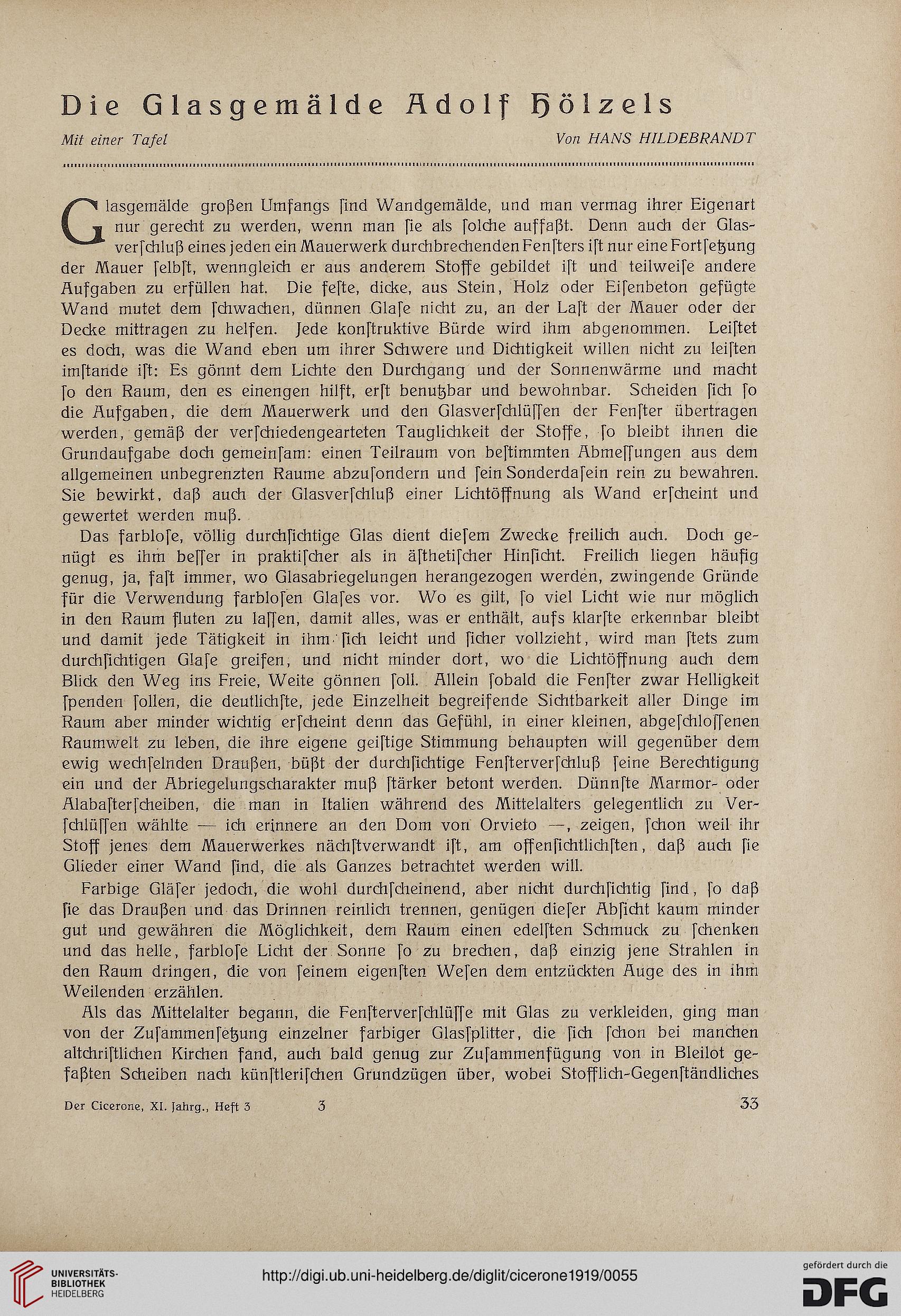Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 11.1919
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0055
DOI issue:
Heft 3
DOI article:Hildebrandt, Hans: Die Glasgemälde Adolf Hölzels
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.21394#0055
Die Glasgemälde Ädolf I) ö 1 z e 1 s
Mit einer Tafel Von HANS HILDEBRANDT
Glasgemälde großen Umfangs find Wandgemälde, und man vermag ihrer Eigenart
nur gerecht zu werden, wenn man fie als folche auffaßt. Denn auch der Glas-
verfchluß eines jeden ein Mauerwerk durchbrechenden Fenfters ift nur eine Fortfe^ung
der Mauer felbft, wenngleich er aus anderem Stoffe gebildet ift und teilweife andere
Aufgaben zu erfüllen hat. Die fefte, dicke, aus Stein, Holz oder Eifenbeton gefügte
Wand mutet dem fchwachen, dünnen Glafe nicht zu, an der Laft der Mauer oder der
Decke mittragen zu helfen. Jede konftruktive Bürde wird ihm abgenommen. Leiftet
es doch, was die Wand eben um ihrer Schwere und Dichtigkeit willen nicht zu leiften
imftande ift: Es gönnt dem Lichte den Durchgang und der Sonnenwärme und macht
fo den Raum, den es einengen hilft, erft benutzbar und bewohnbar. Scheiden [ich fo
die Aufgaben, die dem Mauerwerk und den Glasverfchlüffen der Fenfter übertragen
werden, gemäß der verfchiedengearteten Tauglichkeit der Stoffe, fo bleibt ihnen die
Grundaufgabe doch gemeinfam: einen Teilraum von beftimmten Abmeffungen aus dem
allgemeinen unbegrenzten Raume abzufondern und fein Sonderdafein rein zu bewahren.
Sie bewirkt, daß auch der Glasverfchluß einer Lichtöffnung als Wand erfcheint und
gewertet werden muß.
Das farblofe, völlig durchfichtige Glas dient diefem Zwecke freilich auch. Doch ge-
nügt es ihm beffer in praktifcher als in äfthetifcher Hinficht. Freilich liegen häufig
genug, ja, faft immer, wo Glasabriegelungen herangezogen werden, zwingende Gründe
für die Verwendung farblofen Glafes vor. Wo es gilt, fo viel Licht wie nur möglich
in den Raum fluten zu laffen, damit alles, was er enthält, aufs klarfte erkennbar bleibt
und damit jede Tätigkeit in ihm fich leicht und ficher vollzieht, wird man ftets zum
durchfichtigen Glafe greifen, und nicht minder dort, wo die Lichtöffnung auch dem
Blick den Weg ins Freie, Weite gönnen foll. Allein fobald die Fenfter zwar Helligkeit
fpenden follen, die deutlichfte, jede Einzelheit begreifende Sichtbarkeit aller Dinge im
Raum aber minder wichtig erfcheint denn das Gefühl, in einer kleinen, abgefchloffenen
Raumwelt zu leben, die ihre eigene geiftige Stimmung behaupten will gegenüber dem
ewig wechfelnden Draußen, büßt der durchfichtige Fenfterverfchluß feine Berechtigung
ein und der Abriegelungscharakter muß ftärker betont werden. Dünnfte Marmor- oder
Alabafterfcheiben, die man in Italien während des Mittelalters gelegentlich zu Ver-
fchlüffen wählte — ich erinnere an den Dom von Orvieto zeigen, fchon weil ihr
Stoff jenes dem Mauerwerkes nächftverwandt ift, am offenfichtlichften, daß auch fie
Glieder einer Wand find, die als Ganzes betrachtet werden will.
Farbige Gläfer jedoch, die wohl durchfclieinend, aber nicht durchfichtig find, fo daß
fie das Draußen und das Drinnen reinlich trennen, genügen diefer Abficht kaum minder
gut und gewähren die Möglichkeit, dem Raum einen edelften Schmuck zu fchenken
und das helle, farblofe Licht der Sonne fo zu brechen, daß einzig jene Strahlen in
den Raum dringen, die von feinem eigenften Wefen dem entzückten Auge des in ihm
Weilenden erzählen.
Als das Mittelalter begann, die Fenfterverfchlüffe mit Glas zu verkleiden, ging man
von der Zufammenfe^ung einzelner farbiger Glasfplitter, die fich fchon bei manchen
altchriftlichen Kirchen fand, auch bald genug zur Zufammenfügung von in Bleilot ge-
faßten Scheiben nach künftlerifchen Grundzügen über, wobei Stofflich-Gegenftändliches
Der Cicerone, XI. Jahrg., Heft 3
3
33
Mit einer Tafel Von HANS HILDEBRANDT
Glasgemälde großen Umfangs find Wandgemälde, und man vermag ihrer Eigenart
nur gerecht zu werden, wenn man fie als folche auffaßt. Denn auch der Glas-
verfchluß eines jeden ein Mauerwerk durchbrechenden Fenfters ift nur eine Fortfe^ung
der Mauer felbft, wenngleich er aus anderem Stoffe gebildet ift und teilweife andere
Aufgaben zu erfüllen hat. Die fefte, dicke, aus Stein, Holz oder Eifenbeton gefügte
Wand mutet dem fchwachen, dünnen Glafe nicht zu, an der Laft der Mauer oder der
Decke mittragen zu helfen. Jede konftruktive Bürde wird ihm abgenommen. Leiftet
es doch, was die Wand eben um ihrer Schwere und Dichtigkeit willen nicht zu leiften
imftande ift: Es gönnt dem Lichte den Durchgang und der Sonnenwärme und macht
fo den Raum, den es einengen hilft, erft benutzbar und bewohnbar. Scheiden [ich fo
die Aufgaben, die dem Mauerwerk und den Glasverfchlüffen der Fenfter übertragen
werden, gemäß der verfchiedengearteten Tauglichkeit der Stoffe, fo bleibt ihnen die
Grundaufgabe doch gemeinfam: einen Teilraum von beftimmten Abmeffungen aus dem
allgemeinen unbegrenzten Raume abzufondern und fein Sonderdafein rein zu bewahren.
Sie bewirkt, daß auch der Glasverfchluß einer Lichtöffnung als Wand erfcheint und
gewertet werden muß.
Das farblofe, völlig durchfichtige Glas dient diefem Zwecke freilich auch. Doch ge-
nügt es ihm beffer in praktifcher als in äfthetifcher Hinficht. Freilich liegen häufig
genug, ja, faft immer, wo Glasabriegelungen herangezogen werden, zwingende Gründe
für die Verwendung farblofen Glafes vor. Wo es gilt, fo viel Licht wie nur möglich
in den Raum fluten zu laffen, damit alles, was er enthält, aufs klarfte erkennbar bleibt
und damit jede Tätigkeit in ihm fich leicht und ficher vollzieht, wird man ftets zum
durchfichtigen Glafe greifen, und nicht minder dort, wo die Lichtöffnung auch dem
Blick den Weg ins Freie, Weite gönnen foll. Allein fobald die Fenfter zwar Helligkeit
fpenden follen, die deutlichfte, jede Einzelheit begreifende Sichtbarkeit aller Dinge im
Raum aber minder wichtig erfcheint denn das Gefühl, in einer kleinen, abgefchloffenen
Raumwelt zu leben, die ihre eigene geiftige Stimmung behaupten will gegenüber dem
ewig wechfelnden Draußen, büßt der durchfichtige Fenfterverfchluß feine Berechtigung
ein und der Abriegelungscharakter muß ftärker betont werden. Dünnfte Marmor- oder
Alabafterfcheiben, die man in Italien während des Mittelalters gelegentlich zu Ver-
fchlüffen wählte — ich erinnere an den Dom von Orvieto zeigen, fchon weil ihr
Stoff jenes dem Mauerwerkes nächftverwandt ift, am offenfichtlichften, daß auch fie
Glieder einer Wand find, die als Ganzes betrachtet werden will.
Farbige Gläfer jedoch, die wohl durchfclieinend, aber nicht durchfichtig find, fo daß
fie das Draußen und das Drinnen reinlich trennen, genügen diefer Abficht kaum minder
gut und gewähren die Möglichkeit, dem Raum einen edelften Schmuck zu fchenken
und das helle, farblofe Licht der Sonne fo zu brechen, daß einzig jene Strahlen in
den Raum dringen, die von feinem eigenften Wefen dem entzückten Auge des in ihm
Weilenden erzählen.
Als das Mittelalter begann, die Fenfterverfchlüffe mit Glas zu verkleiden, ging man
von der Zufammenfe^ung einzelner farbiger Glasfplitter, die fich fchon bei manchen
altchriftlichen Kirchen fand, auch bald genug zur Zufammenfügung von in Bleilot ge-
faßten Scheiben nach künftlerifchen Grundzügen über, wobei Stofflich-Gegenftändliches
Der Cicerone, XI. Jahrg., Heft 3
3
33