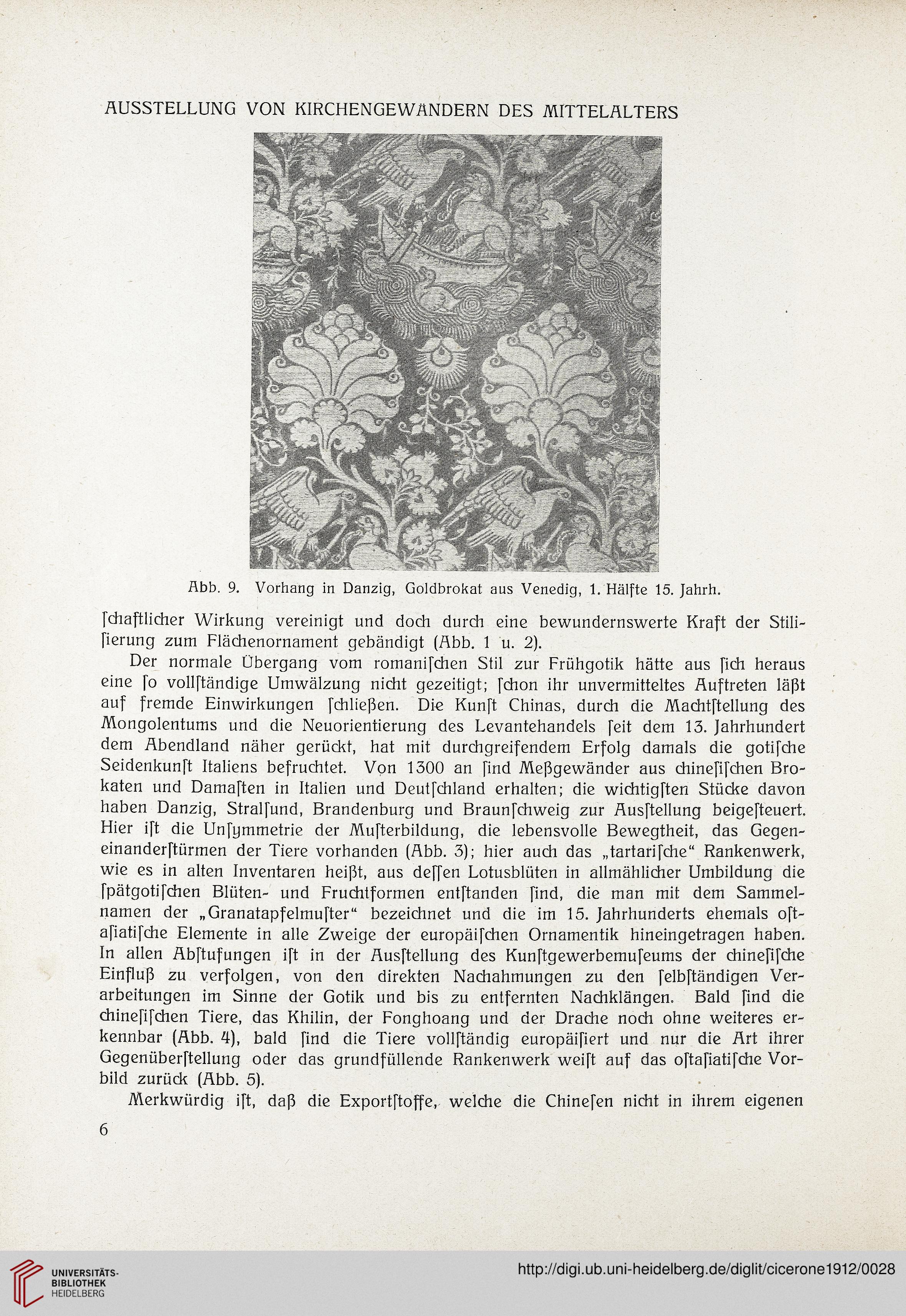Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0028
DOI Heft:
1. Heft
DOI Artikel:Falke, Otto von: Die Ausstellung von Kirchengewändern des Mittelalters im Berliner Kunstgewerbe
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0028
AUSSTELLUNG VON KIRCHENGEWÄNDERN DES MITTELALTERS
Äbb. 9. Vorhang in Danzig, Goldbrokat aus Venedig, 1. Hälfte 15. Jahrh.
[chaftlicher Wirkung vereinigt und doch durch eine bewundernswerte Kraft der Stili-
fierung zum Flächenornament gebändigt (Abb. 1 u. 2).
Der normale Übergang vom romanifchen Stil zur Frühgotik hätte aus [ich heraus
eine fo vollftändige Umwälzung nicht gezeitigt; [chon ihr unvermitteltes Auftreten läßt
auf fremde Einwirkungen fchließen. Die Kunft Chinas, durch die Machtftellung des
Mongolentums und die Neuorientierung des Levantehandels feit dem 13. Jahrhundert
dem Abendland näher gerückt, hat mit durchgreifendem Erfolg damals die gotifche
Seidenkunft Italiens befruchtet. Von 1300 an find Meßgewänder aus chinefifchen Bro-
katen und Damaften in Italien und Deutfchland erhalten; die wichtigften Stücke davon
haben Danzig, Stralfund, Brandenburg und Braunfchweig zur Ausftellung beigefteuert.
Hier ift die Unfymmetrie der Mufterbildung, die lebensvolle Bewegtheit, das Gegen-
einanderftürmen der Tiere vorhanden (Abb. 3); hier auch das „tartarifche“ Rankenwerk,
wie es in alten Inventaren heißt, aus deffen Lotusblüten in allmählicher Umbildung die
fpätgotifchen Blüten- und Fruchtformen entftanden find, die man mit dem Sammel-
namen der „Granatapfelmufter“ bezeichnet und die im 15. Jahrhunderts ehemals oft-
afiatifche Elemente in alle Zweige der europäifchen Ornamentik hineingetragen haben.
In allen Abftufungen ift in der Ausftellung des Kunftgewerbemufeums der chinefifche
Einfluß zu verfolgen, von den direkten Nachahmungen zu den felbftändigen Ver-
arbeitungen im Sinne der Gotik und bis zu entfernten Nachklängen. Bald find die
chinefifchen Tiere, das Khilin, der Fonghoang und der Drache noch ohne weiteres er-
kennbar (Abb. 4), bald find die Tiere vollftändig europäifiert und nur die Art ihrer
Gegenüberftellung oder das grundfüllende Rankenwerk weift auf das oftafiatifche Vor-
bild zurück (Abb. 5).
Merkwürdig ift, daß die Exportftoffe, welche die Chinefen nicht in ihrem eigenen
6
Äbb. 9. Vorhang in Danzig, Goldbrokat aus Venedig, 1. Hälfte 15. Jahrh.
[chaftlicher Wirkung vereinigt und doch durch eine bewundernswerte Kraft der Stili-
fierung zum Flächenornament gebändigt (Abb. 1 u. 2).
Der normale Übergang vom romanifchen Stil zur Frühgotik hätte aus [ich heraus
eine fo vollftändige Umwälzung nicht gezeitigt; [chon ihr unvermitteltes Auftreten läßt
auf fremde Einwirkungen fchließen. Die Kunft Chinas, durch die Machtftellung des
Mongolentums und die Neuorientierung des Levantehandels feit dem 13. Jahrhundert
dem Abendland näher gerückt, hat mit durchgreifendem Erfolg damals die gotifche
Seidenkunft Italiens befruchtet. Von 1300 an find Meßgewänder aus chinefifchen Bro-
katen und Damaften in Italien und Deutfchland erhalten; die wichtigften Stücke davon
haben Danzig, Stralfund, Brandenburg und Braunfchweig zur Ausftellung beigefteuert.
Hier ift die Unfymmetrie der Mufterbildung, die lebensvolle Bewegtheit, das Gegen-
einanderftürmen der Tiere vorhanden (Abb. 3); hier auch das „tartarifche“ Rankenwerk,
wie es in alten Inventaren heißt, aus deffen Lotusblüten in allmählicher Umbildung die
fpätgotifchen Blüten- und Fruchtformen entftanden find, die man mit dem Sammel-
namen der „Granatapfelmufter“ bezeichnet und die im 15. Jahrhunderts ehemals oft-
afiatifche Elemente in alle Zweige der europäifchen Ornamentik hineingetragen haben.
In allen Abftufungen ift in der Ausftellung des Kunftgewerbemufeums der chinefifche
Einfluß zu verfolgen, von den direkten Nachahmungen zu den felbftändigen Ver-
arbeitungen im Sinne der Gotik und bis zu entfernten Nachklängen. Bald find die
chinefifchen Tiere, das Khilin, der Fonghoang und der Drache noch ohne weiteres er-
kennbar (Abb. 4), bald find die Tiere vollftändig europäifiert und nur die Art ihrer
Gegenüberftellung oder das grundfüllende Rankenwerk weift auf das oftafiatifche Vor-
bild zurück (Abb. 5).
Merkwürdig ift, daß die Exportftoffe, welche die Chinefen nicht in ihrem eigenen
6