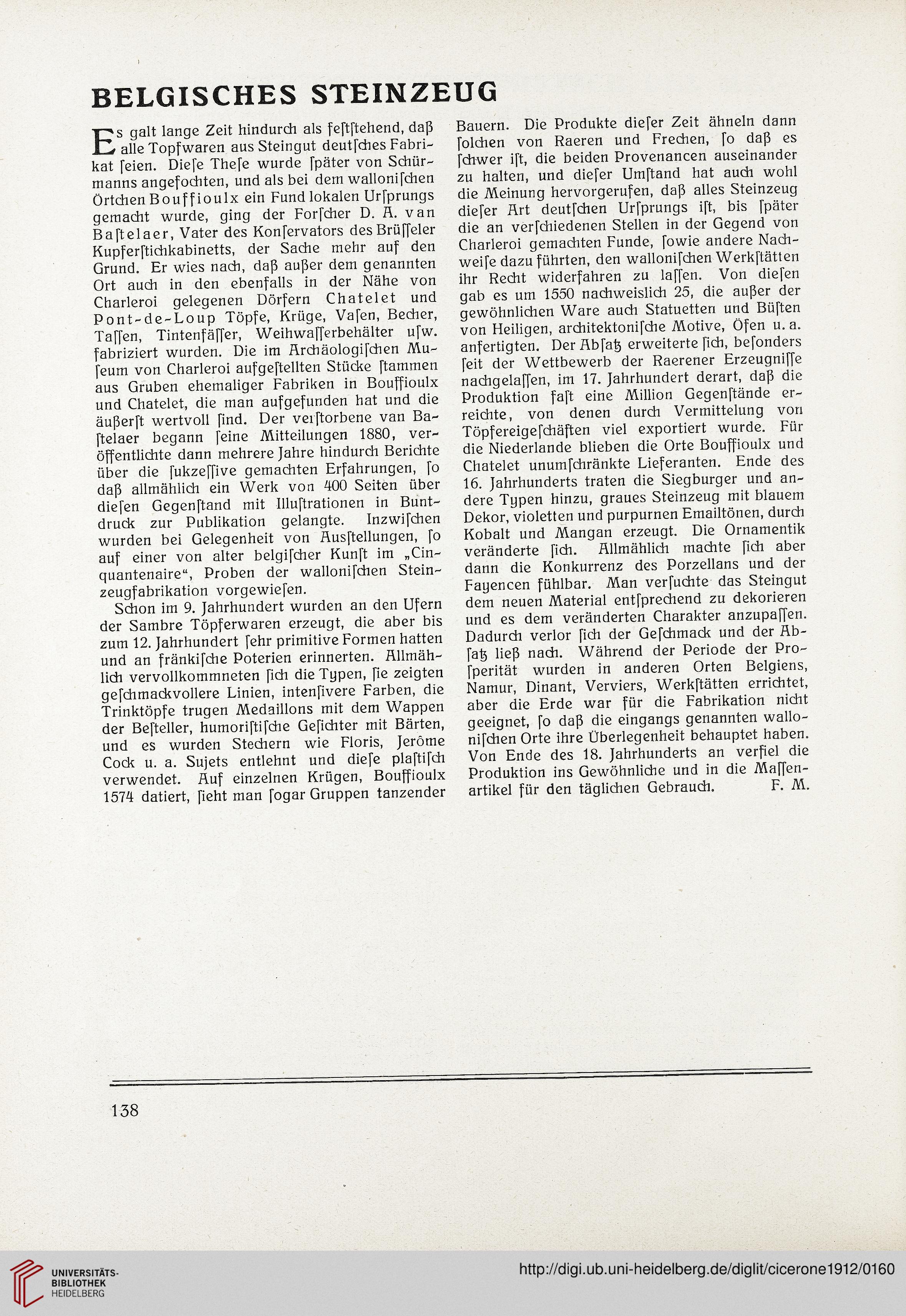Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0160
DOI issue:
4. Heft
DOI article:Belgisches Steinzeug
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0160
BELGISCHES STEINZEUG
Es galt lange Zeit hindurch als feftftehend, daß
alle Topfwaren aus Steingut deutfches Fabri-
kat feien. Diefe Thefe wurde fpäter von Schür-
manns angefochten, und als bei dem wallonifchen
Örtchen Bouffioulx ein Fund lokalen Urfprungs
gemacht wurde, ging der Forfcher D. R. van
Baftelaer, Vater des Konfervators desBrüffeler
Kupferftichkabinetts, der Sache mehr auf den
Grund. Er wies nach, daß außer dem genannten
Ort auch in den ebenfalls in der Nähe von
Charleroi gelegenen Dörfern Chatelet und
Pont-de-Loup Töpfe, Krüge, Vafen, Becher,
Taffen, Tintenfäffer, Weihwafferbehälter ufw.
fabriziert wurden. Die im Ärchäologifchen Mu-
feum von Charleroi aufgeftellten Stücke ftammen
aus Gruben ehemaliger Fabriken in Bouffioulx
und Chatelet, die man aufgefunden hat und die
äußerft wertvoll find. Der veiftorbene van Ba-
ftelaer begann feine Mitteilungen 1880, ver-
öffentlichte dann mehrere Jahre hindurch Berichte
über die fukzeffive gemachten Erfahrungen, fo
daß allmählich ein Werk von 400 Seiten über
diefen Gegenftand mit Illuftrationen in Bunt-
druck zur Publikation gelangte. Inzwifchen
wurden bei Gelegenheit von Äusftellungen, fo
auf einer von alter belgifcher Kunft im „Cin-
quantenaire“, Proben der wallonifchen Stein-
zeugfabrikation vorgewiefen.
Schon im 9. Jahrhundert wurden an den Ufern
der Sambre Töpferwaren erzeugt, die aber bis
zum 12. Jahrhundert fehr primitive Formen hatten
und an fränkifche Poterien erinnerten. Ällmäh-
lich vervollkommneten fich die Typen, fie zeigten
gefchmackvollere Linien, intenfivere Farben, die
Trinktöpfe trugen Medaillons mit dem Wappen
der Befteller, humoriftifche Gefichter mit Bärten,
und es wurden Stechern wie Floris, Jeröme
Cock u. a. Sujets entlehnt und diefe plaftifch
verwendet. Auf einzelnen Krügen, Bouffioulx
1574 datiert, fieht man fogar Gruppen tanzender
Bauern. Die Produkte diefer Zeit ähneln dann
folchen von Raeren und Frechen, fo daß es
fchwer ift, die beiden Provenancen auseinander
zu halten, und diefer Umftand hat auch wohl
die Meinung hervorgerufen, daß alles Steinzeug
diefer Ärt deutfchen Urfprungs ift, bis fpäter
die an verfchiedenen Stellen in der Gegend von
Charleroi gemachten Funde, fowie andere Nach-
weife dazu führten, den wallonifchen Werkftätten
ihr Recht widerfahren zu laffen. Von diefen
gab es um 1550 nachweislich 25, die außer der
gewöhnlichen Ware auch Statuetten und Büften
von Heiligen, architektonifche Motive, Öfen u. a.
anfertigten. DerAbfalj erweiterte fich, befonders
feit der Wettbewerb der Raerener Erzeugniffe
nachgelaffen, im 17. Jahrhundert derart, daß die
Produktion faft eine Million Gegenftände er-
reichte, von denen durch Vermittelung von
Töpfereigefchäften viel exportiert wurde. Für
die Niederlande blieben die Orte Bouffioulx und
Chatelet unumfchränkte Lieferanten. Ende des
16. Jahrhunderts traten die Siegburger und an-
dere Typen hinzu, graues Steinzeug mit blauem
Dekor, violetten und purpurnen Emailtönen, durch
Kobalt und Mangan erzeugt. Die Ornamentik
veränderte fich. Allmählich machte fich aber
dann die Konkurrenz des Porzellans und der
Fayencen fühlbar. Man verfuchte das Steingut
dem neuen Material entfprechend zu dekorieren
und es dem veränderten Charakter anzupaffen.
Dadurch verlor fich der Gefchmack und der Ab-
fa§ ließ nach. Während der Periode der Pro-
fperität wurden in anderen Orten Belgiens,
Namur, Dinant, Verviers, Werkftätten errichtet,
aber die Erde war für die Fabrikation nicht
geeignet, fo daß die eingangs genannten wallo-
nifchen Orte ihre Überlegenheit behauptet haben.
Von Ende des 18. Jahrhunderts an verfiel die
Produktion ins Gewöhnliche und in die Maffen-
artikel für den täglichen Gebrauch. F. M.
138
Es galt lange Zeit hindurch als feftftehend, daß
alle Topfwaren aus Steingut deutfches Fabri-
kat feien. Diefe Thefe wurde fpäter von Schür-
manns angefochten, und als bei dem wallonifchen
Örtchen Bouffioulx ein Fund lokalen Urfprungs
gemacht wurde, ging der Forfcher D. R. van
Baftelaer, Vater des Konfervators desBrüffeler
Kupferftichkabinetts, der Sache mehr auf den
Grund. Er wies nach, daß außer dem genannten
Ort auch in den ebenfalls in der Nähe von
Charleroi gelegenen Dörfern Chatelet und
Pont-de-Loup Töpfe, Krüge, Vafen, Becher,
Taffen, Tintenfäffer, Weihwafferbehälter ufw.
fabriziert wurden. Die im Ärchäologifchen Mu-
feum von Charleroi aufgeftellten Stücke ftammen
aus Gruben ehemaliger Fabriken in Bouffioulx
und Chatelet, die man aufgefunden hat und die
äußerft wertvoll find. Der veiftorbene van Ba-
ftelaer begann feine Mitteilungen 1880, ver-
öffentlichte dann mehrere Jahre hindurch Berichte
über die fukzeffive gemachten Erfahrungen, fo
daß allmählich ein Werk von 400 Seiten über
diefen Gegenftand mit Illuftrationen in Bunt-
druck zur Publikation gelangte. Inzwifchen
wurden bei Gelegenheit von Äusftellungen, fo
auf einer von alter belgifcher Kunft im „Cin-
quantenaire“, Proben der wallonifchen Stein-
zeugfabrikation vorgewiefen.
Schon im 9. Jahrhundert wurden an den Ufern
der Sambre Töpferwaren erzeugt, die aber bis
zum 12. Jahrhundert fehr primitive Formen hatten
und an fränkifche Poterien erinnerten. Ällmäh-
lich vervollkommneten fich die Typen, fie zeigten
gefchmackvollere Linien, intenfivere Farben, die
Trinktöpfe trugen Medaillons mit dem Wappen
der Befteller, humoriftifche Gefichter mit Bärten,
und es wurden Stechern wie Floris, Jeröme
Cock u. a. Sujets entlehnt und diefe plaftifch
verwendet. Auf einzelnen Krügen, Bouffioulx
1574 datiert, fieht man fogar Gruppen tanzender
Bauern. Die Produkte diefer Zeit ähneln dann
folchen von Raeren und Frechen, fo daß es
fchwer ift, die beiden Provenancen auseinander
zu halten, und diefer Umftand hat auch wohl
die Meinung hervorgerufen, daß alles Steinzeug
diefer Ärt deutfchen Urfprungs ift, bis fpäter
die an verfchiedenen Stellen in der Gegend von
Charleroi gemachten Funde, fowie andere Nach-
weife dazu führten, den wallonifchen Werkftätten
ihr Recht widerfahren zu laffen. Von diefen
gab es um 1550 nachweislich 25, die außer der
gewöhnlichen Ware auch Statuetten und Büften
von Heiligen, architektonifche Motive, Öfen u. a.
anfertigten. DerAbfalj erweiterte fich, befonders
feit der Wettbewerb der Raerener Erzeugniffe
nachgelaffen, im 17. Jahrhundert derart, daß die
Produktion faft eine Million Gegenftände er-
reichte, von denen durch Vermittelung von
Töpfereigefchäften viel exportiert wurde. Für
die Niederlande blieben die Orte Bouffioulx und
Chatelet unumfchränkte Lieferanten. Ende des
16. Jahrhunderts traten die Siegburger und an-
dere Typen hinzu, graues Steinzeug mit blauem
Dekor, violetten und purpurnen Emailtönen, durch
Kobalt und Mangan erzeugt. Die Ornamentik
veränderte fich. Allmählich machte fich aber
dann die Konkurrenz des Porzellans und der
Fayencen fühlbar. Man verfuchte das Steingut
dem neuen Material entfprechend zu dekorieren
und es dem veränderten Charakter anzupaffen.
Dadurch verlor fich der Gefchmack und der Ab-
fa§ ließ nach. Während der Periode der Pro-
fperität wurden in anderen Orten Belgiens,
Namur, Dinant, Verviers, Werkftätten errichtet,
aber die Erde war für die Fabrikation nicht
geeignet, fo daß die eingangs genannten wallo-
nifchen Orte ihre Überlegenheit behauptet haben.
Von Ende des 18. Jahrhunderts an verfiel die
Produktion ins Gewöhnliche und in die Maffen-
artikel für den täglichen Gebrauch. F. M.
138