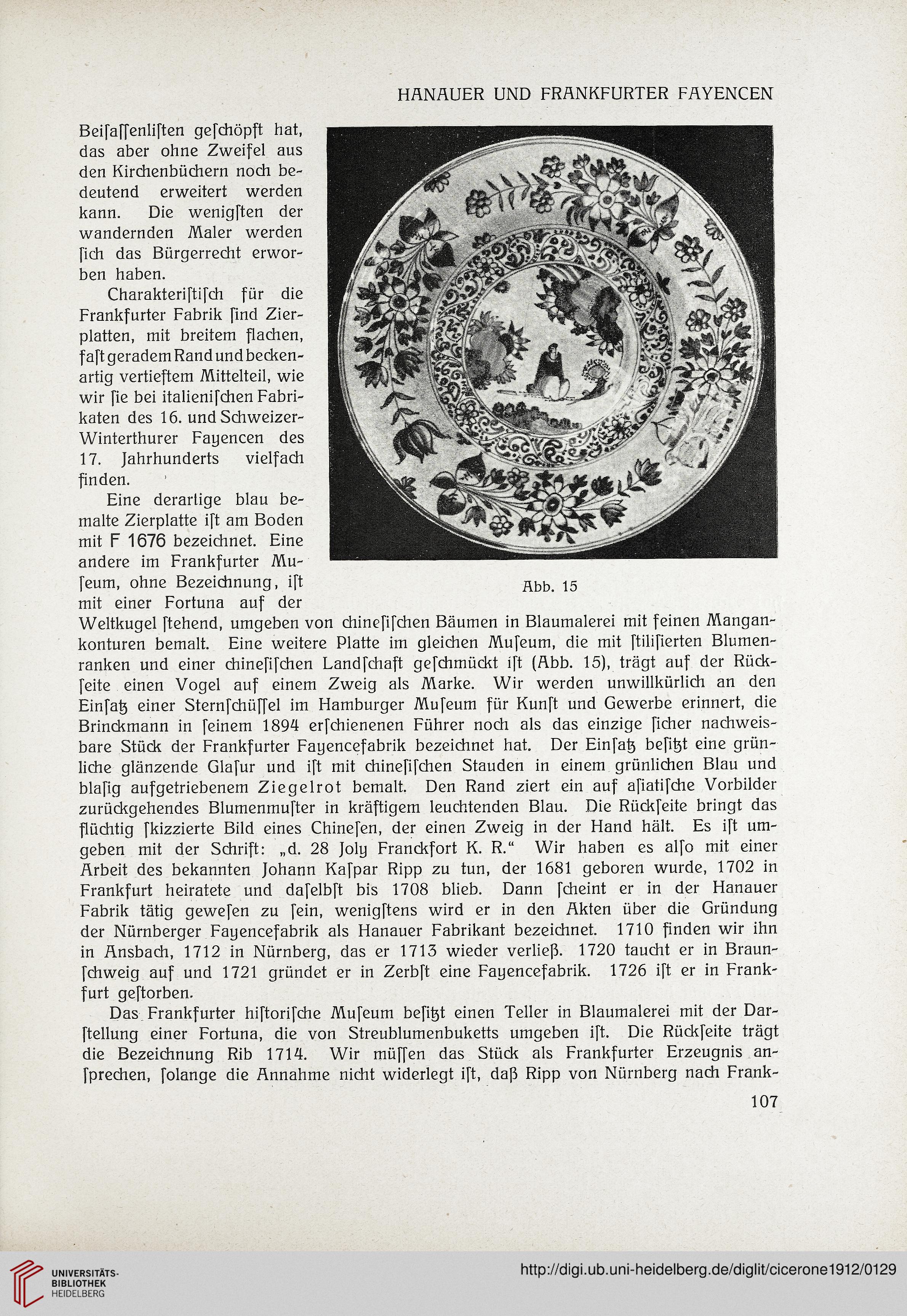Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0129
DOI Heft:
3. Heft
DOI Artikel:Stoehr, August: Hanauer und Frankfurter Fayencen, [2]: Versuch einer Trennung
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0129
HANAUER UND FRANKFURTER FAYENCEN
Beifaffenliften gefchöpft hat,
das aber ohne Zweifel aus
den Kirchenbüchern noch be-
deutend erweitert werden
kann. Die wenigften der
wandernden Maler werden
fich das Bürgerrecht erwor-
ben haben.
Charakteriftifch für die
Frankfurter Fabrik find Zier-
platten, mit breitem flachen,
f aft geradem Rand und becken-
artig vertieftem Mittelteil, wie
wir fie bei italienifchen Fabri-
katen des 16. und Schweizer-
Winterthurer Fayencen des
17. Jahrhunderts vielfach
finden.
Eine derartige blau be-
malte Zierplatte ift am Boden
mit F 1676 bezeichnet. Eine
andere im Frankfurter Mu-
feum, ohne Bezeichnung, ift
mit einer Fortuna auf der
Weltkugel ftehend, umgeben von chinefifchen Bäumen in Blaumalerei mit feinen Mangan-
konturen bemalt. Eine weitere Platte im gleichen Mufeum, die mit ftilifierten Blumen-
ranken und einer chinefifchen Landfchaft gefchmückt ift (Abb. 15), trägt auf der Rück-
feite einen Vogel auf einem Zweig als Marke. Wir werden unwillkürlich an den
Einfat^ einer Sternfchüffel im Hamburger Mufeum für Kunft und Gewerbe erinnert, die
Brinckmann in feinem 1894 erfchienenen Führer noch als das einzige ficher nachweis-
bare Stück der Frankfurter Fayencefabrik bezeichnet hat. Der Einfafs befiljt eine grün-
liche glänzende Glafur und ift mit chinefifchen Stauden in einem grünlichen Blau und
blafig aufgetriebenem Ziegelrot bemalt. Den Rand ziert ein auf afiatifche Vorbilder
zurückgehendes Blumenmufter in kräftigem leuchtenden Blau. Die Rückfeite bringt das
flüchtig fkizzierte Bild eines Chinefen, der einen Zweig in der Hand hält. Es ift um-
geben mit der Schrift: „d. 28 Joly Franckfort K. R.“ Wir haben es alfo mit einer
Arbeit des bekannten Johann Kafpar Ripp zu tun, der 1681 geboren wurde, 1702 in
Frankfurt heiratete und dafelbft bis 1708 blieb. Dann fcheint er in der Hanauer
Fabrik tätig gewefen zu fein, wenigftens wird er in den Akten über die Gründung
der Nürnberger Fayencefabrik als Hanauer Fabrikant bezeichnet. 1710 finden wir ihn
in Ansbach, 1712 in Nürnberg, das er 1713 wieder verließ. 1720 taucht er in Braun-
fchweig auf und 1721 gründet er in Zerbft eine Fayencefabrik. 1726 ift er in Frank-
furt geftorben.
Das Frankfurter hiftorifche Mufeum befitjt einen Teller in Blaumalerei mit der Dar-
ftellung einer Fortuna, die von Streublumenbuketts umgeben ift. Die Rückfeite trägt
die Bezeichnung Rib 1714. Wir müffen das Stück als Frankfurter Erzeugnis an-
fprechen, folange die Annahme nicht widerlegt ift, daß Ripp von Nürnberg nach Frank-
Äbb. 15
107
Beifaffenliften gefchöpft hat,
das aber ohne Zweifel aus
den Kirchenbüchern noch be-
deutend erweitert werden
kann. Die wenigften der
wandernden Maler werden
fich das Bürgerrecht erwor-
ben haben.
Charakteriftifch für die
Frankfurter Fabrik find Zier-
platten, mit breitem flachen,
f aft geradem Rand und becken-
artig vertieftem Mittelteil, wie
wir fie bei italienifchen Fabri-
katen des 16. und Schweizer-
Winterthurer Fayencen des
17. Jahrhunderts vielfach
finden.
Eine derartige blau be-
malte Zierplatte ift am Boden
mit F 1676 bezeichnet. Eine
andere im Frankfurter Mu-
feum, ohne Bezeichnung, ift
mit einer Fortuna auf der
Weltkugel ftehend, umgeben von chinefifchen Bäumen in Blaumalerei mit feinen Mangan-
konturen bemalt. Eine weitere Platte im gleichen Mufeum, die mit ftilifierten Blumen-
ranken und einer chinefifchen Landfchaft gefchmückt ift (Abb. 15), trägt auf der Rück-
feite einen Vogel auf einem Zweig als Marke. Wir werden unwillkürlich an den
Einfat^ einer Sternfchüffel im Hamburger Mufeum für Kunft und Gewerbe erinnert, die
Brinckmann in feinem 1894 erfchienenen Führer noch als das einzige ficher nachweis-
bare Stück der Frankfurter Fayencefabrik bezeichnet hat. Der Einfafs befiljt eine grün-
liche glänzende Glafur und ift mit chinefifchen Stauden in einem grünlichen Blau und
blafig aufgetriebenem Ziegelrot bemalt. Den Rand ziert ein auf afiatifche Vorbilder
zurückgehendes Blumenmufter in kräftigem leuchtenden Blau. Die Rückfeite bringt das
flüchtig fkizzierte Bild eines Chinefen, der einen Zweig in der Hand hält. Es ift um-
geben mit der Schrift: „d. 28 Joly Franckfort K. R.“ Wir haben es alfo mit einer
Arbeit des bekannten Johann Kafpar Ripp zu tun, der 1681 geboren wurde, 1702 in
Frankfurt heiratete und dafelbft bis 1708 blieb. Dann fcheint er in der Hanauer
Fabrik tätig gewefen zu fein, wenigftens wird er in den Akten über die Gründung
der Nürnberger Fayencefabrik als Hanauer Fabrikant bezeichnet. 1710 finden wir ihn
in Ansbach, 1712 in Nürnberg, das er 1713 wieder verließ. 1720 taucht er in Braun-
fchweig auf und 1721 gründet er in Zerbft eine Fayencefabrik. 1726 ift er in Frank-
furt geftorben.
Das Frankfurter hiftorifche Mufeum befitjt einen Teller in Blaumalerei mit der Dar-
ftellung einer Fortuna, die von Streublumenbuketts umgeben ift. Die Rückfeite trägt
die Bezeichnung Rib 1714. Wir müffen das Stück als Frankfurter Erzeugnis an-
fprechen, folange die Annahme nicht widerlegt ift, daß Ripp von Nürnberg nach Frank-
Äbb. 15
107