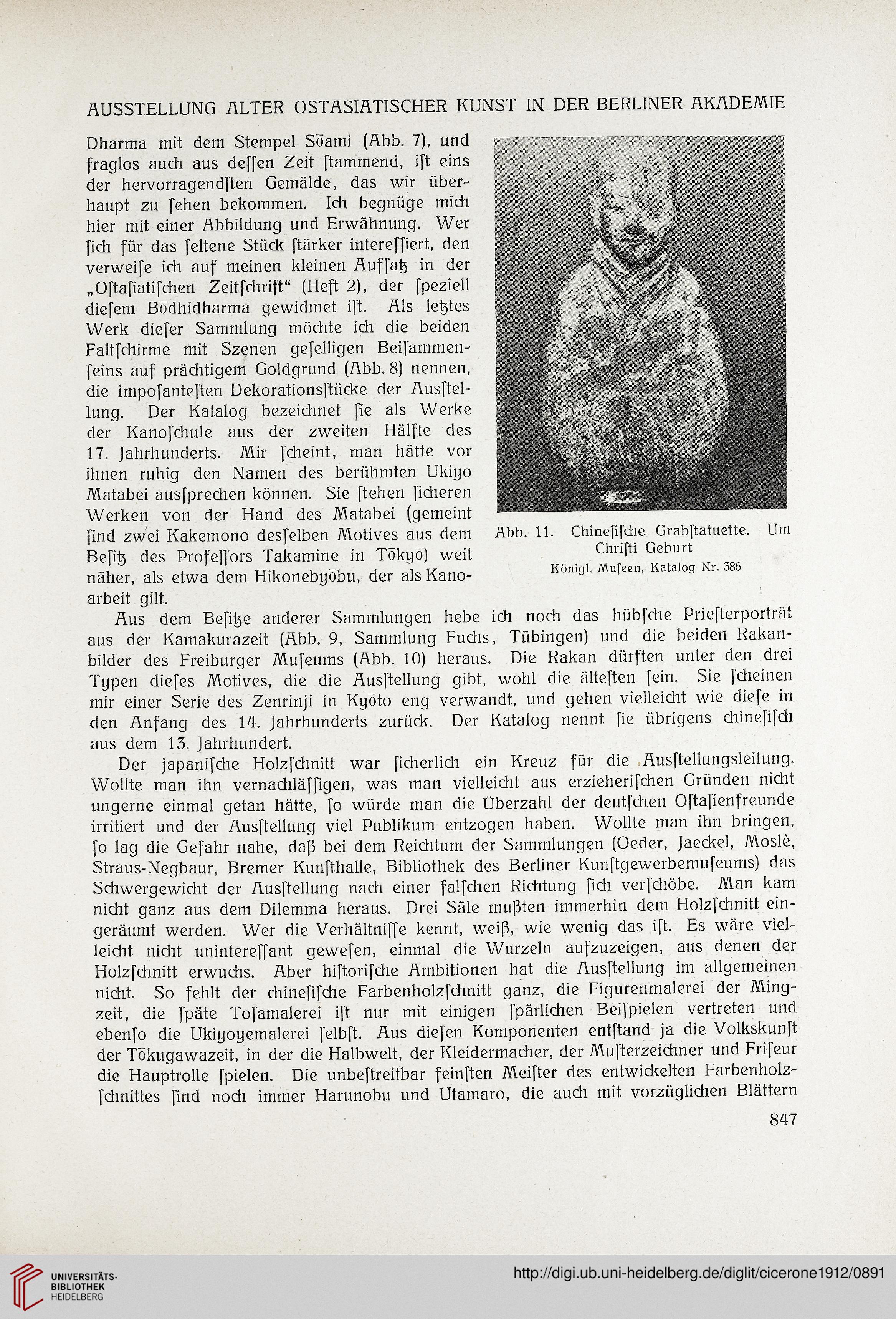Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 4.1912
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0891
DOI issue:
22. Heft
DOI article:Cohn, William: Die Ausstellung alter ostasiatischer Kunst in der Berliner Akademie der Künste
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.25673#0891
AUSSTELLUNG ALTER OSTÄSIATISCHER KUNST IN DER BERLINER AKADEMIE
Dharma mit dem Stempel Söami (Abb. 7), und
fraglos auch aus deffen Zeit ftammend, ift eins
der hervorragenden Gemälde, das wir über-
haupt zu fehen bekommen. Ich begnüge midi
hier mit einer Abbildung und Erwähnung. Wer
[ich für das feltene Stück ftärker intereffiert, den
verweife ich auf meinen kleinen Auffaß in der
„Oftafiatifchen Zeitfchrift“ (Heft 2), der fpeziell
diefem Bödhidharma gewidmet ift. Als letztes
Werk diefer Sammlung möchte ich die beiden
Faltfchirme mit Szenen gefelligen Beifammen-
feins auf prächtigem Goldgrund (Abb. 8) nennen,
die impofanteften Dekorationsftücke der Aushei-
lung. Der Katalog bezeichnet Jle als Werke
der Kanofchule aus der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts. Mir fcheint, man hätte vor
ihnen ruhig den Namen des berühmten Ukiyo
Matabei ausfprechen können. Sie ftehen ficheren
Werken von der Hand des Matabei (gemeint
find zwei Kakemono desfelben Motives aus dem Abb. 11. Chinefifche Grabftatuette. Um
Befiß des Profeffors Takamine in Tokyo) weit Chrifti Geburt
näher, als etwa dem Hikonebyöbu, der als Kano- Komgi. Mufeen, Katalog Nr. o86
arbeit gilt.
Aus dem Befiße anderer Sammlungen hebe ich noch das hübfche Priefterporträt
aus der Kamakurazeit (Abb. 9, Sammlung Fuchs, Tübingen) und die beiden Rakan-
bilder des Freiburger Mufeums (Abb. 10) heraus. Die Rakan dürften unter den drei
Typen diefes Motives, die die Ausftellung gibt, wohl die älteften fein. Sie fcheinen
mir einer Serie des Zenrinji in Kyoto eng verwandt, und gehen vielleicht wie diefe in
den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. Der Katalog nennt fie übrigens chinefifch
aus dem 13. Jahrhundert.
Der japanifche Holzfchnitt war ficherlich ein Kreuz für die Ausftellungsleitung.
Wollte man ihn vernachläffigen, was man vielleicht aus erzieherifchen Gründen nicht
ungerne einmal getan hätte, fo würde man die Überzahl der deutfchen Oftafienfreunde
irritiert und der Ausftellung viel Publikum entzogen haben. Wollte man ihn bringen,
fo lag die Gefahr nahe, daß bei dem Reichtum der Sammlungen (Oeder, Jaeckel, Mosle,
Straus-Negbaur, Bremer Kunfthalle, Bibliothek des Berliner Kunftgewerbemufeums) das
Schwergewicht der Ausftellung nach einer falfchen Richtung fich verfchöbe. Man kam
nicht ganz aus dem Dilemma heraus. Drei Säle mußten immerhin dem Holzfchnitt ein-
geräumt werden. Wer die Verhältniffe kennt, weiß, wie wenig das ift. Es wäre viel-
leicht nicht unintereffant gewefen, einmal die Wurzeln aufzuzeigen, aus denen der
Holzfchnitt erwuchs. Aber hiftorifche Ambitionen hat die Ausftellung im allgemeinen
nicht. So fehlt der chinefifche Farbenholzfchnitt ganz, die Figurenmalerei der Ming-
zeit, die fpäte Tofamalerei ift nur mit einigen fpärlichen Beifpielen vertreten und
ebenfo die Ukiyoyemalerei felbft. Aus diefen Komponenten entftand ja die Volkskunft
der Tökugawazeit, in der die Halbwelt, der Kleidermacher, der Mufterzeichner und Frifeur
die Hauptrolle fpielen. Die unbeftreitbar feinften Meifter des entwickelten Farbenholz-
fchnittes find noch immer Harunobu und Utamaro, die auch mit vorzüglichen Blättern
847
Dharma mit dem Stempel Söami (Abb. 7), und
fraglos auch aus deffen Zeit ftammend, ift eins
der hervorragenden Gemälde, das wir über-
haupt zu fehen bekommen. Ich begnüge midi
hier mit einer Abbildung und Erwähnung. Wer
[ich für das feltene Stück ftärker intereffiert, den
verweife ich auf meinen kleinen Auffaß in der
„Oftafiatifchen Zeitfchrift“ (Heft 2), der fpeziell
diefem Bödhidharma gewidmet ift. Als letztes
Werk diefer Sammlung möchte ich die beiden
Faltfchirme mit Szenen gefelligen Beifammen-
feins auf prächtigem Goldgrund (Abb. 8) nennen,
die impofanteften Dekorationsftücke der Aushei-
lung. Der Katalog bezeichnet Jle als Werke
der Kanofchule aus der zweiten Hälfte des
17. Jahrhunderts. Mir fcheint, man hätte vor
ihnen ruhig den Namen des berühmten Ukiyo
Matabei ausfprechen können. Sie ftehen ficheren
Werken von der Hand des Matabei (gemeint
find zwei Kakemono desfelben Motives aus dem Abb. 11. Chinefifche Grabftatuette. Um
Befiß des Profeffors Takamine in Tokyo) weit Chrifti Geburt
näher, als etwa dem Hikonebyöbu, der als Kano- Komgi. Mufeen, Katalog Nr. o86
arbeit gilt.
Aus dem Befiße anderer Sammlungen hebe ich noch das hübfche Priefterporträt
aus der Kamakurazeit (Abb. 9, Sammlung Fuchs, Tübingen) und die beiden Rakan-
bilder des Freiburger Mufeums (Abb. 10) heraus. Die Rakan dürften unter den drei
Typen diefes Motives, die die Ausftellung gibt, wohl die älteften fein. Sie fcheinen
mir einer Serie des Zenrinji in Kyoto eng verwandt, und gehen vielleicht wie diefe in
den Anfang des 14. Jahrhunderts zurück. Der Katalog nennt fie übrigens chinefifch
aus dem 13. Jahrhundert.
Der japanifche Holzfchnitt war ficherlich ein Kreuz für die Ausftellungsleitung.
Wollte man ihn vernachläffigen, was man vielleicht aus erzieherifchen Gründen nicht
ungerne einmal getan hätte, fo würde man die Überzahl der deutfchen Oftafienfreunde
irritiert und der Ausftellung viel Publikum entzogen haben. Wollte man ihn bringen,
fo lag die Gefahr nahe, daß bei dem Reichtum der Sammlungen (Oeder, Jaeckel, Mosle,
Straus-Negbaur, Bremer Kunfthalle, Bibliothek des Berliner Kunftgewerbemufeums) das
Schwergewicht der Ausftellung nach einer falfchen Richtung fich verfchöbe. Man kam
nicht ganz aus dem Dilemma heraus. Drei Säle mußten immerhin dem Holzfchnitt ein-
geräumt werden. Wer die Verhältniffe kennt, weiß, wie wenig das ift. Es wäre viel-
leicht nicht unintereffant gewefen, einmal die Wurzeln aufzuzeigen, aus denen der
Holzfchnitt erwuchs. Aber hiftorifche Ambitionen hat die Ausftellung im allgemeinen
nicht. So fehlt der chinefifche Farbenholzfchnitt ganz, die Figurenmalerei der Ming-
zeit, die fpäte Tofamalerei ift nur mit einigen fpärlichen Beifpielen vertreten und
ebenfo die Ukiyoyemalerei felbft. Aus diefen Komponenten entftand ja die Volkskunft
der Tökugawazeit, in der die Halbwelt, der Kleidermacher, der Mufterzeichner und Frifeur
die Hauptrolle fpielen. Die unbeftreitbar feinften Meifter des entwickelten Farbenholz-
fchnittes find noch immer Harunobu und Utamaro, die auch mit vorzüglichen Blättern
847