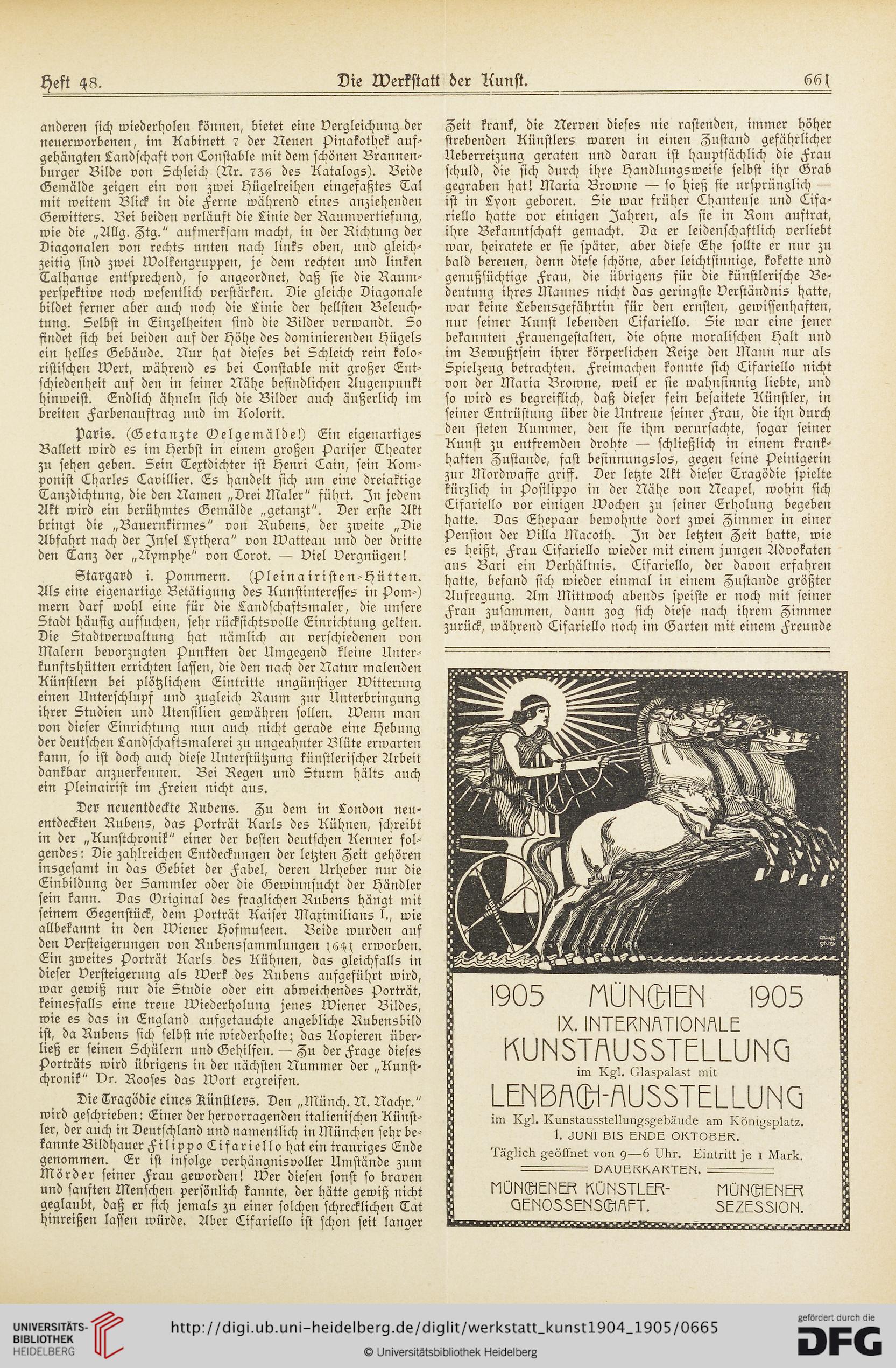Die Werkstatt der Kunst: Organ für d. Interessen d. bildenden Künstler — 4.1904/1905
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.42122#0665
DOI issue:
Heft 48
DOI article:Todesfälle / Gedenktage / Aus Künstler-Vereinen / Aus Kunstvereinen / Vom Kunsthandel / Aus Galerien und Museen / Auktionen / Vermischtes / Literatur-Umschau / Briefkasten der Schriftleitung / Werbung
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.42122#0665
Heft fl>8.
Die Werkstatt der Aunst.
66t
anderen sich wiederholen können, bietet eine Vergleichung der
neuerworbenen, im Kabinett 7 der Neuen Pinakothek auf-
gehängten Landschaft von Constable mit dem schönen Brannen-
burger Bilde von Schleich (Nr. 736 des Katalogs). Beide
Gemälde zeigen ein von zwei Hügelreihen eingefaßtes Tal
mit weitem Blick in die Ferne während eines anziehenden
Gewitters. Bei beiden verläuft die Linie der Raumvertiefung,
wie die „Allg. Ztg." aufmerksam macht, in der Richtung der
Diagonalen von rechts unten nach links oben, und gleich-
zeitig sind zwei Wolkengruppen, je dem rechten und linken
Talhange entsprechend, so angeordnet, daß sie die Raum-
perspektive noch wesentlich verstärken. Die gleiche Diagonale
bildet ferner aber auch noch die Linie der hellsten Beleuch-
tung. Selbst in Einzelheiten sind die Bilder verwandt. So
findet sich bei beiden aus der Höhe des dominierenden Hügels
ein Helles Gebäude. Nur hat dieses bei Schleich rein kolo-
ristischen wert, während es bei Constable mit großer Ent-
schiedenheit auf den in seiner Nähe befindlichen Augenpunkt
hinweist. Endlich ähneln sich die Bilder auch äußerlich im
breiten Farbenauftrag und im Kolorit.
Paris. (Getanzte Delgemälde!) Ein eigenartiges
Ballett wird es im Herbst in einem großen pariser Theater
zu sehen geben. Sein Textdichter ist Henri Lain, sein Kom-
ponist Charles Lavillier. Es handelt sich um eine dreiaktige
Tanzdichtung, die den Namen „Drei Maler" führt. In jedem
Akt wird ein berühmtes Gemälde „getanzt". Der erste Akt
bringt die „Bauernkirmes" von Rubens, der zweite „Die
Abfahrt nach der Insel Lythera" von Watteau und der dritte
den Tanz der „Nymphe" von Corot. — viel Vergnügen!
Stargard i. Pommern. (Plein a iristen-Hütten.
Als eine eigenartige Betätigung des Kunstinteresses in Pom-)
mern darf wohl eine für die Landschaftsmaler, die unsere
Stadt häufig aufsuchen, sehr rücksichtsvolle Einrichtung gelten.
Die Stadtverwaltung hat nämlich an verschiedenen von
Malern bevorzugten Punkten der Umgegend kleine Unter-
kunftshütten errichten lassen, die den nach der Natur malenden
Künstlern bei plötzlichem Eintritte ungünstiger Witterung
einen Unterschlupf und zugleich Raum zur Unterbringung
ihrer Studien und Utensilien gewähren sollen, wenn man
von dieser Einrichtung nun auch nicht gerade eine Hebung
der deutschen Landschaftsmalerei zu ungeahnter Blüte erwarten
kann, so ist doch auch diese Unterstützung künstlerischer Arbeit
dankbar anzuerkennen. Bei Regen und Sturm hälts auch
ein pleinairist im Freien nicht aus.
Der neuentdeckte Rubens. Zu dem in London neu-
entdeckten Rubens, das Porträt Karls des Kühnen, schreibt
in der „Kunstchronik" einer der besten deutschen Kenner fol-
gendes: Die zahlreichen Entdeckungen der letzten Zeit gehören
insgesamt in das Gebiet der Fabel, deren Urheber nur die
Einbildung der Sammler oder die Gewinnsucht der Händler
sein kann. Das Original des fraglichen Rubens hängt mit
seinem Gegenstück, dem Porträt Kaiser Maximilians I-, wie
allbekannt in den wiener Hofmuseen. Beide wurden auf
den Versteigerungen von Rubenssammlungen ;6Ht erworben.
Ein zweites Porträt Karls des Kühnen, das gleichfalls in
dieser Versteigerung als Werk des Rubens aufgeführt wird,
war gewiß nur die Studie oder ein abweichendes Porträt,
keinesfalls eine treue Wiederholung jenes wiener Bildes,
wie es das in England aufgetauchte angebliche Rubensbild
ist, da Rubens sich selbst nie wiederholte; das Kopieren über-
ließ er seinen Schülern und Gehilfen. — Zu der Frage dieses
Porträts wird übrigens in der nächsten Nummer der „Kunst-
chronik" Vr. Rooses das Wort ergreifen.
Die Tragödie eines Künstlers. Den „Münch. N. Nachr."
wird geschrieben: Einer der hervorragenden italienischen Künst-
ler, der auch in Deutschland und namentlich in München sehr be-
kannte Bildhauer Filippo Cifariello hat ein trauriges Ende
genommen. Er ist infolge verhängnisvoller Umstände zum
Mörder seiner Frau geworden! wer diesen sonst so braven
und sanften Menschen persönlich kannte, der hätte gewiß nicht
geglaubt, daß er sich jemals zu einer solchen schrecklichen Tat
Hinreißen lassen würde. Aber Cifariello ist schon seit langer
Zeit krank, die Nerven dieses nie rastenden, immer höher
strebenden Künstlers waren in einen Zustand gefährlicher
Ueberreizung geraten und daran ist hauptsächlich die Frau
schuld, die sich durch ihre Handlungsweise selbst ihr Grab
gegraben hat! Maria Browne — so hieß sie ursprünglich —
ist in Lyon geboren. Sie war früher Chanteuse und Cifa-
riello hatte vor einigen Jahren, als sie in Rom auftrat,
ihre Bekanntschaft gemacht. Da er leidenschaftlich verliebt
war, heiratete er sie später, aber diese Ehe sollte er nur zu
bald bereuen, denn diese schöne, aber leichtsinnige, kokette und
genußsüchtige Frau, die übrigens für die künstlerische Be-
deutung ihres Mannes nicht das geringste Verständnis hatte,
war keine Lebensgefährtin für den ernsten, gewissenhaften,
nur seiner Kunst lebenden Cifariello. Sie war eine jener
bekannten Frauengestalten, die ohne moralischen Halt und
im Bewußtsein ihrer körperlichen Reize den Mann nur als
Spielzeug betrachten. Freimachen konnte sich Cifariello nicht
von der Maria Browne, weil er sie wahnsinnig liebte, und
so wird es begreiflich, daß dieser fein besaitete Künstler, in
seiner Entrüstung über die Untreue seiner Frau, die ihn durch
den steten Kummer, den sie ihm verursachte, sogar seiner
Kunst zu entfremden drohte — schließlich in einem krank-
haften Zustande, fast besinnungslos, gegen seine Peinigerin
zur Mordwaffe griff. Der letzte Akt dieser Tragödie spielte
kürzlich in Posilippo in der Nähe von Neapel, wohin sich
Cifariello vor einigen Wochen zu seiner Erholung begehen
hatte. Das Ehepaar bewohnte dort zwei Zimmer in einer
Pension der Villa Macoth. In der letzten Zeit hatte, wie
es heißt, Frau Cifariello wieder mit einem jungen Advokaten
aus Bari ein Verhältnis. Cifariello, der davon erfahren
hatte, befand sich wieder einmal in einem Zustande größter
Aufregung. Am Mittwoch abends speiste er noch mit seiner
Frau zusammen, dann zog sich diese nach ihrem Zimmer
zurück, während Cifariello noch im Garten mit einem Freunde
!X.
ÜM 8E7U557 M di H
iw !<§!. KnnstLusst.s11un§s§ebLuäe am IvoniZsplLtr.
l. allk-N 613 63HD6 0^066^.
lla§Iicll §eö6net von 9—6 vbr. Eintritt je 1 Narlr.
Die Werkstatt der Aunst.
66t
anderen sich wiederholen können, bietet eine Vergleichung der
neuerworbenen, im Kabinett 7 der Neuen Pinakothek auf-
gehängten Landschaft von Constable mit dem schönen Brannen-
burger Bilde von Schleich (Nr. 736 des Katalogs). Beide
Gemälde zeigen ein von zwei Hügelreihen eingefaßtes Tal
mit weitem Blick in die Ferne während eines anziehenden
Gewitters. Bei beiden verläuft die Linie der Raumvertiefung,
wie die „Allg. Ztg." aufmerksam macht, in der Richtung der
Diagonalen von rechts unten nach links oben, und gleich-
zeitig sind zwei Wolkengruppen, je dem rechten und linken
Talhange entsprechend, so angeordnet, daß sie die Raum-
perspektive noch wesentlich verstärken. Die gleiche Diagonale
bildet ferner aber auch noch die Linie der hellsten Beleuch-
tung. Selbst in Einzelheiten sind die Bilder verwandt. So
findet sich bei beiden aus der Höhe des dominierenden Hügels
ein Helles Gebäude. Nur hat dieses bei Schleich rein kolo-
ristischen wert, während es bei Constable mit großer Ent-
schiedenheit auf den in seiner Nähe befindlichen Augenpunkt
hinweist. Endlich ähneln sich die Bilder auch äußerlich im
breiten Farbenauftrag und im Kolorit.
Paris. (Getanzte Delgemälde!) Ein eigenartiges
Ballett wird es im Herbst in einem großen pariser Theater
zu sehen geben. Sein Textdichter ist Henri Lain, sein Kom-
ponist Charles Lavillier. Es handelt sich um eine dreiaktige
Tanzdichtung, die den Namen „Drei Maler" führt. In jedem
Akt wird ein berühmtes Gemälde „getanzt". Der erste Akt
bringt die „Bauernkirmes" von Rubens, der zweite „Die
Abfahrt nach der Insel Lythera" von Watteau und der dritte
den Tanz der „Nymphe" von Corot. — viel Vergnügen!
Stargard i. Pommern. (Plein a iristen-Hütten.
Als eine eigenartige Betätigung des Kunstinteresses in Pom-)
mern darf wohl eine für die Landschaftsmaler, die unsere
Stadt häufig aufsuchen, sehr rücksichtsvolle Einrichtung gelten.
Die Stadtverwaltung hat nämlich an verschiedenen von
Malern bevorzugten Punkten der Umgegend kleine Unter-
kunftshütten errichten lassen, die den nach der Natur malenden
Künstlern bei plötzlichem Eintritte ungünstiger Witterung
einen Unterschlupf und zugleich Raum zur Unterbringung
ihrer Studien und Utensilien gewähren sollen, wenn man
von dieser Einrichtung nun auch nicht gerade eine Hebung
der deutschen Landschaftsmalerei zu ungeahnter Blüte erwarten
kann, so ist doch auch diese Unterstützung künstlerischer Arbeit
dankbar anzuerkennen. Bei Regen und Sturm hälts auch
ein pleinairist im Freien nicht aus.
Der neuentdeckte Rubens. Zu dem in London neu-
entdeckten Rubens, das Porträt Karls des Kühnen, schreibt
in der „Kunstchronik" einer der besten deutschen Kenner fol-
gendes: Die zahlreichen Entdeckungen der letzten Zeit gehören
insgesamt in das Gebiet der Fabel, deren Urheber nur die
Einbildung der Sammler oder die Gewinnsucht der Händler
sein kann. Das Original des fraglichen Rubens hängt mit
seinem Gegenstück, dem Porträt Kaiser Maximilians I-, wie
allbekannt in den wiener Hofmuseen. Beide wurden auf
den Versteigerungen von Rubenssammlungen ;6Ht erworben.
Ein zweites Porträt Karls des Kühnen, das gleichfalls in
dieser Versteigerung als Werk des Rubens aufgeführt wird,
war gewiß nur die Studie oder ein abweichendes Porträt,
keinesfalls eine treue Wiederholung jenes wiener Bildes,
wie es das in England aufgetauchte angebliche Rubensbild
ist, da Rubens sich selbst nie wiederholte; das Kopieren über-
ließ er seinen Schülern und Gehilfen. — Zu der Frage dieses
Porträts wird übrigens in der nächsten Nummer der „Kunst-
chronik" Vr. Rooses das Wort ergreifen.
Die Tragödie eines Künstlers. Den „Münch. N. Nachr."
wird geschrieben: Einer der hervorragenden italienischen Künst-
ler, der auch in Deutschland und namentlich in München sehr be-
kannte Bildhauer Filippo Cifariello hat ein trauriges Ende
genommen. Er ist infolge verhängnisvoller Umstände zum
Mörder seiner Frau geworden! wer diesen sonst so braven
und sanften Menschen persönlich kannte, der hätte gewiß nicht
geglaubt, daß er sich jemals zu einer solchen schrecklichen Tat
Hinreißen lassen würde. Aber Cifariello ist schon seit langer
Zeit krank, die Nerven dieses nie rastenden, immer höher
strebenden Künstlers waren in einen Zustand gefährlicher
Ueberreizung geraten und daran ist hauptsächlich die Frau
schuld, die sich durch ihre Handlungsweise selbst ihr Grab
gegraben hat! Maria Browne — so hieß sie ursprünglich —
ist in Lyon geboren. Sie war früher Chanteuse und Cifa-
riello hatte vor einigen Jahren, als sie in Rom auftrat,
ihre Bekanntschaft gemacht. Da er leidenschaftlich verliebt
war, heiratete er sie später, aber diese Ehe sollte er nur zu
bald bereuen, denn diese schöne, aber leichtsinnige, kokette und
genußsüchtige Frau, die übrigens für die künstlerische Be-
deutung ihres Mannes nicht das geringste Verständnis hatte,
war keine Lebensgefährtin für den ernsten, gewissenhaften,
nur seiner Kunst lebenden Cifariello. Sie war eine jener
bekannten Frauengestalten, die ohne moralischen Halt und
im Bewußtsein ihrer körperlichen Reize den Mann nur als
Spielzeug betrachten. Freimachen konnte sich Cifariello nicht
von der Maria Browne, weil er sie wahnsinnig liebte, und
so wird es begreiflich, daß dieser fein besaitete Künstler, in
seiner Entrüstung über die Untreue seiner Frau, die ihn durch
den steten Kummer, den sie ihm verursachte, sogar seiner
Kunst zu entfremden drohte — schließlich in einem krank-
haften Zustande, fast besinnungslos, gegen seine Peinigerin
zur Mordwaffe griff. Der letzte Akt dieser Tragödie spielte
kürzlich in Posilippo in der Nähe von Neapel, wohin sich
Cifariello vor einigen Wochen zu seiner Erholung begehen
hatte. Das Ehepaar bewohnte dort zwei Zimmer in einer
Pension der Villa Macoth. In der letzten Zeit hatte, wie
es heißt, Frau Cifariello wieder mit einem jungen Advokaten
aus Bari ein Verhältnis. Cifariello, der davon erfahren
hatte, befand sich wieder einmal in einem Zustande größter
Aufregung. Am Mittwoch abends speiste er noch mit seiner
Frau zusammen, dann zog sich diese nach ihrem Zimmer
zurück, während Cifariello noch im Garten mit einem Freunde
!X.
ÜM 8E7U557 M di H
iw !<§!. KnnstLusst.s11un§s§ebLuäe am IvoniZsplLtr.
l. allk-N 613 63HD6 0^066^.
lla§Iicll §eö6net von 9—6 vbr. Eintritt je 1 Narlr.