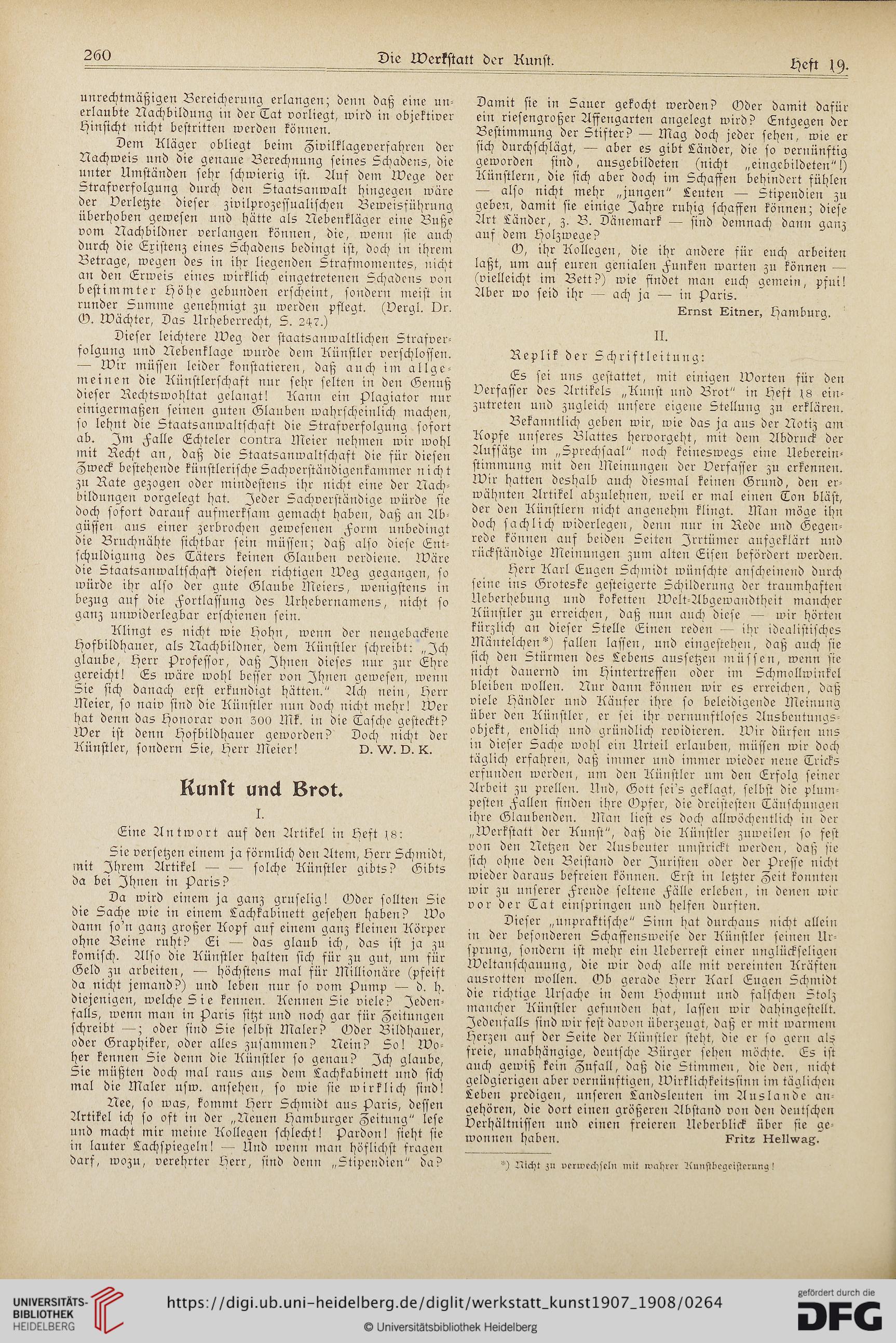Die Werkstatt der Kunst: Organ für d. Interessen d. bildenden Künstler — 7.1907/1908
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.52070#0264
DOI article:
D.W.D.K.: Die Strafverfolgung bei widerrechtlichen Nachbildungen
DOI article:Eitner, Ernst; Hellwag, Fritz: Kunst und Brot, [2]
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.52070#0264
260
Die Werkstatt der Kunst.
heft s9.
unrechtmäßigen Bereicherung erlangen; denn daß eine un-
erlaubte Nachbildung in der Tat vorliegt, wird in objektiver
Einsicht nicht bestritten werden können.
Dem Kläger obliegt beim Zivilklageverfahren der
Nachweis und die genaue Berechnung seines Schadens, die
unter Umständen sehr schwierig ist. Aus dein Wege der
Strafverfolgung durch den Staatsanwalt hingegen wäre
der Verletzte dieser zivilprozessualischen Beweisführung
überhoben gewesen und hätte als Nebenkläger eine Buße
vom Nachbildner verlangen können, die, wenn sie auch
durch die Existenz eines Schadens bedingt ist, doch in ihrem
Betrage, wegen des in ihr liegenden Strafmomentes, nicht
an den Erweis eines wirklich eingetretenen Schadens von
bestimmter Höhe gebunden erscheint, sondern meist in
runder Summe genehmigt zu werden pflegt. (Vergi. Vr.
V. Wächter, Das Urheberrecht, S. 2^7.)
Dieser leichtere Weg der staatsanwaltlichen Strafver-
solgung und Nebenklage wurde dem Künstler verschlossen.
— Wir müssen leider konstatieren, daß auch im allge-
meinen die Künstlerschaft nur sehr selten in den Genuß
dieser Rechtswohltat gelangt! Kann ein Plagiator nur
einigermaßen seinen guten Glauben wahrscheinlich machen,
so lehnt die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung sofort
ab. Im Falle Echteler contra Meier nehmen wir wohl
mit Recht an, daß die Staatsanwaltschaft die für diesen
Zweck bestehende künstlerische Sachverftändigcnkammer nicht
zn Rate gezogen oder mindestens ihr nicht eine der Nach-
bildungen vorgelegt hat. Jeder Sachverständige würde sie
doch sofort darauf aufmerksam gemacht haben, daß an Ab-
güssen aus einer zerbrochen gewesenen Form unbedingt
die Bruchnähte sichtbar sein müssen; daß also diese Ent-
schuldigung des Täters keinen Glauben verdiene. Wäre
die Staatsanwaltschaft diesen richtigen Weg gegangen, so
würde ihr also der gute Glaube Meiers, wenigstens in
bezug aus die Fortlassung des Urhebernamens, nicht so
ganz unwiderlegbar erschienen sein.
Klingt es nicht wie Hohn, wenn der neugebackene
Hosbildhauer, als Nachbildner, dein Künstler schreibt: „Ich
glaube, Herr Professor, daß Ihnen dieses nur zur Ehre
gereicht! Es wäre wohl besser von Ihnen gewesen, wenn
Sie sich danach erst erkundigt hätten." Ach nein, Herr-
Meier, so naiv sind die Künstler nun doch nicht mehr! Wei-
Hat denn das Honorar von 300 Mk. in die Tasche gesteckt?
Wer ist denn Hosbildhauer geworden? Doch nicht der
Künstler, sondern Sie, Herr Meier! O. W. v. X.
Kunst und brot.
i.
Eine Antwort aus den Artikel in Heft t8:
Sie versetzen einem ja förmlich den Atem, Herr Schmidt,
mit Ihrem Artikel — — solche Künstler gibts? Gibts
da bei Ihnen in Paris?
Da wird einem ja ganz gruselig! Gder sollten Sie
die Sache wie in einem Lachkabinett gesehen haben? Wo
dann so'n ganz großer Kops aus einem ganz kleinen Körper
ohne Beine ruht? Ei — das glaub ich, das ist ja zu
komisch. Also die Künstler halten sich für zu gut, um für
Geld zu arbeiten, — höchstens mal für Millionäre (pfeift
da nicht jemand?) und leben nur so vom Pump — d. h.
diejenigen, welche S i e kennen. Kennen Sie viele? Jeden-
falls, wenn man in Paris sitzt und noch gar für Zeitungen
schreibt —; oder sind Sie selbst Maler? Gder Bildhauer,
oder Graphiker, oder alles zusammen? Nein? So! Wo-
her kennen Sie denn die Künstler so genau? Ich glaube,
Sie müßten doch mal raus aus dein Lachkabinett und sich
mal die Maler usw. ansehcn, so wie sie wirklich sind!
Nee, so was, kommt Herr Schmidt aus Paris, dessen
Artikel ich so oft in der „Neuen Hamburger Zeitung" lese
und macht mir meine Kollegen schlecht! Pardon! sieht sie
in lauter Lachspiegeln! — Und wenn man höflichst fragen
darf, wozu, verehrter Herr, sind denn „Stipendien" da?
Damit sie in Sauer gekocht werden? Gder damit dafür
ein riesengroßer Affengarten angelegt wird? Entgegen der
Bestimmung der Stifter? — Mag doch jeder sehen, wie er
sich durchschlägt, — aber es gibt Länder, die so vernünftig
geworden sind, ausgebildeten (nicht „eingebildeten"!)
Künstlern, die sich aber doch im Schaffen behindert fühlen
— also nicht mehr „jungen" Leuten — Stipendien zu
geben, damit sie einige Jahre ruhig schaffen können; diese
Art Länder, z. B. Dänemark — sind demnach dann ganz
auf dem Holzwege?
G, ihr Kollegen, die ihr andere für euch arbeiten
laßt, um auf euren genialen Funken warten zu können —
(vielleicht im Bett?) wie findet man euch gemein, pfui!
Aber wo seid ihr — ach ja — in Paris.
Lrnst Litner, Hamburg.
II.
Replik der Schriftleitung:
Es sei uns gestattet, mit einigen Worten für den
Verfasser des Artikels „Kunst und Brot" in Heft t8 ein-
zutreten und zugleich unsere eigene Stellung zu erklären.
Bekanntlich geben wir, wie das ja aus der Notiz am
Kopfe unseres Blattes hervorgeht, mit dem Abdruck der
Aufsätze im „Sprechsaal" noch keineswegs eine Uebcrein-
stimmung mit den Meinungen der Verfasser zu erkennen,
wir hatten deshalb auch diesmal keinen Grund, den er-
wähnten Artikel abzulehnen, weil er mal einen Ton bläst,
der den Künstlern nicht angenehm klingt. Man möge ihn
doch sachlich widerlegen, denn nur in Rede und Gegen-
rede können auf beiden Seiten Irrtümer aufgeklärt und
rückständige Meinungen zum alten Eisen befördert werden.
Herr Karl Eugen Schmidt wünschte anscheinend durch
seine ins Groteske gesteigerte Schilderung der traumhaften
Ueberhebung und koketten Welt-Abgewandtheit mancher
Künstler zu erreichen, daß nun auch diese — wir hörten
kürzlich an dieser Stelle Einen reden — ihr idealistisches
Mäntelchen*) fallen lassen, und eingestehen, daß auch sie
sich den Stürmen des Lebens aussetzen müssen, wenn sie
nicht dauernd im Hintertreffen oder im Schmollwinkel
bleiben wollen. Nur dann können wir es erreichen, daß
viele Händler und Käufer ihre fo beleidigende Meinung
über den Künstler, er sei ihr vernunftloscs Ausbeutungs-
objekt, endlich und gründlich revidieren. Wir dürfen uns
in dieser Sache wohl ein Urteil erlauben, müssen wir doch
täglich erfahren, daß immer und immer wieder neue Tricks
erfunden werden, um den Künstler um den Erfolg seiner
Arbeit zu prellen. Und, Gott sei's geklagt, selbst die plum-
pesten Fallen finden ihre Vpfer, die dreistesten Täuschungen
ihre Glaubenden. Man liest es doch allwöchentlich in der
„Werkstatt der Kunst", daß die Künstler zuweilen so fest
von den Netzen der Ausbeuter umstrickt werden, daß sie
sich ohne den Beistand der Juristen oder der presse nicht
wieder daraus befreien können. Erst in letzter Zeit konnten
wir zu unserer Freude seltene Fälle erleben, in denen wir
vor der Tat cinspringen und helfen durften.
Dieser „unpraktische" Sinn hat durchaus nicht allein
in der besonderen Schaffensweise der Künstler seinen Ur-
sprung, sondern ist mehr ein Ueberrest einer unglückseligen
Weltanschauung, die wir doch alle mit vereinten Kräften
ausrotten wollen. Gb gerade Herr Karl Eugen Schmidt
die richtige Ursache in dem Hochmut und falschen Stolz
mancher Künstler gesunder: hat, lassen wir dahingestellt.
Jedenfalls sind wir fest davon überzeugt, daß er mit warmem
Herzen auf der Seite der Künstler steht, die er so gern al^
freie, unabhängige, deutsche Bürger sehen möchte. Es ist
auch gewiß kein Zufall, daß die Stimmen, die den, nicht
geldgierigen aber vernünftigen, Wirklichkeitssinn im täglichen
Leben predigen, unseren Landsleuten im Aus lau de an-
gehören, die dort einen größeren Abstand von den deutschen
Verhältnissen und einen freieren Ucbcrblick über sie ge-
wonnen haben. Kritr
Die Werkstatt der Kunst.
heft s9.
unrechtmäßigen Bereicherung erlangen; denn daß eine un-
erlaubte Nachbildung in der Tat vorliegt, wird in objektiver
Einsicht nicht bestritten werden können.
Dem Kläger obliegt beim Zivilklageverfahren der
Nachweis und die genaue Berechnung seines Schadens, die
unter Umständen sehr schwierig ist. Aus dein Wege der
Strafverfolgung durch den Staatsanwalt hingegen wäre
der Verletzte dieser zivilprozessualischen Beweisführung
überhoben gewesen und hätte als Nebenkläger eine Buße
vom Nachbildner verlangen können, die, wenn sie auch
durch die Existenz eines Schadens bedingt ist, doch in ihrem
Betrage, wegen des in ihr liegenden Strafmomentes, nicht
an den Erweis eines wirklich eingetretenen Schadens von
bestimmter Höhe gebunden erscheint, sondern meist in
runder Summe genehmigt zu werden pflegt. (Vergi. Vr.
V. Wächter, Das Urheberrecht, S. 2^7.)
Dieser leichtere Weg der staatsanwaltlichen Strafver-
solgung und Nebenklage wurde dem Künstler verschlossen.
— Wir müssen leider konstatieren, daß auch im allge-
meinen die Künstlerschaft nur sehr selten in den Genuß
dieser Rechtswohltat gelangt! Kann ein Plagiator nur
einigermaßen seinen guten Glauben wahrscheinlich machen,
so lehnt die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgung sofort
ab. Im Falle Echteler contra Meier nehmen wir wohl
mit Recht an, daß die Staatsanwaltschaft die für diesen
Zweck bestehende künstlerische Sachverftändigcnkammer nicht
zn Rate gezogen oder mindestens ihr nicht eine der Nach-
bildungen vorgelegt hat. Jeder Sachverständige würde sie
doch sofort darauf aufmerksam gemacht haben, daß an Ab-
güssen aus einer zerbrochen gewesenen Form unbedingt
die Bruchnähte sichtbar sein müssen; daß also diese Ent-
schuldigung des Täters keinen Glauben verdiene. Wäre
die Staatsanwaltschaft diesen richtigen Weg gegangen, so
würde ihr also der gute Glaube Meiers, wenigstens in
bezug aus die Fortlassung des Urhebernamens, nicht so
ganz unwiderlegbar erschienen sein.
Klingt es nicht wie Hohn, wenn der neugebackene
Hosbildhauer, als Nachbildner, dein Künstler schreibt: „Ich
glaube, Herr Professor, daß Ihnen dieses nur zur Ehre
gereicht! Es wäre wohl besser von Ihnen gewesen, wenn
Sie sich danach erst erkundigt hätten." Ach nein, Herr-
Meier, so naiv sind die Künstler nun doch nicht mehr! Wei-
Hat denn das Honorar von 300 Mk. in die Tasche gesteckt?
Wer ist denn Hosbildhauer geworden? Doch nicht der
Künstler, sondern Sie, Herr Meier! O. W. v. X.
Kunst und brot.
i.
Eine Antwort aus den Artikel in Heft t8:
Sie versetzen einem ja förmlich den Atem, Herr Schmidt,
mit Ihrem Artikel — — solche Künstler gibts? Gibts
da bei Ihnen in Paris?
Da wird einem ja ganz gruselig! Gder sollten Sie
die Sache wie in einem Lachkabinett gesehen haben? Wo
dann so'n ganz großer Kops aus einem ganz kleinen Körper
ohne Beine ruht? Ei — das glaub ich, das ist ja zu
komisch. Also die Künstler halten sich für zu gut, um für
Geld zu arbeiten, — höchstens mal für Millionäre (pfeift
da nicht jemand?) und leben nur so vom Pump — d. h.
diejenigen, welche S i e kennen. Kennen Sie viele? Jeden-
falls, wenn man in Paris sitzt und noch gar für Zeitungen
schreibt —; oder sind Sie selbst Maler? Gder Bildhauer,
oder Graphiker, oder alles zusammen? Nein? So! Wo-
her kennen Sie denn die Künstler so genau? Ich glaube,
Sie müßten doch mal raus aus dein Lachkabinett und sich
mal die Maler usw. ansehcn, so wie sie wirklich sind!
Nee, so was, kommt Herr Schmidt aus Paris, dessen
Artikel ich so oft in der „Neuen Hamburger Zeitung" lese
und macht mir meine Kollegen schlecht! Pardon! sieht sie
in lauter Lachspiegeln! — Und wenn man höflichst fragen
darf, wozu, verehrter Herr, sind denn „Stipendien" da?
Damit sie in Sauer gekocht werden? Gder damit dafür
ein riesengroßer Affengarten angelegt wird? Entgegen der
Bestimmung der Stifter? — Mag doch jeder sehen, wie er
sich durchschlägt, — aber es gibt Länder, die so vernünftig
geworden sind, ausgebildeten (nicht „eingebildeten"!)
Künstlern, die sich aber doch im Schaffen behindert fühlen
— also nicht mehr „jungen" Leuten — Stipendien zu
geben, damit sie einige Jahre ruhig schaffen können; diese
Art Länder, z. B. Dänemark — sind demnach dann ganz
auf dem Holzwege?
G, ihr Kollegen, die ihr andere für euch arbeiten
laßt, um auf euren genialen Funken warten zu können —
(vielleicht im Bett?) wie findet man euch gemein, pfui!
Aber wo seid ihr — ach ja — in Paris.
Lrnst Litner, Hamburg.
II.
Replik der Schriftleitung:
Es sei uns gestattet, mit einigen Worten für den
Verfasser des Artikels „Kunst und Brot" in Heft t8 ein-
zutreten und zugleich unsere eigene Stellung zu erklären.
Bekanntlich geben wir, wie das ja aus der Notiz am
Kopfe unseres Blattes hervorgeht, mit dem Abdruck der
Aufsätze im „Sprechsaal" noch keineswegs eine Uebcrein-
stimmung mit den Meinungen der Verfasser zu erkennen,
wir hatten deshalb auch diesmal keinen Grund, den er-
wähnten Artikel abzulehnen, weil er mal einen Ton bläst,
der den Künstlern nicht angenehm klingt. Man möge ihn
doch sachlich widerlegen, denn nur in Rede und Gegen-
rede können auf beiden Seiten Irrtümer aufgeklärt und
rückständige Meinungen zum alten Eisen befördert werden.
Herr Karl Eugen Schmidt wünschte anscheinend durch
seine ins Groteske gesteigerte Schilderung der traumhaften
Ueberhebung und koketten Welt-Abgewandtheit mancher
Künstler zu erreichen, daß nun auch diese — wir hörten
kürzlich an dieser Stelle Einen reden — ihr idealistisches
Mäntelchen*) fallen lassen, und eingestehen, daß auch sie
sich den Stürmen des Lebens aussetzen müssen, wenn sie
nicht dauernd im Hintertreffen oder im Schmollwinkel
bleiben wollen. Nur dann können wir es erreichen, daß
viele Händler und Käufer ihre fo beleidigende Meinung
über den Künstler, er sei ihr vernunftloscs Ausbeutungs-
objekt, endlich und gründlich revidieren. Wir dürfen uns
in dieser Sache wohl ein Urteil erlauben, müssen wir doch
täglich erfahren, daß immer und immer wieder neue Tricks
erfunden werden, um den Künstler um den Erfolg seiner
Arbeit zu prellen. Und, Gott sei's geklagt, selbst die plum-
pesten Fallen finden ihre Vpfer, die dreistesten Täuschungen
ihre Glaubenden. Man liest es doch allwöchentlich in der
„Werkstatt der Kunst", daß die Künstler zuweilen so fest
von den Netzen der Ausbeuter umstrickt werden, daß sie
sich ohne den Beistand der Juristen oder der presse nicht
wieder daraus befreien können. Erst in letzter Zeit konnten
wir zu unserer Freude seltene Fälle erleben, in denen wir
vor der Tat cinspringen und helfen durften.
Dieser „unpraktische" Sinn hat durchaus nicht allein
in der besonderen Schaffensweise der Künstler seinen Ur-
sprung, sondern ist mehr ein Ueberrest einer unglückseligen
Weltanschauung, die wir doch alle mit vereinten Kräften
ausrotten wollen. Gb gerade Herr Karl Eugen Schmidt
die richtige Ursache in dem Hochmut und falschen Stolz
mancher Künstler gesunder: hat, lassen wir dahingestellt.
Jedenfalls sind wir fest davon überzeugt, daß er mit warmem
Herzen auf der Seite der Künstler steht, die er so gern al^
freie, unabhängige, deutsche Bürger sehen möchte. Es ist
auch gewiß kein Zufall, daß die Stimmen, die den, nicht
geldgierigen aber vernünftigen, Wirklichkeitssinn im täglichen
Leben predigen, unseren Landsleuten im Aus lau de an-
gehören, die dort einen größeren Abstand von den deutschen
Verhältnissen und einen freieren Ucbcrblick über sie ge-
wonnen haben. Kritr